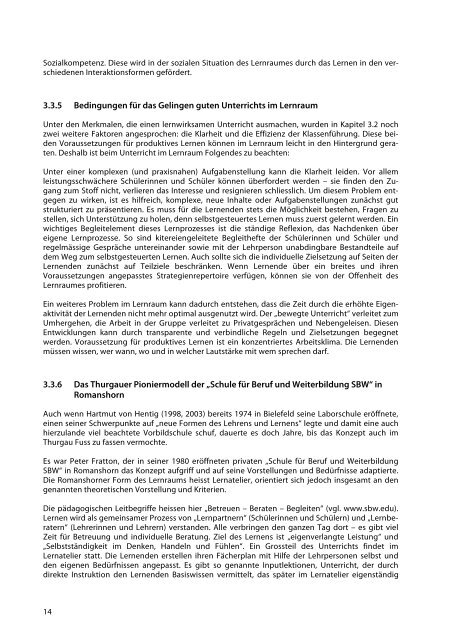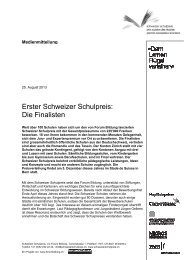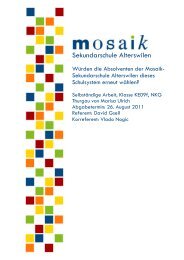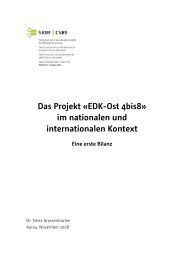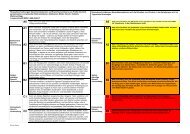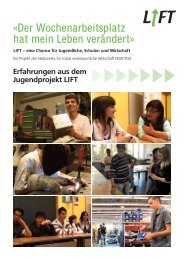Trachsler et al_Lernraum 2006.pdf - Pädagogische Hochschule Thurgau
Trachsler et al_Lernraum 2006.pdf - Pädagogische Hochschule Thurgau
Trachsler et al_Lernraum 2006.pdf - Pädagogische Hochschule Thurgau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sozi<strong>al</strong>komp<strong>et</strong>enz. Diese wird in der sozi<strong>al</strong>en Situation des <strong>Lernraum</strong>es durch das Lernen in den verschiedenen<br />
Interaktionsformen gefördert.<br />
3.3.5 Bedingungen für das Gelingen guten Unterrichts im <strong>Lernraum</strong><br />
Unter den Merkm<strong>al</strong>en, die einen lernwirksamen Unterricht ausmachen, wurden in Kapitel 3.2 noch<br />
zwei weitere Faktoren angesprochen: die Klarheit und die Effizienz der Klassenführung. Diese beiden<br />
Vorauss<strong>et</strong>zungen für produktives Lernen können im <strong>Lernraum</strong> leicht in den Hintergrund geraten.<br />
Desh<strong>al</strong>b ist beim Unterricht im <strong>Lernraum</strong> Folgendes zu beachten:<br />
Unter einer komplexen (und praxisnahen) Aufgabenstellung kann die Klarheit leiden. Vor <strong>al</strong>lem<br />
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler können überfordert werden – sie finden den Zugang<br />
zum Stoff nicht, verlieren das Interesse und resignieren schliesslich. Um diesem Problem entgegen<br />
zu wirken, ist es hilfreich, komplexe, neue Inh<strong>al</strong>te oder Aufgabenstellungen zunächst gut<br />
strukturiert zu präsentieren. Es muss für die Lernenden st<strong>et</strong>s die Möglichkeit bestehen, Fragen zu<br />
stellen, sich Unterstützung zu holen, denn selbstgesteuertes Lernen muss zuerst gelernt werden. Ein<br />
wichtiges Begleitelement dieses Lernprozesses ist die ständige Reflexion, das Nachdenken über<br />
eigene Lernprozesse. So sind kitereiengeleit<strong>et</strong>e Begleithefte der Schülerinnen und Schüler und<br />
regelmässige Gespräche untereinander sowie mit der Lehrperson unabdingbare Bestandteile auf<br />
dem Weg zum selbstgesteuerten Lernen. Auch sollte sich die individuelle Ziels<strong>et</strong>zung auf Seiten der<br />
Lernenden zunächst auf Teilziele beschränken. Wenn Lernende über ein breites und ihren<br />
Vorauss<strong>et</strong>zungen angepasstes Strategienrepertoire verfügen, können sie von der Offenheit des<br />
<strong>Lernraum</strong>es profitieren.<br />
Ein weiteres Problem im <strong>Lernraum</strong> kann dadurch entstehen, dass die Zeit durch die erhöhte Eigenaktivität<br />
der Lernenden nicht mehr optim<strong>al</strong> ausgenutzt wird. Der „bewegte Unterricht“ verleit<strong>et</strong> zum<br />
Umhergehen, die Arbeit in der Gruppe verleit<strong>et</strong> zu Privatgesprächen und Nebengeleisen. Diesen<br />
Entwicklungen kann durch transparente und verbindliche Regeln und Ziels<strong>et</strong>zungen begegn<strong>et</strong><br />
werden. Vorauss<strong>et</strong>zung für produktives Lernen ist ein konzentriertes Arbeitsklima. Die Lernenden<br />
müssen wissen, wer wann, wo und in welcher Lautstärke mit wem sprechen darf.<br />
3.3.6 Das <strong>Thurgau</strong>er Pioniermodell der „Schule für Beruf und Weiterbildung SBW“ in<br />
Romanshorn<br />
Auch wenn Hartmut von Hentig (1998, 2003) bereits 1974 in Bielefeld seine Laborschule eröffn<strong>et</strong>e,<br />
einen seiner Schwerpunkte auf „neue Formen des Lehrens und Lernens“ legte und damit eine auch<br />
hierzulande viel beacht<strong>et</strong>e Vorbildschule schuf, dauerte es doch Jahre, bis das Konzept auch im<br />
<strong>Thurgau</strong> Fuss zu fassen vermochte.<br />
Es war P<strong>et</strong>er Fratton, der in seiner 1980 eröffn<strong>et</strong>en privaten „Schule für Beruf und Weiterbildung<br />
SBW“ in Romanshorn das Konzept aufgriff und auf seine Vorstellungen und Bedürfnisse adaptierte.<br />
Die Romanshorner Form des <strong>Lernraum</strong>s heisst Lernatelier, orientiert sich jedoch insgesamt an den<br />
genannten theor<strong>et</strong>ischen Vorstellung und Kriterien.<br />
Die pädagogischen Leitbegriffe heissen hier „B<strong>et</strong>reuen – Beraten – Begleiten“ (vgl. www.sbw.edu).<br />
Lernen wird <strong>al</strong>s gemeinsamer Prozess von „Lernpartnern“ (Schülerinnen und Schülern) und „Lernberatern“<br />
(Lehrerinnen und Lehrern) verstanden. Alle verbringen den ganzen Tag dort – es gibt viel<br />
Zeit für B<strong>et</strong>reuung und individuelle Beratung. Ziel des Lernens ist „eigenverlangte Leistung“ und<br />
„Selbstständigkeit im Denken, Handeln und Fühlen“. Ein Grossteil des Unterrichts find<strong>et</strong> im<br />
Lernatelier statt. Die Lernenden erstellen ihren Fächerplan mit Hilfe der Lehrpersonen selbst und<br />
den eigenen Bedürfnissen angepasst. Es gibt so genannte Inputlektionen, Unterricht, der durch<br />
direkte Instruktion den Lernenden Basiswissen vermittelt, das später im Lernatelier eigenständig<br />
14