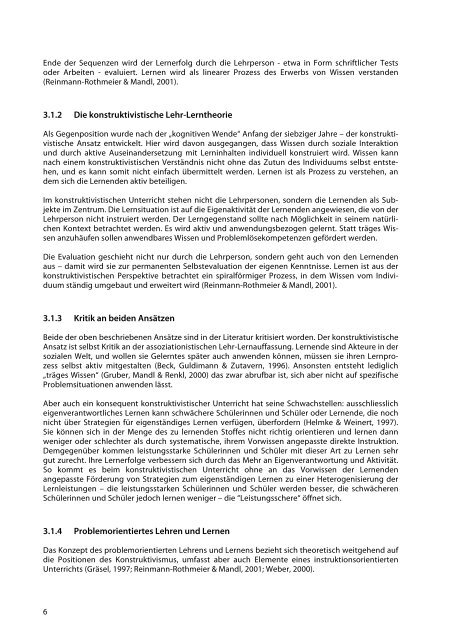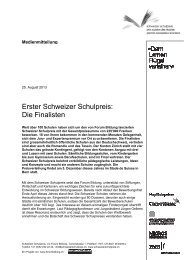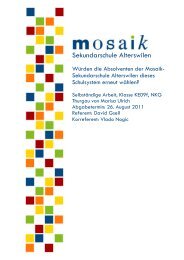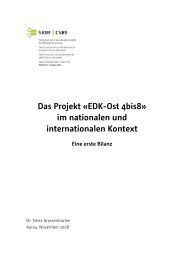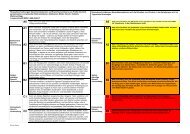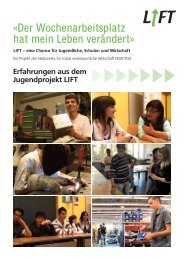Trachsler et al_Lernraum 2006.pdf - Pädagogische Hochschule Thurgau
Trachsler et al_Lernraum 2006.pdf - Pädagogische Hochschule Thurgau
Trachsler et al_Lernraum 2006.pdf - Pädagogische Hochschule Thurgau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ende der Sequenzen wird der Lernerfolg durch die Lehrperson - <strong>et</strong>wa in Form schriftlicher Tests<br />
oder Arbeiten - ev<strong>al</strong>uiert. Lernen wird <strong>al</strong>s linearer Prozess des Erwerbs von Wissen verstanden<br />
(Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001).<br />
3.1.2 Die konstruktivistische Lehr-Lerntheorie<br />
Als Gegenposition wurde nach der „kognitiven Wende“ Anfang der siebziger Jahre – der konstruktivistische<br />
Ansatz entwickelt. Hier wird davon ausgegangen, dass Wissen durch sozi<strong>al</strong>e Interaktion<br />
und durch aktive Auseinanders<strong>et</strong>zung mit Lerninh<strong>al</strong>ten individuell konstruiert wird. Wissen kann<br />
nach einem konstruktivistischen Verständnis nicht ohne das Zutun des Individuums selbst entstehen,<br />
und es kann somit nicht einfach übermittelt werden. Lernen ist <strong>al</strong>s Prozess zu verstehen, an<br />
dem sich die Lernenden aktiv b<strong>et</strong>eiligen.<br />
Im konstruktivistischen Unterricht stehen nicht die Lehrpersonen, sondern die Lernenden <strong>al</strong>s Subjekte<br />
im Zentrum. Die Lernsituation ist auf die Eigenaktivität der Lernenden angewiesen, die von der<br />
Lehrperson nicht instruiert werden. Der Lerngegenstand sollte nach Möglichkeit in seinem natürlichen<br />
Kontext b<strong>et</strong>racht<strong>et</strong> werden. Es wird aktiv und anwendungsbezogen gelernt. Statt träges Wissen<br />
anzuhäufen sollen anwendbares Wissen und Problemlösekomp<strong>et</strong>enzen gefördert werden.<br />
Die Ev<strong>al</strong>uation geschieht nicht nur durch die Lehrperson, sondern geht auch von den Lernenden<br />
aus – damit wird sie zur permanenten Selbstev<strong>al</strong>uation der eigenen Kenntnisse. Lernen ist aus der<br />
konstruktivistischen Perspektive b<strong>et</strong>racht<strong>et</strong> ein spir<strong>al</strong>förmiger Prozess, in dem Wissen vom Individuum<br />
ständig umgebaut und erweitert wird (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001).<br />
3.1.3 Kritik an beiden Ansätzen<br />
Beide der oben beschriebenen Ansätze sind in der Literatur kritisiert worden. Der konstruktivistische<br />
Ansatz ist selbst Kritik an der assoziationistischen Lehr-Lernauffassung. Lernende sind Akteure in der<br />
sozi<strong>al</strong>en Welt, und wollen sie Gelerntes später auch anwenden können, müssen sie ihren Lernprozess<br />
selbst aktiv mitgest<strong>al</strong>ten (Beck, Guldimann & Zutavern, 1996). Ansonsten entsteht lediglich<br />
„träges Wissen“ (Gruber, Mandl & Renkl, 2000) das zwar abrufbar ist, sich aber nicht auf spezifische<br />
Problemsituationen anwenden lässt.<br />
Aber auch ein konsequent konstruktivistischer Unterricht hat seine Schwachstellen: ausschliesslich<br />
eigenverantwortliches Lernen kann schwächere Schülerinnen und Schüler oder Lernende, die noch<br />
nicht über Strategien für eigenständiges Lernen verfügen, überfordern (Helmke & Weinert, 1997).<br />
Sie können sich in der Menge des zu lernenden Stoffes nicht richtig orientieren und lernen dann<br />
weniger oder schlechter <strong>al</strong>s durch systematische, ihrem Vorwissen angepasste direkte Instruktion.<br />
Demgegenüber kommen leistungsstarke Schülerinnen und Schüler mit dieser Art zu Lernen sehr<br />
gut zurecht. Ihre Lernerfolge verbessern sich durch das Mehr an Eigenverantwortung und Aktivität.<br />
So kommt es beim konstruktivistischen Unterricht ohne an das Vorwissen der Lernenden<br />
angepasste Förderung von Strategien zum eigenständigen Lernen zu einer H<strong>et</strong>erogenisierung der<br />
Lernleistungen – die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler werden besser, die schwächeren<br />
Schülerinnen und Schüler jedoch lernen weniger – die “Leistungsschere“ öffn<strong>et</strong> sich.<br />
3.1.4 Problemorientiertes Lehren und Lernen<br />
Das Konzept des problemorientierten Lehrens und Lernens bezieht sich theor<strong>et</strong>isch weitgehend auf<br />
die Positionen des Konstruktivismus, umfasst aber auch Elemente eines instruktionsorientierten<br />
Unterrichts (Gräsel, 1997; Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001; Weber, 2000).<br />
6