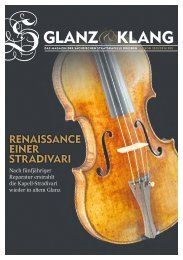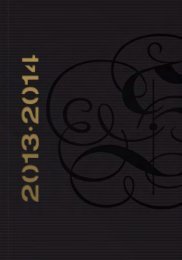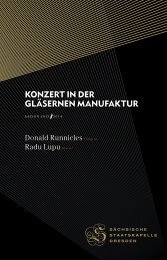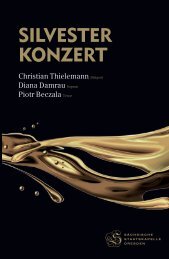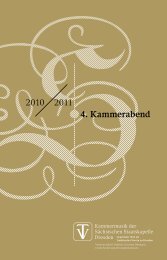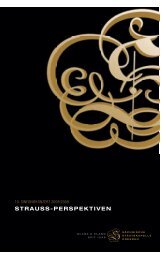Wagner- geburtstagskonzert II - Staatskapelle Dresden
Wagner- geburtstagskonzert II - Staatskapelle Dresden
Wagner- geburtstagskonzert II - Staatskapelle Dresden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ordnung zu bringen und dieses<br />
abzutragen, wie es zur Reputation<br />
eines Staatsangestellten – und ein<br />
solcher war <strong>Wagner</strong> – gehörte.<br />
Wegen <strong>Wagner</strong>s fortgesetzten<br />
politischen Aktivitäten hielt es<br />
Generaldirektor von Lüttichau für<br />
opportun, die Vorbereitungen für<br />
»Lohengrin« zu unterbrechen und<br />
die bereits bestellten Dekorationen<br />
vorläufig abzubestellen. Bekanntlich<br />
aber eskalierten die Ereignisse,<br />
Wag ner schloss sich Revolutionären<br />
wie Röckel, Bakunin, Semper an<br />
und verließ am 9. Mai 1849 heimlich<br />
das verbarrikadierte <strong>Dresden</strong>.<br />
Nach einigen Wechseln<br />
zwischen der Schweiz und Frankreich<br />
ließ sich <strong>Wagner</strong> schließlich<br />
in Zürich nieder, wohin auch Minna<br />
nachreiste. In seinem Schweizer Exil<br />
verfasste und publizierte er mehrere<br />
Schriften und betätigte sich, nicht<br />
»Eine Faust-Ouvertüre«<br />
Entstehung<br />
um die Jahreswende 1839/1840 in<br />
Paris als erster Satz einer geplanten<br />
»großen Faustsymphonie« (1. Fassung),<br />
kleinere Revisionen noch in Paris<br />
sowie später in der Dresdner Zeit, in<br />
der das Partiturmanuskript den Titel<br />
»Ouverture« erhielt; weitreichende<br />
Umarbeitung des Werkes, seit<br />
1852 angedacht, im Januar 1855 in<br />
Zürich (2. Fassung); Veröffentlichung<br />
des Erstdrucks unter dem Titel »Eine<br />
Faust-Ouverture« im Winter 1855<br />
Uraufführung<br />
1. Fassung: am 22. Juli 1844 als<br />
»Ouverture zu Göthes Faust (erster<br />
Theil)« im Palais des Großen Gartens<br />
in <strong>Dresden</strong> (Hofkapelle, Dirigent:<br />
Richard <strong>Wagner</strong>); 2. Fassung:<br />
am 23. Januar 1855 im Casino Zürich<br />
(Allgemeine Musikgesellschaft,<br />
Dirigent: Richard <strong>Wagner</strong>)<br />
zuletzt auf Anraten seines Freundes Franz Liszt, als Konzertdirigent. Die Bedingungen<br />
des Musizierens durfte er mit denjenigen in <strong>Dresden</strong> zwar keineswegs<br />
vergleichen, doch griff er auf sein dort erworbenes Repertoire zurück<br />
und stellte sogar eigene Werke vor: als aufwändigstes 1852 den »Fliegenden<br />
Holländer« szenisch, wozu er das originale Dresdner Stimmenmaterial geliehen<br />
bekam; der im Januar 1855 aufgeführten »Faust-Ouvertüre« gab er eine<br />
veränderte Fassung, und in dieser ist sie im Druck erschienen.<br />
Als der »Lohengrin« am 6. August 1859 auf die Dresdner Bühne<br />
kam, waren neun Jahre seit der Weimarer Uraufführung unter Franz Liszt<br />
vergangen; <strong>Wagner</strong> hatte soeben in der Schweiz seinen »Tristan« vollendet,<br />
seine Verbannungszeit aber noch nicht verbüßt …<br />
Die Werke des heutigen Geburtstagskonzerts<br />
Die Ouvertüre zu »Rienzi, der Letzte der Tribunen« schrieb <strong>Wagner</strong> als<br />
letzte Nummer des ganzen Werkes, er hatte bereits den vollen Überblick über<br />
das thematische Material. Und so überrascht die von ihm getroffene Themenwahl:<br />
In der langsamen Einleitung der Ouvertüre dominiert nach ausgehaltenen<br />
Trompetentönen, wie sie im 1. Akt der Ausrufung des Volkstribuns<br />
Uraufführung des »Rienzi« im Dresdner Hoftheater mit Joseph Tichatschek<br />
in der Hauptrolle und Wilhelmine Schröder-Devrient als Adriano, 1842<br />
vorangehen, die Musik zu Rienzis Gebet aus dem 5. Akt. Dort hat das Gebet<br />
die Funktion eines letzten Innehaltens vor der nicht mehr abwendbaren,<br />
letztlich selbstverschuldeten Katastrophe, ergreifend gedichtet und komponiert.<br />
Im raschen Hauptteil der Ouvertüre jedoch herrschen Jubeltöne vor,<br />
die, den Finali des 1. und 2. Aktes entnommen, glanzvoll-froh wirken und<br />
die Tragödie vergessen lassen. Im Finale des 5. Aktes der Oper bricht diese<br />
Tragödie umso unerbittlicher herein: Rienzis Gebet »Allmächt’ger Vater«<br />
war vergebens, der Tribun wird mit seiner Schwester Irene und deren treuem<br />
Geliebten Adriano unter den brennenden Trümmern des Kapitols begraben.<br />
Somit liefert die Ouvertüre ein Umkehrbild zum Verlauf des Dramas.<br />
Die Tondichtung »Eine Faust-Ouvertüre« zeigt <strong>Wagner</strong> als Instrumentalkomponisten.<br />
Sie wurde in Paris im Dezember 1839 und Januar 1840<br />
komponiert, also noch inmitten der Arbeiten am »Rienzi«. Formal der<br />
»Rienzi«-Ouvertüre ähnlich (und dieser vermutlich als eine Art Modell dienend),<br />
war sie allerdings für kein Bühnenwerk bestimmt, sondern, ergänzt<br />
durch weitere Sätze, für das Konzertpodium. <strong>Wagner</strong> plante eine vollständige<br />
Symphonie und nahm von Anfang an Bezug auf den 1. Teil von Goethes<br />
»Faust«, kam aber über Entwürfe zu einem zweiten Satz »Gretchen«<br />
nicht hinaus. Als der Dresdner Hofkapellmeister im Sommer 1844 ein<br />
Programm für das jährlich »zum Besten der Armen« im Palais des Großen<br />
Gartens bestimmte Konzert zusammenstellte, griff er zu jenem einzelnen<br />
vollendeten d-Moll-Satz, der erst jetzt den Titel »Ouverture« und die bei der<br />
18 19 <strong>Wagner</strong>-Geburtstagskonzert <strong>II</strong>