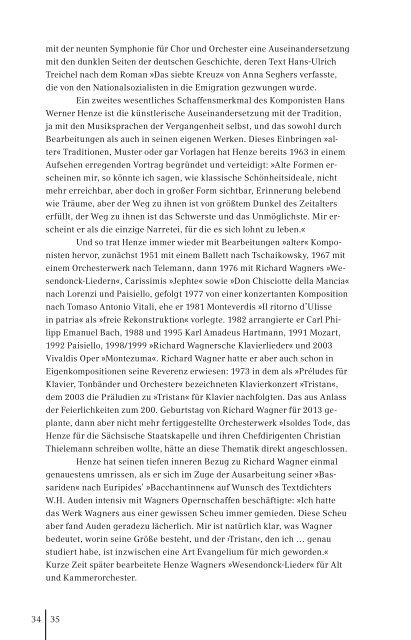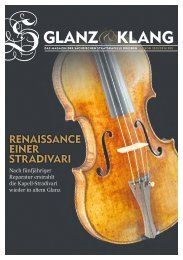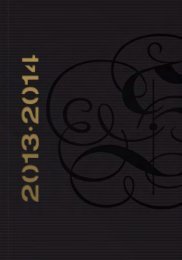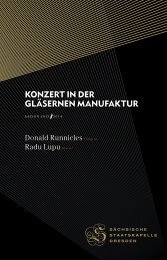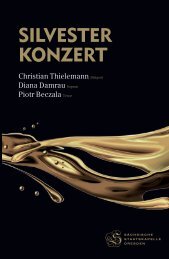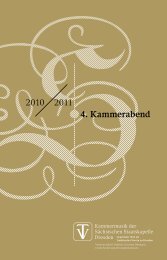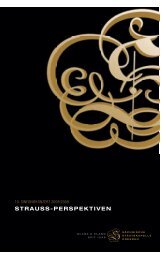Wagner- geburtstagskonzert II - Staatskapelle Dresden
Wagner- geburtstagskonzert II - Staatskapelle Dresden
Wagner- geburtstagskonzert II - Staatskapelle Dresden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mit der neunten Symphonie für Chor und Orchester eine Auseinandersetzung<br />
mit den dunklen Seiten der deutschen Geschichte, deren Text Hans-Ulrich<br />
Treichel nach dem Roman »Das siebte Kreuz« von Anna Seghers verfasste,<br />
die von den Nationalsozialisten in die Emigration gezwungen wurde.<br />
Ein zweites wesentliches Schaffensmerkmal des Komponisten Hans<br />
Werner Henze ist die künstlerische Auseinandersetzung mit der Tradition,<br />
ja mit den Musiksprachen der Vergangenheit selbst, und das sowohl durch<br />
Bearbeitungen als auch in seinen eigenen Werken. Dieses Einbringen »alter«<br />
Traditionen, Muster oder gar Vorlagen hat Henze bereits 1963 in einem<br />
Aufsehen erregenden Vortrag begründet und verteidigt: »Alte Formen erscheinen<br />
mir, so könnte ich sagen, wie klassische Schönheitsideale, nicht<br />
mehr erreichbar, aber doch in großer Form sichtbar, Erinnerung belebend<br />
wie Träume, aber der Weg zu ihnen ist von größtem Dunkel des Zeitalters<br />
erfüllt, der Weg zu ihnen ist das Schwerste und das Unmöglichste. Mir erscheint<br />
er als die einzige Narretei, für die es sich lohnt zu leben.«<br />
Und so trat Henze immer wieder mit Bearbeitungen »alter« Komponisten<br />
hervor, zunächst 1951 mit einem Ballett nach Tschaikowsky, 1967 mit<br />
einem Orchesterwerk nach Telemann, dann 1976 mit Richard <strong>Wagner</strong>s »Wesendonck-Liedern«,<br />
Carissimis »Jephte« sowie »Don Chisciotte della Mancia«<br />
nach Lorenzi und Paisiello, gefolgt 1977 von einer konzertanten Komposition<br />
nach Tomaso Antonio Vitali, ehe er 1981 Monteverdis »Il ritorno d’Ulisse<br />
in patria« als »freie Rekonstruktion« vorlegte. 1982 arrangierte er Carl Philipp<br />
Emanuel Bach, 1988 und 1995 Karl Amadeus Hartmann, 1991 Mozart,<br />
1992 Paisiello, 1998/1999 »Richard <strong>Wagner</strong>sche Klavierlieder« und 2003<br />
Vivaldis Oper »Montezuma«. Richard <strong>Wagner</strong> hatte er aber auch schon in<br />
Eigenkompositionen seine Reverenz erwiesen: 1973 in dem als »Préludes für<br />
Klavier, Tonbänder und Orchester« bezeichneten Klavierkonzert »Tristan«,<br />
dem 2003 die Präludien zu »Tristan« für Klavier nachfolgten. Das aus Anlass<br />
der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Richard <strong>Wagner</strong> für 2013 geplante,<br />
dann aber nicht mehr fertiggestellte Orchesterwerk »Isoldes Tod«, das<br />
Henze für die Sächsische <strong>Staatskapelle</strong> und ihren Chefdirigenten Christian<br />
Thielemann schreiben wollte, hätte an diese Thematik direkt angeschlossen.<br />
Henze hat seinen tiefen inneren Bezug zu Richard <strong>Wagner</strong> einmal<br />
genauestens umrissen, als er sich im Zuge der Ausarbeitung seiner »Bassariden«<br />
nach Euripides’ »Bacchantinnen« auf Wunsch des Textdichters<br />
W.H. Auden intensiv mit <strong>Wagner</strong>s Opernschaffen beschäftigte: »Ich hatte<br />
das Werk <strong>Wagner</strong>s aus einer gewissen Scheu immer gemieden. Diese Scheu<br />
aber fand Auden geradezu lächerlich. Mir ist natürlich klar, was <strong>Wagner</strong><br />
bedeutet, worin seine Größe besteht, und der ›Tristan‹, den ich … genau<br />
studiert habe, ist inzwischen eine Art Evangelium für mich geworden.«<br />
Kurze Zeit später bearbeitete Henze <strong>Wagner</strong>s »Wesendonck-Lieder« für Alt<br />
und Kammerorchester.<br />
Henzes »Fraternité«: eine »Millenniums-Botschaft«<br />
Anstelle der geplanten Komposition »Fraternité«,<br />
»Isoldes Tod« gelangt im heutigen Air pour l’orchestre<br />
Programm das Orchesterwerk »Fraternité«<br />
zur Aufführung, das Henze<br />
entstanden<br />
Frühjahr 1999<br />
1999 im Auftrag der New York Phil -<br />
Uraufführung<br />
harmonic Society für deren Orchester<br />
und den damaligen Chefdiri-<br />
11. November 1999 in New York<br />
(New York Philharmonic,<br />
genten Kurt Masur schrieb; die<br />
Dirigent: Kurt Masur)<br />
Uraufführung fand am 11. November<br />
1999 in der New Yorker Avery<br />
Besetzung<br />
Fisher Hall statt. Henze fasste Entstehung<br />
und Intention des Werkes<br />
3 Flöten (3. auch Altflöte),<br />
2 Oboen, Englischhorn,<br />
2 Klarinetten, Bassklarinette,<br />
seinerzeit in einem kurzen Text<br />
3 Fagotte (3. auch Kontrafagott),<br />
zusammen: »Im Oktober 1997 erhielt<br />
6 Hörner, 3 Trompeten, 5 Posaunen,<br />
ich eine Einladung von Kurt Masur,<br />
Tuba, Pauken, Schlagzeug, Harfe,<br />
dem Musikdirektor des ›New York Celesta, Klavier, Streicher<br />
Philharmonic‹, eine musikalische<br />
Botschaft für das kommende Millennium beizusteuern. Maestro Masurs Brief<br />
lautete: ›Mein Traum wäre, daß Sie uns ein 10 bis 15 Minuten dauerndes Werk<br />
zur Verfügung stellen, das sowohl für sich allein stehen als auch mit musikalischen<br />
Botschaften anderer Komponisten kombiniert werden kann, die wir<br />
zu einem vollen Konzertabend zusammenstellen würden.‹ Ich begrüßte die<br />
Gelegenheit, eine von sechs einzigartigen Perspektiven zu dieser kollektiven<br />
Erforschung des neuen Millenniums beisteuern zu können ... Meine Millenniums-Botschaft<br />
›Fraternité‹, Air for Orchestra, kann am besten als ruhiges<br />
und sanftes Werk beschrieben werden, in dem alle Instrumente des Orchesters<br />
wie eines sind ... und zum Lobe von Harmonie und Frieden singen.«<br />
Der Titel des Werkes, »Fraternité« (»Brüderlichkeit«), unterstreicht<br />
das Anliegen Henzes, das neue Millennium möge ein Zeitalter von »Harmonie<br />
und Frieden« sein, mit jenem französischen Wort, das 200 Jahre zuvor sowohl<br />
der Deklaration der Menschenrechte als auch der französischen Revolution<br />
als ein Leitspruch diente. Auch der im Partiturdruck französische Untertitel<br />
»Air pour l’orchestre« deutet auf die »französische Wurzel« der Haltung des<br />
Komponisten, die zugleich Absage an Ungerechtigkeit, Diktatur und Rassismus<br />
ist. Ein vielstimmiges Orchester, dessen Klanglichkeit durch eine große<br />
Blechbläserbesetzung, durch Harfe, Celesta und Klavier sowie durch Pauken<br />
und Schlagzeug überaus reiche und unterschiedliche Facetten bzw. Farben<br />
einbringt, trägt dieses Anliegen bald mit kammermusikalischer Transparenz,<br />
bald mit polyphoner Dichte, bald mit blockartiger Wucht vor, wobei<br />
die weiten, gleichsam unaufhörlich aussingenden Bögen der Violinen dem<br />
34 35 <strong>Wagner</strong>-Geburtstagskonzert <strong>II</strong>