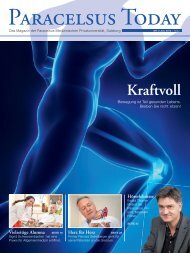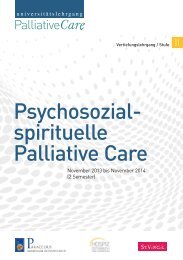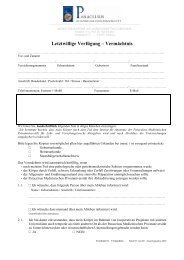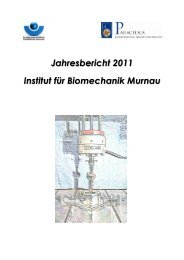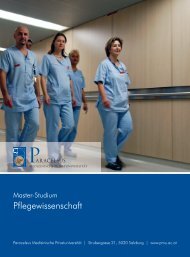Neurobiologie der Psychotherapie - PMU
Neurobiologie der Psychotherapie - PMU
Neurobiologie der Psychotherapie - PMU
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
auch für die Suizidforschung Relevanz haben. Doch die methodischen Voraussetzungen dafür sind im Kontext <strong>der</strong><br />
Suizidforschung nicht selbstverständlich. Im Vortrag wird das idiographische Systemmonitoring (ISM) vorgestellt,<br />
das es methodisch ermöglichen soll, nichtlineare Prozesscharakteristika auch in suizidalen Prozessen zu<br />
identifizieren. Das Potenzial von ISM zur Überbrückung <strong>der</strong> Kluft zwischen Forschung und einzelfallorientierter,<br />
therapeutischer Praxis, zur Entwicklung individueller Frühwarnsysteme und als computerunterstütztes, adjuvantes<br />
Therapietool wird diskutiert.<br />
"Hat das Gehirn eine Psyche?"<br />
Peter Schnei<strong>der</strong><br />
Was geschieht, wen die Psychologie zur Angewandten Neurologie wird, <strong>der</strong> "psychische Apparat" zum Gehirn? Mit<br />
den neuen Antworten, welche uns die Neurowissenschaften geben, än<strong>der</strong>t sich auch die Art <strong>der</strong> Fragen, die<br />
sinnvollerweise überhaupt noch gestellt werden können. Und mit <strong>der</strong> neuen Bild-Rhetorik <strong>der</strong> Neurosciences<br />
verän<strong>der</strong>t sich zudem die Weise, wie wir überhaupt noch über Psychisches sprechen und Psychisches - und damit<br />
uns selbst - verstehen können: Was bin ich, wenn ich mein Gehirn bin?<br />
Jenseits <strong>der</strong> Kausalität?<br />
Christine Zunke<br />
Die zunehmende Hinwendung <strong>der</strong> Psychologie zu neurowissenschaftlichen Erklärungen geht mit einem<br />
verän<strong>der</strong>ten Selbstverständnis dieser Disziplin einher: Sie begreift sich zunehmend als naturwissenschaftlich.<br />
Entsprechend werden Methoden und Erklärungsmuster modifiziert und Leistungen des Bewusstseins als mit<br />
neurophysiologischen Hirnprozessen verbunden gedacht. Das viel diskutierte Vermittlungsproblem zwischen<br />
mentalen und neuronalen Zuständen wird hierbei längst nicht mehr als Gegenstandswechsel angesehen, son<strong>der</strong>n<br />
als hyperkomplex vorgestellt und bleibt damit wesentlich kausal. Selbst wenn es als prinzipiell unmöglich erkannt<br />
wird, alle Determinanten eines hochkomplexen selbstorganisierten Systems anzugeben, muss doch ein<br />
durchgehen<strong>der</strong> Kausalzusammenhang angenommen werden. Das alte Grundsatzproblem <strong>der</strong> wesentlichen<br />
Verschiedenheit von Selbstbewusstsein und organischem Material, an dem <strong>der</strong> Dualismus von Descartes bis Libet<br />
scheiterte, wird nun von Konzepten wie Supervenienz, Synergetik o<strong>der</strong> Emergenz aufgenommen, aber nicht<br />
gelöst. Was auf <strong>der</strong> abstrakten Ebene als erkenntnistheoretischer Wi<strong>der</strong>spruch erscheint, tangiert auch die Praxis<br />
nicht-philosophischer Wissenschaften. So gewinnt die Psychologie durch ihre neurowissenschaftliche Wende auf<br />
<strong>der</strong> einen Seite neue Therapieansätze, droht aber auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite das emanzipative Potential, das <strong>der</strong><br />
klassischen Psychoanalyse mit ihrem Bezug auf ein autonomes Selbstbewusstsein innewohnt, zu verlieren.<br />
16