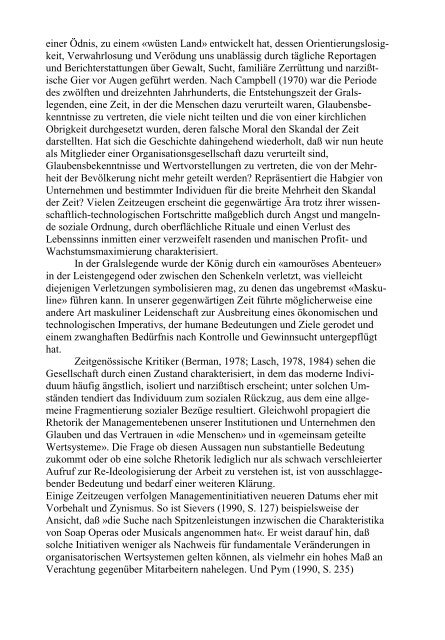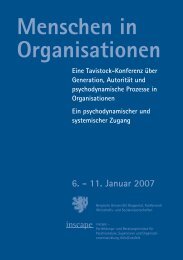Martin Bowles Der Management-Mythos: Seine Ausprägung und ...
Martin Bowles Der Management-Mythos: Seine Ausprägung und ...
Martin Bowles Der Management-Mythos: Seine Ausprägung und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einer Ödnis, zu einem «wüsten Land» entwickelt hat, dessen Orientierungslosigkeit,<br />
Verwahrlosung <strong>und</strong> Verödung uns unablässig durch tägliche Reportagen<br />
<strong>und</strong> Berichterstattungen über Gewalt, Sucht, familiäre Zerrüttung <strong>und</strong> narzißtische<br />
Gier vor Augen geführt werden. Nach Campbell (1970) war die Periode<br />
des zwölften <strong>und</strong> dreizehnten Jahrh<strong>und</strong>erts, die Entstehungszeit der Gralslegenden,<br />
eine Zeit, in der die Menschen dazu verurteilt waren, Glaubensbekenntnisse<br />
zu vertreten, die viele nicht teilten <strong>und</strong> die von einer kirchlichen<br />
Obrigkeit durchgesetzt wurden, deren falsche Moral den Skandal der Zeit<br />
darstellten. Hat sich die Geschichte dahingehend wiederholt, daß wir nun heute<br />
als Mitglieder einer Organisationsgesellschaft dazu verurteilt sind,<br />
Glaubensbekenntnisse <strong>und</strong> Wertvorstellungen zu vertreten, die von der Mehrheit<br />
der Bevölkerung nicht mehr geteilt werden? Repräsentiert die Habgier von<br />
Unternehmen <strong>und</strong> bestimmter Individuen für die breite Mehrheit den Skandal<br />
der Zeit? Vielen Zeitzeugen erscheint die gegenwärtige Ära trotz ihrer wissenschaftlich-technologischen<br />
Fortschritte maßgeblich durch Angst <strong>und</strong> mangelnde<br />
soziale Ordnung, durch oberflächliche Rituale <strong>und</strong> einen Verlust des<br />
Lebenssinns inmitten einer verzweifelt rasenden <strong>und</strong> manischen Profit- <strong>und</strong><br />
Wachstumsmaximierung charakterisiert.<br />
In der Gralslegende wurde der König durch ein «amouröses Abenteuer»<br />
in der Leistengegend oder zwischen den Schenkeln verletzt, was vielleicht<br />
diejenigen Verletzungen symbolisieren mag, zu denen das ungebremst «Maskuline»<br />
führen kann. In unserer gegenwärtigen Zeit führte möglicherweise eine<br />
andere Art maskuliner Leidenschaft zur Ausbreitung eines ökonomischen <strong>und</strong><br />
technologischen Imperativs, der humane Bedeutungen <strong>und</strong> Ziele gerodet <strong>und</strong><br />
einem zwanghaften Bedürfnis nach Kontrolle <strong>und</strong> Gewinnsucht untergepflügt<br />
hat.<br />
Zeitgenössische Kritiker (Berman, 1978; Lasch, 1978, 1984) sehen die<br />
Gesellschaft durch einen Zustand charakterisiert, in dem das moderne Individuum<br />
häufig ängstlich, isoliert <strong>und</strong> narzißtisch erscheint; unter solchen Umständen<br />
tendiert das Individuum zum sozialen Rückzug, aus dem eine allgemeine<br />
Fragmentierung sozialer Bezüge resultiert. Gleichwohl propagiert die<br />
Rhetorik der <strong>Management</strong>ebenen unserer Institutionen <strong>und</strong> Unternehmen den<br />
Glauben <strong>und</strong> das Vertrauen in «die Menschen» <strong>und</strong> in «gemeinsam geteilte<br />
Wertsysteme». Die Frage ob diesen Aussagen nun substantielle Bedeutung<br />
zukommt oder ob eine solche Rhetorik lediglich nur als schwach verschleierter<br />
Aufruf zur Re-Ideologisierung der Arbeit zu verstehen ist, ist von ausschlaggebender<br />
Bedeutung <strong>und</strong> bedarf einer weiteren Klärung.<br />
Einige Zeitzeugen verfolgen <strong>Management</strong>initiativen neueren Datums eher mit<br />
Vorbehalt <strong>und</strong> Zynismus. So ist Sievers (1990, S. 127) beispielsweise der<br />
Ansicht, daß »die Suche nach Spitzenleistungen inzwischen die Charakteristika<br />
von Soap Operas oder Musicals angenommen hat«. Er weist darauf hin, daß<br />
solche Initiativen weniger als Nachweis für f<strong>und</strong>amentale Veränderungen in<br />
organisatorischen Wertsystemen gelten können, als vielmehr ein hohes Maß an<br />
Verachtung gegenüber Mitarbeitern nahelegen. Und Pym (1990, S. 235)