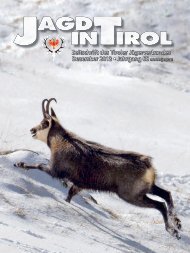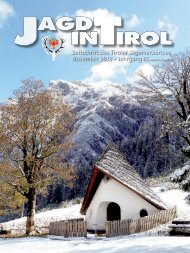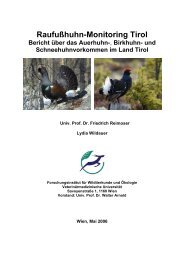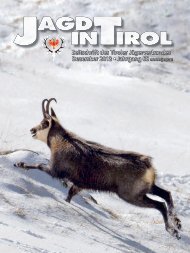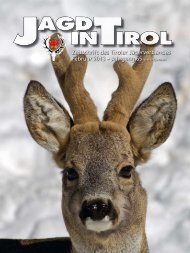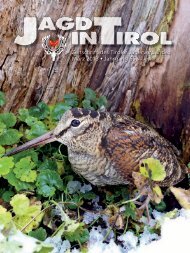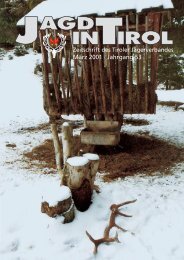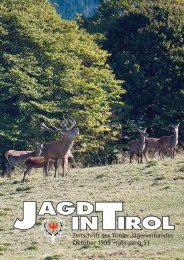Zeitschrift des Tiroler Jägerverbandes September 2011 • Jahrgang 63
Zeitschrift des Tiroler Jägerverbandes September 2011 • Jahrgang 63
Zeitschrift des Tiroler Jägerverbandes September 2011 • Jahrgang 63
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachartikel<br />
In Europa nutzen die großen<br />
Pflanzenfresser lediglich 1 bis 3 %<br />
der pflanzlichen Biomasse im Wald,<br />
weil viele dieser Tiere ihre Nahrung<br />
überwiegend nur aus der Gras- und<br />
Strauchschicht gewinnen können.<br />
Arten zu den Wirbeltieren. Und die für uns<br />
Jäger interessanten Tiere machen wiederum<br />
nur noch einen Bruchteil der Wirbeltierarten<br />
aus. Die Vielfalt von Wirbeltieren ist in<br />
einem Wald stark von der Waldgesellschaft<br />
und der vorherrschenden Waldstruktur abhängig.<br />
Dazu gibt es vor allem in Bezug auf<br />
die Artenvielfalt der Vögel eindrucksvolle<br />
Untersuchungsergebnisse. Diese bestätigten,<br />
dass mehrschichtige Waldbestände,<br />
gestuft in Boden-, Strauch-, Mittel- und<br />
Oberschicht, eine wesentlich höhere Vielfalt<br />
an Singvögeln aufweisen als einschichtige<br />
Hallenbestände derselben Waldgesellschaft.<br />
Der Grund dafür ist sicher im reichhaltigen<br />
Nischenangebot von gut strukturierten<br />
Waldbeständen zu suchen.<br />
Der Zusammenhang zwischen der<br />
Vielfalt von Pflanzenarten und der Vielfalt<br />
von Vögeln gilt natürlich keineswegs<br />
nur für den Wald, sondern für alle Landschaftstypen.<br />
Und hier ist bei uns gerade<br />
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen<br />
eine extreme Verarmung der Pflanzenvielfalt,<br />
als Folge von Überdüngung der<br />
Grasflächen, aber auch durch die Abräumung<br />
von ökologisch wichtigen Strukturelementen<br />
wie z. B. Hecken, Sträuchern,<br />
solitär oder in Kleingruppen stockenden<br />
Bäumen sowie durch die zunehmende Beseitigung<br />
von Steinhäufen und kleinen Geländebuckeln<br />
auf Freiflächen und Wiesen<br />
festzustellen. Mit der Entfernung dieser<br />
Strukturelemente und Überdüngung der<br />
Wiesen- und Weideflächen verschwinden<br />
sukzessive bestimmte Pflanzenarten, die<br />
wiederum Nahrungsbasis für spezielle Insektenarten<br />
sind. Manche Vögel sind wiederum<br />
auf bestimmte Insektentypen spezialisiert.<br />
Fallen diese infolge Ausrottung<br />
bestimmter Pflanzenarten aus, so findet<br />
auch der Vogel keine Nahrung mehr und<br />
verschwindet ebenfalls aus der Landschaft<br />
und somit auch aus der Nahrungskette.<br />
Aus diesem Grund kann auch die häufig<br />
diskutierte Entmischung <strong>des</strong> Wal<strong>des</strong> infolge<br />
intensiven selektiven Schalenwildverbisses<br />
nicht nur Auswirkungen auf die Waldgesellschaft,<br />
sondern durchaus auch auf die<br />
Vielfalt der Tierwelt haben.<br />
Das Tier – ein „Luxusgeschöpf“<br />
<strong>des</strong> Wal<strong>des</strong>?<br />
Die moderne Ökosystemforschung beurteilt<br />
die Meinung, dass der Wald auch ohne<br />
die Tiere leben könnte, sehr kritisch. In<br />
Europa nutzen die großen Pflanzenfresser<br />
lediglich 1 bis 3 % der pflanzlichen Biomasse<br />
im Wald, weil viele dieser Tiere ihre<br />
Nahrung überwiegend nur aus der Grasund<br />
Strauchschicht gewinnen können. Außerdem<br />
sind viele Pflanzen auf Grund der<br />
Einlagerung von Gerb- und Bitterstoffen<br />
für die Tiere ungenießbar. Und nicht zuletzt<br />
bestimmt auch das unterschiedliche<br />
Äsungsverhalten der Wildtiere den Nutzungsgrad<br />
der Pflanzen.<br />
Viele Untersuchungen zeigen aber, dass<br />
die Tiere im Wald keineswegs verzichtbare<br />
Luxusgeschöpfe sind, sondern dass ihnen<br />
ganz wichtige Funktionen im Waldökosystem<br />
zukommen. Denken wir nur an die<br />
Bestäubung vieler Pflanzen durch Insekten.<br />
Baumarten wie Vogel- und Wildkirsche,<br />
Linde und Ahorn sowie die Beersträucher<br />
sind in ihrer Vermehrung von der Bestäubung<br />
durch Insekten abhängig. Für die Verbreitung<br />
bestimmter Pflanzen übernehmen<br />
die größeren Tiere, vor allem Vögel aber<br />
auch Säugetiere, eine wichtige Aufgabe.<br />
Denken wir nur an die Vögel, die beispielsweise<br />
die schweren Samen von Zirben, Eichen<br />
und Buchen zu Tausenden verstecken<br />
und nicht alle auffressen und somit einen<br />
unverzichtbaren Beitrag zur Vermehrung<br />
und Verbreitung dieser Baumarten leisten.<br />
So soll ein Häher rund 10.000 Samen pro<br />
Herbst verstecken, die er nie zur Gänze<br />
nutzt. Die übrig gebliebenen Samenkerne<br />
werden von anderen Tierarten gefressen,<br />
viele haben jedoch die Möglichkeit, sich zu<br />
Keimlinge weiterzuentwickeln. Und selbstverständlich<br />
verdauen auch Schalenwild<br />
und früchtefressende Dachse, Füchse und<br />
Marder nicht jeden aufgenommen Samen,<br />
sondern scheiden diesen unverdaut über<br />
die Losung aus. Dort findet der Samen im<br />
Kothaufen <strong>des</strong> Tieres ein ideales Keimbett<br />
für seine weitere Entwicklung.<br />
Bei der Ansamung von Bäumen sei auch<br />
auf die positiven Auswirkungen der Trittund<br />
Wühltätigkeit der Tiere hingewiesen.<br />
In Laubwäldern mit dichtem Blattfilz<br />
kann man <strong>des</strong> Öfteren feststellen, dass die<br />
Plätzstellen der Rehböcke oft die einzigen<br />
Keimmöglichkeiten von Weiß- und Rottannen<br />
sind. Genauso wie die Abdrücke<br />
der Schalen <strong>des</strong> Wil<strong>des</strong> im Boden beliebte<br />
Keimbette sind. Bodenverwundungen,<br />
Wühl- und Grabtätigkeiten ändern allgemein<br />
die Standortbedingungen, die für die<br />
Entwicklung der Bodenvegetation sowohl<br />
von Vor- als auch Nachteil sein können.<br />
In gleicher Weise muss die Nährstoffumlagerung<br />
durch den Pflanzenverzehr der<br />
Tiere betrachtet werden.<br />
Diese kann durchaus zur Verbesserung<br />
der Bodenqualität, aber auch zur<br />
Aushagerung oder eben zur Eutrophierung<br />
eines Standortes führen. Letzteres<br />
passiert vor allem bei räumlich sehr<br />
konzentriertem Wildaufenthalt, wie z.B.<br />
6 Foto: Schatz<br />
Jagd in Tirol 09/<strong>2011</strong>