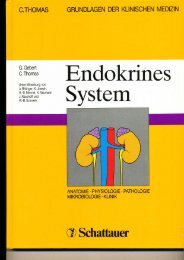ö Schaftlnuer
ö Schaftlnuer
ö Schaftlnuer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
E. Knochenerkrankungen 37<br />
R<strong>ö</strong>ntgen: In der Wirbelsäule linden sich sog. Bahmenwirbel<br />
mit erhaltenen Außenkonturen. Die Spongiosa<br />
läßt eine v<strong>ö</strong>llig ungleichmäßige strähnige Osteoskle<br />
rose mit balkenartig verdickten Trägerknochen und<br />
großen Spongiosalücken dazwischen erkennen. Die<br />
Grund- und Deckplatten sind sklerotisch verbreitert.<br />
Im VVirbelk<strong>ö</strong>rper k<strong>ö</strong>nnen sich osteosklerotische und<br />
osteoporotische Schichten abzeichnen (Dreischichtwir<br />
bel), oder es kann eine v<strong>ö</strong>llige Sklerose bestehen<br />
(Elfenbeinwirbel). Schädelaufnahmen zeigen eine<br />
ungleichmäßige Verdickung der Kalotte mit sklero<br />
tisch verbreiterter und verdichteter Tabula interna.<br />
Insgesamt erscheinen die betroffenen Knochenab<br />
schnitte grob-schwammig aufgelockert, wobei zwi<br />
schen strähnigen sklerotischen Verdichtungen immer<br />
wieder grobe Aufhellungen sichtbar sind. Im Schenkel<br />
hals führt dies zu einer Abbiegung des proximalen<br />
Femurs mit Coxa vara (sog. Bischofsstab). In der<br />
Fibula sowie den Hand- und Fußwurzelknochen tritt<br />
eigenartigerweise der Knochen-Paget nicht auf.<br />
Pathologie: Der r<strong>ö</strong>ntgenologisch nachweisbare Kno<br />
chenumbau ist auch makroskopisch erkennbar: Die<br />
Wirbelk<strong>ö</strong>rper zeigen eine vergr<strong>ö</strong>berte Spongiosa mit<br />
prominenten Trägerknochen; die Schädelkalotte ist<br />
grob-spongi<strong>ö</strong>s verdickt. Die betroffenen Knochenteile<br />
erscheinen ungleichmäßig sklerotisch verdichtet mit<br />
eingeschlossenen Spongiosalücken. Die histologischen<br />
Strukturen sind sehr tyisch: Man sieht unterschiedlich<br />
breite Knochenbälkchen mit zahlreichen mehrkerni<br />
gen Osteoklasten und tiefen Resorptionslakunen an<br />
einer Seite. Auf der Gegenseite erkennt man Reihen<br />
aktivierter Osteoklasten. Somit findet gleichzeitig ein<br />
Knochenab- und -anbau statt. Innerhalb der Knochen<br />
bälkchen zeichnet sich ein Mosaikmuster irregulärer<br />
Kittlinien ab. Dieser Wirrwarr an kurzen, abgehackten<br />
Kittlinien (Breccie-Muster) ist für den Paget-Knochen<br />
kennzeichnend. Der Markraum ist von einem lockeren<br />
Granulations- und Bindegewebe mit zahlreichen aus<br />
geweiteten, blutgefüllten Gefäßen und einigen lymphoplasmazellulären<br />
Infiltraten ausgefüllt. Hier k<strong>ö</strong>nnen<br />
sich Faserknochenbälkchen ausdifferenzieren.<br />
Klinik: Der Knochenumbau bei der Ostitis deformans<br />
Paget erfolgt in Schüben, wobei es zu Schmerzen und<br />
Deformierungen kommt. Die alkalische Serumphosphatase<br />
ist erh<strong>ö</strong>ht. Vielfach entwickelt sich eine split<br />
terfreie pathologische Knochen Irak tu r. In 2-5% der<br />
Fälle entsteht ein Osteosarkom (Paget-Osteosarkom;<br />
s.S. 80) mit schlechter Prognose.<br />
Abb.E-23: Morbus Paget. Oben: Deutlich verdickte Schädel<br />
kalotte. Unten: Unregelmäßig verbreiterte Knochenbälkchen<br />
mit osteoblastären Anbau- und osteoklastären Abbaufronten<br />
sowie mosaikartiger Zeichnung der Kittlinien. HE-Fbg.