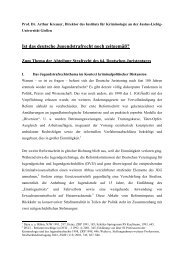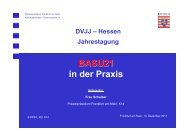Schlagstock und Gehhilfe: Erziehung als Krücke - DVJJ-Hessen
Schlagstock und Gehhilfe: Erziehung als Krücke - DVJJ-Hessen
Schlagstock und Gehhilfe: Erziehung als Krücke - DVJJ-Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Frank Heiner Weyel April 2008<br />
Vorbemerkung<br />
100 Jahre Jugendgerichte – 100 Jahre Jugendgerichtshilfe<br />
Am 30. Januar 1908 fand in Frankfurt am Main die erste Verhandlung eines voll ausgestatteten<br />
Jugendgerichtes statt. Das Frankfurter Modell wurde zum Vorbild im damaligen Deutschen<br />
Reich.<br />
Die <strong>DVJJ</strong> <strong>Hessen</strong> hat dieses denkwürdige Jubiläum am 30.1.2008 in einem Festakt im Frankfurter<br />
Römer gefeiert. Etwa 200 geladene Gäste waren gekommen.<br />
B<strong>und</strong>esjustizministerin Brigitte Zypries ging in ihrer Grußansprache auf das besondere Verhältnis<br />
zwischen Jugendgerichtshilfe <strong>und</strong> Jugendgerichte in der gegenwärtigen Situation ein<br />
<strong>und</strong> forderte eine Verbesserung der Ausstattung <strong>und</strong> der Zusammenarbeit beider Institutionen.<br />
Der Giessener Kriminologie Professor Dr. Arthur Kreuzer zeigte Parallelen im Verhältnis von<br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> Strafe damaliger <strong>und</strong> heutiger Zeit auf <strong>und</strong> setzte sich ausführlich mit der aktuellen<br />
Debatte zur Jugendkriminalität <strong>und</strong> Verbesserungsvorschlägen auseinander.<br />
Weitere Prominente Gäste waren der hessische Justizminister Banzer, der Frankfurter Stadtrat<br />
Boris Rhein, Landtagsabgeordnete <strong>und</strong> Stadtverordnete der verschiedenen Fraktionen sowie<br />
die Präsidenten des Oberlandesgerichtes Frankfurt, das Landgerichtes Frankfurt, des Amtsgerichtes<br />
Frankfurt <strong>und</strong> der Polizei Frankfurt. Zu den Geladenen gehörten auch zahlreiche Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe, von freien Trägern, Jugendrichter <strong>und</strong><br />
Staatsanwälte. Zahlreiche Pressevertreter waren erschienen, der Hessische R<strong>und</strong>funk berichte<br />
live.<br />
Die Festvorträge <strong>und</strong> Grußansprachen sind auf der Seite www.dvjj-hessen.de nachlesbar.<br />
Im Folgenden dokumentieren wir den Vortrag von Arthur Kreuzer, den er am 30.1.08 in etwas<br />
gekürzter Fassung gehalten hat.<br />
In einem weiteren Beitrag setzt sich der Pädagoge Frank H. Weyel mit dem Bedeutungswandel<br />
des <strong>Erziehung</strong>sgedankens im Jugendgerichtsverfahren auseinander <strong>und</strong> beschreibt zunächst<br />
die Kontinuität des autoritären <strong>Erziehung</strong>sverständnisses am Beispiel wichtiger Protagonisten<br />
aus Jugendhilfe <strong>und</strong> Justiz.<br />
Er kommt zu dem Ergebnis, dass der sogenannte „<strong>Erziehung</strong>sgedanke“ im Jugendgerichtsverfahren<br />
im Unterschied zu früheren Jahrzehnten in einer pluralen Gesellschaft keinen ideologischen<br />
oder moralischen Überbau braucht, sondern letztlich beschränkt ist auf das rationale<br />
Ziel der sozialen Integration.<br />
100 Jahre Jugendgerichtsverfahren<br />
1
<strong>Schlagstock</strong> <strong>und</strong> <strong>Gehhilfe</strong>: <strong>Erziehung</strong> <strong>als</strong> <strong>Krücke</strong><br />
„Es wird eine Zeit kommen,<br />
die keinen anderen Gedanken<br />
kennen wird <strong>als</strong> <strong>Erziehung</strong>.“<br />
(Friedrich Nitzsche,<br />
nach Heinrich Webler)<br />
Der <strong>Erziehung</strong>sgedanke ist die eigentliche Triebfeder des Jugendgerichtsverfahrens. Er ist das<br />
Unterscheidungsmerkmal von Jugendstrafrecht <strong>und</strong> allgemeinem Strafrecht.<br />
Das <strong>Erziehung</strong>sverständnis ist seit 100 Jahren, seit der Existenz der ersten Jugendgerichte in<br />
Deutschland, gleichzeitig Stein des Anstoßes.<br />
Schon dam<strong>als</strong> – genauso wie heute – verstanden die einen <strong>Erziehung</strong> <strong>als</strong> Gegensatz zu Strafe,<br />
die anderen wollten durch Strafe erziehen. Die einen verstanden <strong>Erziehung</strong> eher <strong>als</strong> Zuchtmittel,<br />
<strong>als</strong> „<strong>Schlagstock</strong>“ oder Rute, die anderen eher <strong>als</strong> „<strong>Gehhilfe</strong>“ auf dem Weg zum Erwachsenwerden.<br />
Und die große Mehrheit bewegte sich irgendwo zwischen diesen Polen.<br />
Dieser Umstand macht es so schwer, mit dem <strong>Erziehung</strong>sbegriff verlässlich umzugehen. Im<br />
Unterschied zu Rechtsbegriffen, die eine lange Tradition der fokussierenden begrifflichen<br />
Eingrenzung haben, unterliegen pädagogische Begriffe einer ungleich breiteren Definitionsvielfalt<br />
<strong>und</strong> Interpretationsfähigkeit.<br />
Nicht zufällig hat der Jurist Pieplow den <strong>Erziehung</strong>sbegriff im Jugendstrafverfahren <strong>als</strong><br />
„Chiffre“ bezeichnet, um damit die Unmöglichkeit zu umschreiben, klar zu umreißen, was<br />
<strong>Erziehung</strong> nun sei. 1<br />
Eine Chiffre ist allerdings ein Geheimzeichen, hinter dem sich etwas Unsichtbares verbirgt.<br />
Ich möchte mich damit nicht zufrieden geben <strong>und</strong> hier einen Beitrag zur Aufhellung leisten.<br />
Mein Anliegen ist es, das <strong>Erziehung</strong>sverständnis einflussreicher Protagonisten der Jugendgerichtsbewegung<br />
ein wenig transparent zu machen <strong>und</strong> die Unterschiede zwischen damaligem<br />
<strong>und</strong> heutigem Verständnis herauszuarbeiten. Ich lege meine Schwerpunkte dabei auf die<br />
Gründungszeit, Verbindungslinien zum Nation<strong>als</strong>ozialismus <strong>und</strong> ich stelle Bezüge zu heutigen<br />
Diskussionen her. Was ist von dem alten <strong>Erziehung</strong>sverständnis bis heute erhalten geblieben?<br />
Hat es sich gr<strong>und</strong>legend verändert?<br />
Mir geht es hier nicht um die Anführung <strong>und</strong> Anhäufung bloßer Verlautbarungen zur <strong>Erziehung</strong>,<br />
sondern um Freilegung des dahinter liegenden Verständnisses – so weit das in dieser<br />
relativ kurzen Betrachtung möglich ist.<br />
1 Pieplow, Lukas: <strong>Erziehung</strong> <strong>als</strong> Chiffre. In Walter, Michael(Hg.):Beiträge zur <strong>Erziehung</strong> im Jugendkriminalrecht,<br />
Köln u.a. 1989, S. 5<br />
2
Der sogenannte „<strong>Erziehung</strong>sgedanke“ war seit jeher das Elixier des Jugendgerichtsverfahrens.<br />
Auf die Strafe wollte man allerdings nie verzichten.<br />
Wenn bis heute in fast regelmäßigen Abständen, oft vor Wahlen oder nach spektakulären Jugendstraftaten,<br />
politisch über die Verschärfung des Jugendstrafrechts laut nachgedacht wird,<br />
dann geht es dabei hintergründig auch um den Gr<strong>und</strong>konflikt „Erziehen oder Strafen“.<br />
Reicht <strong>Erziehung</strong> <strong>als</strong> Reaktion auf strafbares Verhalten aus? Die <strong>Erziehung</strong> wird dann gerne<br />
diskreditiert („Kuschelpädagogik“) oder einfach umgedeutet <strong>und</strong> faktisch <strong>als</strong> Strafmaßnahme<br />
interpretiert (<strong>Erziehung</strong>scamp oder <strong>Erziehung</strong> im Strafvollzug).<br />
Heinrich Webler(1897-1981), ein in der Weimarer Republik <strong>und</strong> ebenso zu Zeiten des Nation<strong>als</strong>ozialismus<br />
<strong>und</strong> danach bedeutender Jugendrechtler hatte 1928 eine in Fachkreisen viel<br />
beachtete Streitschrift mit dem Titel: „Wider das Jugendgericht“ veröffentlicht. 2<br />
Webler war durchaus kein Randständiger dam<strong>als</strong>, sondern gehörte zu den Vätern der Jugendhilfe<br />
3 , er war einer der Weggefährten von Wilhelm Polligkeit(1876-1960) 4 <strong>und</strong> Christian Jasper<br />
Klumker(1868-1942) 5 .<br />
Webler stellt seinem heiß diskutieren Aufsatz „Wider das Jugendgericht“ einen angeblichen<br />
Ausspruch Friedrich Nietzsches (1844-1900) voran: „Es wird eine Zeit kommen, die keinen<br />
anderen Gedanken kennen wird <strong>als</strong> <strong>Erziehung</strong>.“<br />
Für den Pädagogen drängt sich die Frage auf: Hat Webler mit der Anführung dieses Zitates<br />
von Nitzsche sein eigenes Wunschdenken transportieren wollen, identifizierte es sich damit? 6<br />
2 Webler, Heinrich: Wider das Jugendgericht. In: Polligkeit, Scherpner, Webler (Hg.): Fürsorge <strong>als</strong> persönliche<br />
Hilfe. Festgabe für Prof. Dr. Christian Jasper Klumker zum 60. Geburtstag am 22.12.1928, Berlin 1929<br />
3 Ab 1923 zunächst Geschäftsführer, war Webler von 1926 bis 1960 Direktor des „Archivs deutscher Berufsvormünder“,<br />
später „Deutsches Institut für Jugendhilfe“ bzw. „Deutsches Institut für Vorm<strong>und</strong>schaftswesen“,<br />
heute „Deutsches Institut für Jugendhilfe <strong>und</strong> Familienrecht“. Webler gab zur Zeit der Naziherrschaft die Gesetzessammlung<br />
„Deutsches Jugendrecht“ heraus. 1943 wurde Webler von H. Himmler zum Obersturmbannführer<br />
der SS befördert. Er war dem „Lebensborn“ zugewiesen, sein Archiv arbeitete mit diesem eng zusammen.<br />
4 Wilhelm Polligkeit(1876-1960), Dr. jur. (1907), Dr. rer. pol. h.c. (1951), seit 1929 Honorarprofessor an der<br />
Universität Frankfurt a.M. Geschäftsführer der „Centrale für private Fürsorge“ <strong>und</strong> im „Institut für Gemeinwohl“<br />
in Frankfurt a.M., 1922–1935 <strong>und</strong> 1946–1950 Vorsitzender des des Deutschen Vereins für öffentliche <strong>und</strong> private<br />
Fürsorge, 1945/46 Leiter des Frankfurter Wohlfahrtsamtes, ab 1949 wesentlich an der Reaktivierung des<br />
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beteiligt.<br />
5 Klumker wurde am 1.4.1911 in Frankfurt am Main der erste Lehrstuhlinhaber für Armenwesen <strong>und</strong> Fürsorge<br />
im Deutschen Reich. Er baute das Vorm<strong>und</strong>schaftswesen im Deutschen Reich auf <strong>und</strong> war Gründer des „Archivs<br />
deutscher Berufsvormünder.“<br />
6 Bisher konnte die F<strong>und</strong>stelle des Zitates nicht ermittelt werden, auch der renommierte Nitzsche-Forscher Henning<br />
Ottmann konnte mir hier nicht weiterhelfen.<br />
3
Soll in seiner Vorstellung alles unter dem Primat der <strong>Erziehung</strong> stehen, auch bei strafrechtlichen<br />
Verfehlungen Jugendlicher?<br />
Bei näherer Beschäftigung mit Weblers Beitrag wird klar, dass er <strong>Erziehung</strong> <strong>als</strong> etwas Absolutes<br />
betrachtete, er versprach sich von ihr die Lösung aller vermeintlichen Fehlentwicklungen.<br />
Und dabei konnte er sich nicht nur auf Nitzsche berufen, der ja seinerseits auch ziemlich<br />
kuriose, um nicht zu sagen „wirre“ Gedanken von sich gab (jedenfalls in seinen späteren Jahren)<br />
<strong>und</strong> etwa von der „Züchtung des reinen Menschen“ sprach. 7<br />
Schon der alte Immanuel Kant (1724-1804) referierte in seinen Vorlesungen 1776/77 über die<br />
Pädagogik: „Es ist entzückend, sich vorzustellen, dass die menschliche Natur immer besser<br />
durch <strong>Erziehung</strong> werde entwickelt werden, <strong>und</strong> dass man diese in eine Form bringen kann, die<br />
der Menschheit angemessen ist. Dies eröffnet uns den Prospekt zu einem künftigen glücklichern<br />
Menschengeschlechte.“ 8<br />
Und der Aufklärer Kant erhoffte sich diesen positiven Effekt insbesondere von der öffentlichen<br />
<strong>Erziehung</strong>, weil sie in der Lage sei, die Fehler des Elternhauses auszugleichen.<br />
Die Institutionalisierung <strong>und</strong> öffentliche Wahrnehmung der <strong>Erziehung</strong> gelang bekanntlich in<br />
besonders „perfektem“ Maße in Preußen in Schule <strong>und</strong> Militär, vornehmlich im 19. <strong>und</strong> zu<br />
Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts.<br />
Franz von Liszt (1851-1919), unstreitig einer der großen Väter der Jugendgerichtsbewegung,<br />
hielt flammende Reden für die erzieherische Behandlung junger Menschen, die gefehlt hatten:<br />
„So verspricht (die Fürsorge) den Jugendlichen gegenüber die schönsten Erfolge, <strong>und</strong> zwar<br />
um so mehr, je früher sie einsetzt.“ 9<br />
Liszt stellt das staatliche Strafen in Frage, Gerichtsverhandlungen waren für ihn eine „schwere<br />
Gefahr“. 10 Auch über den Strafvollzug äußerte er sich kritisch.<br />
Schaut man aber genauer hin, wird deutlich, dass Liszt eher Missstände kritisiert <strong>als</strong> gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
Strafe <strong>und</strong> Strafvollzug in Frage zu stellen.<br />
So will er jugendgemäße Verhandlungen <strong>und</strong> erzieherisch gestalteten Freiheitsentzug. Und<br />
nicht nur das: im Jahre 1900 fordert er, dass „das gesetzliche Mindestmaß der Freiheitsstrafe,<br />
7 Safranski, Rüdiger: Romantik. Eine deutsche Affäre, 2007, S. 358<br />
8 Immanuel Kant: Über die <strong>Erziehung</strong>, München 1997, S. 10<br />
9 Franz von Liszt: Strafrecht <strong>und</strong> Jugendkriminalität. In: Simonsohn, Berthold(Hg.): Jugendkriminalität, Strafjustiz<br />
<strong>und</strong> Sozialpädagogik, Frankfurt am Main 1969, S. 41<br />
10 Simonsohn, Berthold(Hg.): Jugendkriminalität, Strafjustiz <strong>und</strong> Sozialpädagogik, Frankfurt am Main, 1969, S.<br />
40 f.<br />
4
wenigstens den Jugendlichen gegenüber, ganz wesentlich erhöht wird. Das ist die Forderung,<br />
die mir seit langen Jahren besonders am Herzen liegt.“ 11<br />
Und warum fordert Liszt dies? Wegen der <strong>Erziehung</strong>! Wenn der Jugendliche schon eingesperrt<br />
werden muss, dann möglichst lange, damit man ihn erzieherisch bearbeiten kann. Das<br />
ist die Logik der damaligen Zeit. Sie hat sich bis heute im Jugendgerichtsgesetz erhalten.<br />
Dazu später mehr.<br />
Die Diskussion über das Verhältnis von <strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> Strafe beschäftigte schon den Dritten<br />
Jugendgerichtstag 1912. Der <strong>Erziehung</strong>swissenschaftler Prof. Foerster plädierte für härteres<br />
Strafen von jungen Menschen – vor den Jugendgerichten – <strong>und</strong> setzte sich für „strenge <strong>und</strong><br />
präzise“ Trennung der beiden ein. Der Strafrechtler Mittermaier war mit dieser Sichtweise<br />
nicht einverstanden, er wollte die Strafe in der <strong>Erziehung</strong>stätigkeit verwirklicht sehen. „Die<br />
Strafe Foersters wollen wir in der <strong>Erziehung</strong> verwirklichen, <strong>und</strong> wir können sie nur in der<br />
<strong>Erziehung</strong> verwirklichen, nie aber in der Strafe des Staates.“ 12 Was sie einte war die Vorstellung:<br />
Strafe muss sein.<br />
Zurück zu Webler, der seinerseits ebenfalls in dieser Tradition sozialisiert wurde.<br />
Webler beklagt, dass mit der Durchführung einer Gerichtsverhandlung „schwerstes Geschütz“<br />
gegen junge Menschen aufgefahren werde. Rechtsstrafverfahren <strong>und</strong> <strong>Erziehung</strong> widersprächen<br />
sich absolut. 13<br />
Gleichzeitig ist er blind für die Tatsache, dass gerade auch <strong>Erziehung</strong>smaßnahmen schwerstes<br />
Geschütz sein können.<br />
In dem besagten Aufsatz „Wider das Jugendgericht“ fordert er beispielsweise, „dass dem<br />
einmal bestimmten verantwortlichen Erzieher absolute Freiheit in der Wahl der Mittel“ zustehen<br />
müssten. Diese Mittel schlössen die „<strong>Erziehung</strong>sstrafe“ nicht aus. 14<br />
Strafe wird hier <strong>als</strong>o nicht <strong>als</strong> Gegensatz zur <strong>Erziehung</strong> gesehen, sondern <strong>als</strong> ein Mittel derselben.<br />
<strong>Erziehung</strong> ist nach Webler <strong>als</strong>o ein absoluter Gegensatz zur Strafe, aber nicht weil er Strafe<br />
ablehnt, sondern weil er Strafe eingebettet in erzieherisches Handeln sehen will.<br />
11 ebd. S. 41<br />
12 Mittermaier, Wolfgang: Strafe <strong>und</strong> <strong>Erziehung</strong>, Sühne <strong>und</strong> Besserung. Referat auf dem 3 Deutschen Jugendgerichtstag.<br />
In: Simonsohn, Berthold(Hg.): Jugendkriminalität, Strafjustiz <strong>und</strong> Sozialpädagogik, Frankfurt am<br />
Main, 1969, S. 58 ff.<br />
13 Webler, a.a.O., S. 2<br />
14 ebd., S. 8<br />
5
Diese Absolutsetzung der <strong>Erziehung</strong> hat Webler konsequent durchgehalten. Als fünf Jahre<br />
nach Veröffentlichung seines Aufsatzes Hitler an die Macht kam, sah er die Zeit gekommen,<br />
in der seine Vorstellungen endlich Wirklichkeit werden sollten. Im Nation<strong>als</strong>ozialismus<br />
konnte sich, so seine Hoffnung, das volle Potential seiner Vorstellung von <strong>Erziehung</strong> entfalten.<br />
In seinem Buch „Deutsches Jugendrecht“ aus dem Jahre 1936 führt er aus: „Mit dem Erstarken<br />
der Jugendbewegung vor dem Weltkrieg wurde die Jugend zwar schon in ihrer Gesamtheit<br />
<strong>als</strong> Altersfolge (Generation) gesehen, aber erst der Nation<strong>als</strong>ozialismus hat sie im<br />
tiefsten Sinne <strong>als</strong> das werdende Volk begriffen.“ (Hervorhebung: F.W.) 15<br />
<strong>Erziehung</strong> der Jugend hatte vor allem anderen einem Ziel zu dienen: dem Wohl <strong>und</strong> der Reinerhaltung<br />
des deutschen Volkes.<br />
Auch Wilhelm Polligkeit, der bis heute <strong>als</strong> Nestor der Jugendhilfe gilt, begrüßte die Machtübernahme<br />
der Nazis. Schon am 31.5.1933 schlug er vor, „in weit höherem Maße <strong>als</strong> bisher<br />
Rechtsbestimmungen festzulegen, die ein autoritäres, sozialpädagogisches, festes Vorgehen<br />
gegen alle asozialen Elemente (Arbeitslose, Trunksüchtige usw.) in größerem Umfang <strong>als</strong><br />
seither ermöglichen.“ 16<br />
Auch bei Polligkeit gibt es eine historische Kontinuität in Bezug auf diese Haltung.<br />
Er war es, der schon 1907 in seiner juristischen Dissertation das „Recht des Kindes auf <strong>Erziehung</strong>“<br />
17 gefordert hatte, <strong>und</strong> dessen Leitspruch bis heute das Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilferecht<br />
bestimmt.<br />
Zwar war die Forderung eines Rechtes auf <strong>Erziehung</strong> sicher ein Fortschritt für die damalige<br />
Zeit, es wird aber oft übersehen, welch autoritäres <strong>Erziehung</strong>sverständnis dem zugr<strong>und</strong>e lag.<br />
Denn ob Kinder dieses objektive Recht, das von Erwachsenen definiert wird, auch subjektiv<br />
<strong>als</strong> förderlich für ihre Entwicklung erfahren, ist eine ganz andere Sache <strong>und</strong> stark zu bezweifeln.<br />
Polligkeit könnte man <strong>als</strong> ersten deutschen Jugendgerichtshelfer bezeichnen. Er baute in<br />
Frankfurt am Main ab Anfang des zwanzigsten Jahrh<strong>und</strong>erts die Jugendgerichtshilfe auf. Das<br />
Frankfurter Modell wurde ab 1908 zum Vorbild für die Entstehung vieler anderer Jugendgerichte<br />
<strong>und</strong> Jugendgerichtshilfen im damaligen Deutschen Reich.<br />
15 Jenner, Harald: Ein Jahrh<strong>und</strong>ert Jugendhilfe <strong>und</strong> Familienrecht, Heidelberg 2006, S. 115<br />
16 Eckhardt, Dieter: Soziale Einrichtungen sind Kinder ihrer Zeit, Frankfurt am Main 1999, S. 119<br />
17 Kurzfassung in: Polligkeit, Scherpner, Webler, a.a.O.<br />
6
Bereits 1905 hatte Polligkeit gefordert, dem <strong>Erziehung</strong>srecht der Eltern müsse auf der anderen<br />
Seite im gleichen Umfange ein <strong>Erziehung</strong>srecht des Kindes entsprechen. Das Recht des Kindes<br />
auf <strong>Erziehung</strong> begründete er allerdings nicht mit dem subjektiven Recht des Individuums<br />
auf angemessene Förderung, sondern dieses <strong>Erziehung</strong>srecht sollte „die Vorbedingung für<br />
seine soziale Brauchbarkeit“ sein. 18 Auch später sprach Polligkeit immer wieder vom Volksinteresse<br />
bei der <strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> der Sittenaufsicht seitens des Staates.<br />
<strong>Erziehung</strong> war für ihn nicht Kuschelpädagogik, gerade gegen diesen schon dam<strong>als</strong> immer<br />
wieder geäußerten Verdacht wehrte er sich vehement. Ihm war es ein großes Anliegen, „der<br />
im Publikum verbreiteten laxen Auffassung entgegenzuarbeiten, <strong>als</strong> sei nun jedes Delikt ein<br />
harmloser Bubenstreich, den man nachsichtig übersehen könne. An keinem rächt sich diese<br />
unangebrachte Nachsichtigkeit bitterer, <strong>als</strong> an dem haltlosen Jugendlichen selbst …“. 19<br />
Für einen bedeutenden Begründer des Jugendfürsorgewesens hatte Polligkeit, was die <strong>Erziehung</strong><br />
anging, ein recht einfaches Prinzip, an dem er sich orientierte: Wie ein Kind, das einen<br />
unmittelbaren Schmerz spüre, wenn es sich mit der Nadel in den Finger steche, so müssten<br />
auch auf Verfehlungen Jugendlicher unmittelbare schmerzhafte richterliche Reaktionen folgen,<br />
so seine Einsicht.<br />
Das Nadel-Beispiel so einfach auf ein Gerichtsverfahren zu übertragen erscheint ziemlich<br />
lebensfremd, denkt man alleine an die Monate, die – dam<strong>als</strong> wie heute – zwischen Tat <strong>und</strong><br />
Verhandlung vergehen.<br />
Eine tieferschürfende Erörterung, was unter <strong>Erziehung</strong> zu verstehen sei, sucht man bei Polligkeit<br />
vergebens.<br />
<strong>Erziehung</strong> bedeutete in seiner Sichtweise neben gutgemeinter Zuwendung auch schmerzhafte<br />
Reaktionen, durch den Richter ebenso wie durch Fürsorgeerziehung in geschlossenen Heimen,<br />
Drill, Prügelstrafen.<br />
Die Vorstellung Polligkeits, aber auch Weblers war letztlich die vollkommene staatliche Ü-<br />
berwachung der <strong>Erziehung</strong>. <strong>Erziehung</strong> sollte nicht erst einsetzen wenn die Eltern versagt hatten.<br />
20<br />
Während Polligkeit die <strong>Erziehung</strong> durchaus auch durch richterliches Handeln gefördert sah<br />
(„jede Straftat zur Kenntnis des Richters bringen“ 21 ), wollte Webler das „Strafen“ auch in der<br />
Hand des Erziehers sehen (s.o.) <strong>und</strong> ganz auf Jugendgerichte verzichten.<br />
18 Peukert, Detlev: Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg <strong>und</strong> Krise der deutschen Juendfürsorge 1878 bis<br />
1932, Köln 1986, S. 131<br />
19 Polligkeit, Wilhelm: Die Jugendgerichtshilfe in Frankfurt am Main. In: Freudenthal, Berthold(Hg.): Das Jugendgericht<br />
in Frankfurt am Main, Berlin 1912, S. 71<br />
20 Peukert, a.a.O., S. 132<br />
7
Beide einte jedoch das autoritäre Verständnis von <strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> die Hoffnung auf die heilende<br />
Wirkung eines ebensolchen Staates.<br />
Und dieses eigene Verständnis von <strong>Erziehung</strong> wird bekanntermaßen geprägt durch die eigene<br />
Sozialisation. Sämtliche hier genannten Personen entstammen bildungs- oder großbürgerlichen<br />
Verhältnissen. Auf der anderen Seite der Gesellschaft standen die Menschen, um die es<br />
ging: Jugendliche aus Familien, die unter die Räder der Industrialisierung gekommen waren,<br />
häufig Ungelernte, Mittel- <strong>und</strong> Wohnungslose.<br />
Peukert führt aus, wie Jugendfürsorge oft an den Interessen dieser Menschen vorbeiging. 22<br />
Sozialpädagogik in damaligem Verständnis war weniger Beziehungsarbeit <strong>und</strong> Förderung der<br />
Menschenbildung, Eigenständigkeit <strong>und</strong> Eigenverantwortlichkeit des Individuums, sondern<br />
hatte Disziplinierung <strong>und</strong> Anpassung an herrschende Normen <strong>und</strong> Werte zur primären Aufgabe,<br />
auch wenn sich das in Sonntagsreden anders anhören mochte.<br />
Sie wollte ein bürgerlich geprägtes Menschenbild vermitteln, dass den Proletarierkindern fern<br />
<strong>und</strong> fremd war. Die Redewendung „Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!“ aus dem<br />
Erlkönig von Goethe, bringt diese Haltung treffend zum Ausdruck. Und folgerichtig wurde<br />
der Ruf nach dem durchgreifenden Staat je lauter, desto mehr die sozialen Probleme zunahmen.<br />
Anpassung ist auch heute eine Aufgabe von <strong>Erziehung</strong>, nur wurden dam<strong>als</strong> Normen <strong>und</strong><br />
Werte ungleich viel enger <strong>und</strong> rigider ausgelegt. Gehorsam war deshalb oberster <strong>Erziehung</strong>sgr<strong>und</strong>satz.<br />
Es wurde <strong>als</strong> Recht des Kindes verkauft, was in Wirklichkeit <strong>als</strong> Disziplinierung <strong>und</strong> <strong>als</strong> logische<br />
Folge eines unbeschränkten Eingriffsrechtes der <strong>Erziehung</strong>sinstanzen <strong>und</strong> letztlich des<br />
Staates gemeint war.<br />
Hier erkennen wir bereits das Herbeisehnen <strong>und</strong> Herbeischreiben eines autoritären <strong>und</strong> interventionistisches<br />
<strong>Erziehung</strong>sansatzes <strong>als</strong> Instrument eines totalen Staates. Nachvollziehbar ist<br />
diese Haltung insofern, <strong>als</strong> die unruhigen Weimarer Zeiten, die übergroßen sozialen Probleme,<br />
den allseitigen Ruf nach einem starken Staat beförderten.<br />
Wie oben bereits angeführt, haben sich Persönlichkeiten wie Webler <strong>und</strong> Pollikeit ab 1933<br />
zunehmend auf das <strong>Erziehung</strong>s- <strong>und</strong> Fürsorgesystem der Nation<strong>als</strong>ozialisten eingelassen, ja<br />
sogar große Hoffnungen hierauf gesetzt. „Nach langen Jahren tiefer Enttäuschung durchzieht<br />
21 Polligkeit, a.a.O., S. 70<br />
22 Peukert, a.a.O., S. 163 ff.<br />
8
eine Welle neuen Hoffens <strong>und</strong> des Glaubens an eine bessere Zukunft unser Volk“, so Polligkeit<br />
im Mai 1933, kurz nach der Machtergreifung. 23<br />
Führende Nation<strong>als</strong>ozialistische Rechtswissenschaftler wie etwa Wolfgang Siebert, der zusammen<br />
mit Friedrich Schaffstein <strong>und</strong> Franz Wieacker 1941 <strong>als</strong> Teil der „Schriften zum Jugendrecht“<br />
seine „Gr<strong>und</strong>züge des deutschen Jugendrechts“ 24 zum Besten gab, stellten – in<br />
guter Tradition – den <strong>Erziehung</strong>sgedanken ebenfalls ganz oben an. In der Kommentierung<br />
zum neuen JGG 1943 schreibt der Ministerialrat im Reichsjustizministerium Heinz Kümmerlein:<br />
„So ist im nation<strong>als</strong>ozialistischen Jugendstrafrecht <strong>und</strong> damit in dem neuen Reichsjugendgerichtsgesetz<br />
der <strong>Erziehung</strong>sgedanke oberster Gestaltungsgr<strong>und</strong>satz.“ 25<br />
Wie war dieser <strong>Erziehung</strong>sgedanke zu verstehen, wie wurde er in nation<strong>als</strong>ozialistischer Diktion<br />
definiert?<br />
Siebert: „Dieser <strong>Erziehung</strong>sgedanke hat entgegen früheren Auffassungen nicht mehr den einzelnen<br />
jungen Menschen, sein Recht auf <strong>Erziehung</strong> oder seine Wohlfahrt im Auge, sondern er<br />
geht aus von der Aufgabe der deutschen Jugend im ganzen <strong>und</strong> der Persönlichkeit des ihr angehörenden<br />
Jugendlichen. Einer besonderen Hervorhebung bedarf dabei die Verbindung des<br />
<strong>Erziehung</strong>sgedankens mit dem Gedanken der Führung.“ 26<br />
Hier wird ein Gegensatz zu früheren Auffassungen gesehen, der aus meiner Sicht so nicht<br />
besteht. Vielmehr ist von einer kontinuierlichen „Weiterentwicklung“ auszugehen.<br />
Sicher gab es in der Vor-Nazizeit starke liberale jugendbewegte Strömungen <strong>und</strong> entsprechende<br />
Diskussionen auch in der Jugendgerichtsbewegung. Die Oberhand behielten jedoch<br />
stets die autoritären Vorstellungen von <strong>Erziehung</strong>, wie die Ausführungen zu Polligkeit <strong>und</strong><br />
Webler zeigen.<br />
Eine These für den Erfolg des menschenverachtenden Systems der Nation<strong>als</strong>ozialisten ist,<br />
dass dies auch deshalb möglich wurde, weil die Menschen in einer Tradition der Gefügigmachung<br />
<strong>und</strong> des Untertanentums sozialisiert wurden. Und diese Tradition nahm nicht erst 1933<br />
ihren Anfang, sondern schon weit davor. Die Tradition heißt: <strong>Erziehung</strong> zum Gehorsam für<br />
die Zwecke des Staates <strong>und</strong> Ausgrenzung bis zur Ausmerzung derjenigen, die sich diesem<br />
Ziel nicht unterordnen können oder wollen. Das Jugendgerichtswesen war so etwas wie eine<br />
23 Eckhardt, Dieter: Soziale Einrichtungen sind Kinder ihrer Zeit, Frankfurt am Main 1999, S. 116 ff.<br />
24 Siebert, Wolfgang: Gr<strong>und</strong>züge des deutschen Jugendrechts. In: Siebert, Schaffstein, Wieacker(Hg.): Schriften<br />
zum Jugendrecht, Berlin, Leipzig 1941<br />
25 Kümmerlein, Heinz: Reichsjugendgerichtsgesetz vom 6. November 1943, München <strong>und</strong> Berlin 1944, S. 3<br />
26 Siebert, a.a.O., S. 18<br />
9
Speerspitze dieser <strong>Erziehung</strong>spraxis, denn hier kulminierten die gesellschaftlichen Problemfälle.<br />
Der Jugendarrest zum Beispiel, diente der integrierenden <strong>Erziehung</strong>, er sollte dafür sorgen,<br />
dass die jungen Volksgenossen (Hitlerjugend) durch das Einsperren zur Besinnung kamen.<br />
Die Verurteilung zu Jugendlager oder gar die Todesstrafe führten zur Ausgrenzung bis<br />
hin zur Ausmerzung von „Minderwertigen“.<br />
Sicher, die Rassentheorien spielten vor dem Krieg in der Jugendgerichtsbewegung so gut wie<br />
keine Rolle. Das <strong>Erziehung</strong>swesen <strong>und</strong> -verständnis jedoch war geprägt von Prinzipien wie<br />
Unterordnung <strong>und</strong> Anpassung. Brumlik geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er nicht<br />
nur im wihelminischen Kaiserreich dieses Untertanentum verankert sieht, sondern auch in den<br />
Reformbewegungen der Weimarer Republik, denn es „kann inzwischen <strong>als</strong> erwiesen gelten,<br />
dass nicht zuletzt das bündisch-reformpädagogische <strong>Erziehung</strong>swesen in nicht geringem Maße<br />
der Faschisierung Vorschub geleistet hat.“ 27<br />
Der Zusammenbruch des Nation<strong>als</strong>ozialismus brachte kein Ende dieses rigiden <strong>Erziehung</strong>sverständnisses.<br />
Sowohl personell <strong>als</strong>o auch inhaltlich war die Kontinuität gewahrt.<br />
Zwar gab es keine Vernichtungslager mehr, zwar wurde die Todesstrafe abgeschafft – viele<br />
andere Traditionen wurden aber beibehalten.<br />
Der Strafrechtslehrer Schaffstein, der maßgeblich an dem JGG von 1943 mitgewirkt hatte,<br />
blieb weiter in seinem beruflichen Amt, ebenso wie der sogenannte „schreckliche Psychiater“<br />
Villinger. Heinrich Webler <strong>und</strong> Wilhelm Polligkeit wirkten noch lange Jahre <strong>als</strong> führende<br />
Vertreter der Jugendhilfe in Deutschland (siehe deren Vita weiter oben).<br />
Das JGG von 1953 wurde eher marginal novelliert: Jugendarrest, schädliche Neigungen <strong>und</strong><br />
viele andere Erfindungen der „schrecklichen Juristen“ wurden beibehalten, sie wurden gar <strong>als</strong><br />
Fortschritte interpretiert.<br />
Aber auch das dahinter liegende <strong>Erziehung</strong>sverständnis?<br />
Ich möchte hier einen kleinen Ausflug in das Feld der Kleinkindererziehung machen, um an<br />
diesem Beispiel die nahtlose Anknüpfung an die herrschenden <strong>Erziehung</strong>straditionen der Kaiserzeit<br />
<strong>und</strong> des sogenannten „Dritten Reiches“ zu demonstrieren.<br />
In dem 2007 erschienenen Band „Vom Missbrauch der Disziplin“ referiert der Psychologe<br />
Claus Koch über die <strong>Erziehung</strong> im Nation<strong>als</strong>ozialismus <strong>und</strong> ihre Bezüge zur 68er-Generation.<br />
Er berichtet über die erfolgreichste Autorin für <strong>Erziehung</strong>sratgeber in der Nazi-Zeit, Johanna<br />
27 Brumlik, Micha: Durch Unterwerfung zur Freiheit. Bernhard Buebs reaktionäre Vergangenheitsbewältigung.<br />
In: Brumlik, Micha: Vom Missbrauch der <strong>Erziehung</strong>. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb, Weinheim<br />
<strong>und</strong> Basel 2007, S. 57 f.<br />
10
Haarer. Deren Buch „Die deutsche Mutter <strong>und</strong> ihr erstes Kind“ wurde bis Kriegsende in einer<br />
beachtlichen Stückzahl von 690.000 Exemplaren verkauft <strong>und</strong> war damit Bestseller.<br />
Zucht, unbedingter Gehorsam <strong>und</strong> bedingungslose Unterwerfung wurden darin zu obersten<br />
<strong>Erziehung</strong>sprinzipien erhoben, um das ungebändigte Kind zu einem wertvollen Mitglied der<br />
Volksgemeinschaft zu machen. „Eindeutiges <strong>Erziehung</strong>sziel ist hier die Vorbereitung schon<br />
des Kleinkindes auf die Unterwerfung unter die NS-Gemeinschaft.“ 28<br />
Die Bestseller-Autorin Haarer bringt das etwas bereinigte Buch 1949 unter dem Titel „Die<br />
Mutter <strong>und</strong> ihr erstes Kind“ (später: „Unsere Schulkinder“) aberm<strong>als</strong> heraus, <strong>und</strong> es wird in<br />
den Folgjahren wieder zum Verkaufsschlager.<br />
Als <strong>Erziehung</strong>sziel wird hier ausgegeben: „Das Kernziel aller <strong>Erziehung</strong> ist die <strong>Erziehung</strong><br />
zum Gehorsam. Die Aufstellung der schönsten <strong>Erziehung</strong>sstile nützt nichts, wenn unsere Kinder<br />
nicht gehorchen.“ 29 Das Buch wurde bis in die 80er Jahre verkauft. Strafe wurde hier<br />
ausdrücklich <strong>als</strong> ganz gr<strong>und</strong>legendes <strong>Erziehung</strong>smittel gepriesen, ohne die es nicht ginge.<br />
Die Kontinuität bestand darin, dass auch hier wieder der junge Mensch mit Gewalt zur Raison,<br />
zur Unterwerfung gebracht werden sollte.<br />
Der <strong>Erziehung</strong>sansatz des Jugendgerichtsgesetzes unterliegt bis heute dieser Gehorsamkeits-<br />
Diktion. Begrifflichkeiten aus der schwarzen Pädagogik wie „Zuchtmittel“ (§ 15) <strong>und</strong> „schädliche<br />
Neigungen“ (§ 17) machen das deutlich. Doch mir scheint, es handelt sich dabei nur<br />
noch um Relikte einer vergangenen Zeit. Genauer gesagt: ich hoffe darauf.<br />
Der wirkliche Paradigmenwechsel hinsichtlich des <strong>Erziehung</strong>sverständnisses fand erst<br />
zwanzig bis dreißig Jahre nach Kriegsende in Deutschland statt. Erst die 70er Jahre des vorigen<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts brachten gr<strong>und</strong>legende kriminologische Diskussionen auf breiter Front.<br />
Erstm<strong>als</strong> setzten sich kriminologische Erkenntnisse durch, die einen völlig neuen Umgang mit<br />
Jugendkriminalität zur Folge hatten.<br />
Zwar hatte 100 Jahre vorher der französische Soziologe Émile Durkheim(1858-1917) 30 schon<br />
von der Normalität der Kriminalität geschrieben, aber erst jetzt schien sich diese Erkenntnis in<br />
der Kriminologie allgemein durchzusetzen.<br />
28 Koch, Claus: <strong>Erziehung</strong> im Nation<strong>als</strong>ozialismus, 1968 <strong>und</strong> der erneute Ruf nach Disziplin <strong>und</strong> Unterordnung.<br />
In: Brumlik, Micha(Hg), a.a.O., S. 105<br />
29 Zit. bei Koch, Claus, a.a.O., S. 108 f.<br />
30 In seinem Werk "Regeln der sozialen Methode" begründet Durkheim (zuerst erschienen 1895) die Normalitätsthese<br />
damit, dass Kriminalität <strong>und</strong> Abweichung in jeder Gesellschaft zu finden seien.<br />
11
Das Wissen über die Episodenhaftigkeit von Kriminalität <strong>und</strong> die Erkenntnis, dass staatliche<br />
Interventionen – sowohl der Jugendhilfe <strong>als</strong> auch der Justiz – in der Mehrzahl der Fälle nicht<br />
erforderlich sind oder ins Leere laufen, befeuerten eine breite Diskussion über Diversion <strong>und</strong><br />
führten zu einem langfristigen Anstieg der Diversionsverfahren. So werden heute mehr <strong>als</strong><br />
zwei Drittel der Strafverfahren mit oder ohne Weisungen oder Auflagen eingestellt.<br />
Moderne Prognoseforschung <strong>und</strong> nüchterne Analysen machen es möglich, zielgenauer bei<br />
solchen Jugendlichen zu intervenieren, wo pädagogische Hilfen Erfolg versprechen oder Strafen<br />
(Jugendarrest oder Jugendstrafe) <strong>als</strong> notwendig erachtet werden.<br />
Die <strong>Erziehung</strong> ist entideologisiert worden. <strong>Erziehung</strong> im Jugendgerichtsverfahren hat nach<br />
heutigem Verständnis das Ziel, die soziale Integration zu fördern <strong>und</strong> Straftaten zu vermeiden,<br />
so auch das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Jugendstrafvollzug vom<br />
Mai 2006.<br />
Die Jugendhilfe ist mit der Verabschiedung des SGB VIII (Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfegesetz)<br />
1990 ein Stück auf Distanz zur strafenden Justiz gegangen. Für das Sanktionsbedürfnis der<br />
Justiz lässt sich die Jugendhilfe nicht mehr so leicht instrumentalisieren. So kann das Gericht<br />
ohne Zustimmung des Jugendamtes nicht mehr über die Anordnung von <strong>Erziehung</strong>shilfen<br />
entscheiden (§ 36a Abs. 1 SGB VIII).<br />
Wie unterschiedlich die beiden Ansätze sind, lässt sich an zwei Beispielen zeigen:<br />
dem Vollzug des „Zuchtmittels“ Jugendarrest (§ 16 JGG) <strong>als</strong> Strafsanktion einerseits <strong>und</strong> dem<br />
Sozialen Trainingskurs <strong>als</strong> erzieherische Hilfe andererseits.<br />
Im Arrest wird der Jugendliche in eine Zelle – natürlich gegen seinen Willen – eingeschlossen.<br />
Er hat keine Entscheidungsfreiheit, der Tagesablauf ist genauestens vorgegeben, der Inhaftierte<br />
vollzieht das nach, was ihm aufgetragen wird. Oft gibt es so etwas wie Arbeitstherapie<br />
mit der Absicht etwas erzieherisch Positives zu vermitteln, aber auch sie unterliegt der<br />
rigiden Tagesstruktur <strong>und</strong> dem erzwungenen Gesamtrahmen. Das Personal ist in erster Linie<br />
zu Überwachungs- <strong>und</strong> Kontrollzwecken eingestellt, erzieherisch sinnvolle Aktivitäten sind<br />
eher schmückendes Beiwerk.<br />
Der Soziale Trainingskurs ist nach pädagogischen Gesichtpunkten konzipiert. Sozialpädagogen<br />
haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Jugendliche sich mit seiner Tat auseinandersetzt<br />
<strong>und</strong> sie reflektiert. Das geschieht in Gesprächen, Rollenspielen, im Kontext handwerklicher<br />
Arbeiten <strong>und</strong> sonstigen Aktivitäten. Oberstes Ziel ist die Förderung der Eigenmotivation<br />
der Jugendlichen, die Stärkung ihrer Persönlichkeit. Der Rahmen ist offen, der Jugendliche<br />
kann selbst entscheiden, ob er an dem – dann aber verbindlichen - Programm teilnimmt oder<br />
nicht.<br />
12
Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, <strong>Erziehung</strong> sei immer gut, Strafe immer<br />
schlecht, keineswegs. Genauso wie es furchtbare Juristen gab <strong>und</strong> gibt, so gab <strong>und</strong> gibt es<br />
furchtbare Pädagogen.<br />
Es geht vielmehr um die Unterscheidbarkeit, die Differenzierung <strong>und</strong> darum, dass sich die<br />
Akteure im Jugendgerichtsverfahren ihrer Motive bewusst werden. Und es ist gut <strong>und</strong> wichtig,<br />
dass <strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> Strafe rechtsstaatlich kontrolliert <strong>und</strong> beschränkt werden.<br />
<strong>Erziehung</strong> heute, zum Glück, ist seiner ideologischen Macht beraubt.<br />
<strong>Erziehung</strong> ist aber bis heute eine Gefahr, wenn sie gewalttätig daherkommt. Das Strafverfahren<br />
gegen junge Menschen ist insofern gefährdet.<br />
Relikte eines gewalttätigen <strong>Erziehung</strong>sverständnisses haben wir bis heute auch im Jugendgerichtsgesetz,<br />
wie das angesprochene Zuchtmittel Jugendarrest zeigt. Die Logik des Paragrafen<br />
17 JGG lautet: Wenn Zuchtmittel zur <strong>Erziehung</strong> nicht ausreichen, ist wegen schädlicher Neigungen<br />
Jugendstrafe zu verhängen. Hier kommt das alte Denken am deutlichsten zum Ausdruck:<br />
Wer nicht hören will muss fühlen.<br />
Wohltuend, dass das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht mit seiner Entscheidung von 2006 auf den<br />
Begriff <strong>Erziehung</strong> verzichtet hat <strong>und</strong> stattdessen konkrete <strong>und</strong> rationale Anliegen des Jugendvollzuges<br />
nennt: menschenwürdige <strong>und</strong> jugendgemäße Unterbringung, Bildung, Ausbildung<br />
<strong>und</strong> Entlassungsvorbereitung.<br />
Das Jugendgerichtsverfahren kennzeichnet <strong>als</strong>o nach wie vor Verschränkungen von <strong>Erziehung</strong><br />
<strong>und</strong> Strafe. „<strong>Schlagstock</strong>“ <strong>und</strong> „<strong>Gehhilfe</strong>n“ sind bis heute die Komponenten des JGG.<br />
Die Entscheidung über die Gewichtungen unterliegt einem Aushandlungsprozess der Beteiligten.<br />
Über Strafe, oder auch Auflagen <strong>und</strong> „Zuchtmittel“ kann das Gericht alleine entscheiden.<br />
Soll <strong>und</strong> will es jedoch erzieherische Mittel einsetzen, ist die Jugendhilfe am Zug. Sie wiederum<br />
verlangt das Einverständnis des Betroffenen.<br />
Die schon vor 100 Jahren beklagte heillose <strong>und</strong> ideologisch aufgeladene Mixtur beider Komponenten,<br />
<strong>und</strong> damit die permanente Verwechslung, die Nichtunterscheidbarkeit, die Unterordnung<br />
der <strong>Erziehung</strong> unter die Strafe, sind zu einem guten Teil Dank der Neuausrichtung<br />
seit den 70er Jahren überw<strong>und</strong>en. Verbal begegnet sie uns noch dauernd, aber mehr <strong>als</strong> diffuse<br />
Alltagstheorie der Beteiligten im Jugendgerichtsverfahren. Der <strong>Erziehung</strong>sgedanke ist heute<br />
ein unbestimmter, alles <strong>und</strong> nichts meinender Hilfsbegriff, der verschleiert, verschlimmert<br />
oder abwiegelt, je nach Situation <strong>und</strong> Akteur. Unter dem <strong>Erziehung</strong>sbegriff subsumieren sich<br />
nach wie vor Hilfe <strong>und</strong> Strafe.<br />
13
Das aber der <strong>Erziehung</strong>sgedanke heute seine ideologische Macht eingebüßt hat, mag auch<br />
daran liegen, dass wir infolge der Erfahrungen mit einigen linken <strong>und</strong> rechten Diktaturen in<br />
den vergangenen 100 Jahren den Glauben an die Macht der guten <strong>Erziehung</strong> durch staatliche<br />
Institutionen verloren haben (obwohl wir uns immer wieder danach sehnen). Der „gute“<br />
Mensch wird weniger durch Erzieher(innen) erzogen, sondern mehr durch die sozialen Verhältnisse.<br />
„Das Sein bestimmt das Bewusstsein.“ Da hatte Karl Marx doch wohl recht. Der<br />
Wohlstand dürfte bedeutsamer für den Rückgang der Kriminalitätsbelastung sein, <strong>als</strong> <strong>Erziehung</strong><br />
<strong>und</strong> Strafe. Auch das lehren uns die letzten 100 Jahre.<br />
Literatur:<br />
Achinger, Hans: Wilhelm Merton in seiner Zeit, Frankfurt am Main 1965<br />
Brumlik, Micha: Vom Missbrauch der <strong>Erziehung</strong>. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard<br />
Bueb, Weinheim <strong>und</strong> Basel 2007<br />
Eckhardt, Dieter: Soziale Einrichtungen sind Kinder ihrer Zeit, Frankfurt am Main 1999<br />
Freudenthal, Berthold(Hg.): Das Jugendgericht in Frankfurt am Main, Berlin 1912<br />
Hubert, Harry: Jugendfürsorge, Jugendwohlfahrt <strong>und</strong> Jugendhilfe. Zur Geschichte des Jugendamtes<br />
der Stadt Frankfurt am Main. Band 1: Von den Anfängen bis 1945, Frankfurt am<br />
Main 2005<br />
Jenner, Harald: Ein Jahrh<strong>und</strong>ert Jugendhilfe <strong>und</strong> Familienrecht. Vom Archiv deutscher Berufsvormünder<br />
zum Deutschen Institut für Jugendhilfe <strong>und</strong> Familienrecht (DIJuF) e.V. –<br />
1906-2006, Heidelberg 2006<br />
Kant, Immanuel: Über die <strong>Erziehung</strong>, München 1997<br />
Miller, Alice: Am Anfang war <strong>Erziehung</strong>, Frankfurt am Main 1983<br />
Müller, Ingo: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München<br />
1987<br />
Peukert, Detlev: Grenzen der Sozialdisziplinierung. Aufstieg <strong>und</strong> Krise der deutschen Jugendfürsorge<br />
1878 bis 1932, Köln 1986<br />
Polligkeit, Scherpner, Webler(Hg.): Fürsorge <strong>als</strong> persönliche Hilfe. Festgabe für Prof. Dr.<br />
Christian Jasper Klumker zum 60. Geburtstag am 22.12.1928, Berlin 1929<br />
Safranski, Rüdiger: Romantik. Eine deutsche Affäre, 2007<br />
Siebert, Wolfgang: Gr<strong>und</strong>züge des deutschen Jugendrechts. In: Siebert, Schaffstein, Wieacker(Hg.):<br />
Schriften zum Jugendrecht, Berlin, Leipzig 1941<br />
14
Simonsohn, Berthold(Hg.): Jugendkriminalität, Strafjustiz <strong>und</strong> Sozialpädagogik, Frankfurt am<br />
Main, 1969<br />
Walter, Michael(Hg.): Beiträge zur <strong>Erziehung</strong> im Jugendkriminalrecht, Köln u.a. 1989<br />
Webler Heinrich: Deutsches Jugendrecht, nach dem Stande vom 1. Juli 1941, Berlin 1941<br />
Weyel, Frank Heiner: Im Jugendstrafrecht brauchen wir weder <strong>Erziehung</strong> noch Verschärfung.<br />
Das JGG, die <strong>DVJJ</strong> <strong>und</strong> der <strong>Erziehung</strong>sgedanke. In: ZJJ 4/2003, S. 406 ff.<br />
15