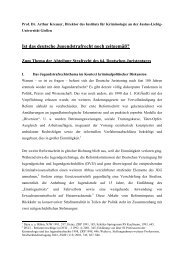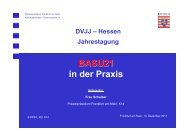Beitrag von Holger Gerhard - DVJJ-Hessen
Beitrag von Holger Gerhard - DVJJ-Hessen
Beitrag von Holger Gerhard - DVJJ-Hessen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das `Haus des Jugendrechts´ - Wohnsitz kriminalpräventiver Ansätze oder<br />
Unterschlupf repressiven Vorgehens?<br />
<strong>Holger</strong> <strong>Gerhard</strong><br />
Zur Beseitigung des eigens angerichteten Trümmerhaufens, den die hessische<br />
Landtagswahl 2008 bei der früheren und nunmehr geschäftsführenden<br />
Landesregierung <strong>von</strong> <strong>Hessen</strong> hinterlassen hat, hat der hessische Justizminister Jürgen<br />
Banzer im Rahmen einer Pressemitteilung vom 07.03.2008 (Keine rechtsfreien, sondern<br />
nur angstfreie Räume) das künftige Handlungskonzept zur Senkung der<br />
Jugendkriminalität vorgestellt. 1 In dem aus den drei Säulen: Prävention,<br />
Strafverfolgung, nebst Strafvollstreckung sowie Opferschutz bestehendem Konzept,<br />
findet sich unter Punkt zwei der beabsichtigten Sofortmaßnahmen die Aufnahme <strong>von</strong><br />
konkreten Planungen für ein modellhaft ausgerichtetes `Haus des Jugendrechts´ in<br />
Frankfurt am Main. Mit Hilfe des evaluierten Modellprojektes des Stuttgarter `Haus des<br />
Jugendrechts´ in Bad Cannstadt befasst sich der folgende <strong>Beitrag</strong> mit den zu<br />
erwartenden Auswirkungen eines solchen Konzeptes, insbesondere im Hinblick auf<br />
die im Jugendstrafrecht agierende Jugendhilfe und ihrer Klienten.<br />
Jugendkriminalität stagniert, sind neue Konzepte notwendig?<br />
Mit dem Ziel, der „noch effektiveren Bekämpfung <strong>von</strong> Jugendkriminalität“, hat der<br />
hessische Justizminister Jürgen Banzer in der Pressemitteilung vom 07.03.2008: „Keine<br />
rechtsfreien, sondern nur angstfreie Räume“ das geplante Handlungskonzept zur<br />
Senkung der Jugendkriminalität erklärt. 2 Eine der „tragenden Säulen des<br />
gesamtheitlichen Konzepts“ des Ministers ist die Schaffung <strong>von</strong> Häusern des<br />
Jugendrechts. „Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der<br />
Jugendgerichtshilfe, des allgemeinen sozialen Dienstes, der Jugendämter und die<br />
Jugendsachbearbeiter werden unter einem Dach zusammenarbeiten, um schnell<br />
und konsequent auf jugendliche Straftäter reagieren zu können. Durch die enge<br />
Zusammenarbeit soll eine Verfahrensbeschleunigung erreicht und die Möglichkeit<br />
geschaffen werden, intensiv und individuell auf delinquentes Verhalten <strong>von</strong><br />
Jugendlichen reagieren zu können. Daneben wurde mit den konkreten Planungen<br />
für ein `Haus des Jugendrechts´ in Frankfurt am Main begonnen, das so schnell wie<br />
möglich realisiert werden soll.“ 3 Überraschend ist dies zumindest für die in Frankfurt<br />
arbeitenden Praktikerinnen und Praktiker im Bereich der Jugendstraffälligenhilfe und<br />
Jugendjustiz gewesen.<br />
Festzuhaltende Ausgangslage in dem Bereich <strong>von</strong> Jugendkriminalität ist bundesweit,<br />
dass „weder (…) Jugendkriminalität insgesamt noch (…) die Gewaltkriminalität<br />
junger Menschen in den letzten Jahren dramatisch gestiegen“ ist. Vielmehr ist „eine<br />
weitgehende Konstanz oder gar einen Rückgang der Delinquenzbelastung, und<br />
zwar auch im Gewaltbereich“ 4 , feststellbar. Auch wenn scheinbar Unbelehrbare<br />
1<br />
Nachfolgende Erörterungen vgl. Pressemitteilung desHessischen Ministerium der Justiz vom 07.03.2008<br />
2 Pressemitteilung desHessischen Ministerium der Justiz vom 07.03.2008<br />
3 Pressemitteilung desHessischen Ministerium der Justiz vom 07.03.2008<br />
4 Heinz (2008), S.88. Siehe auch <strong>DVJJ</strong>-Erklärung vom 11. Januar 2008: Für ein rationales Strafrecht (2008),<br />
S. 96. `Die jetzige Bundesregierung hat in ihrem Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht <strong>von</strong> 2006<br />
ausgeführt: „Gewaltkriminalität ist ein qualitatives, kein quantitatives Problem der polizeilich registrierten<br />
Kriminalität; auf deren schwere Formen entfallen derzeit 3,3%, darunter zu über zwei Dritteln gefährliche<br />
und schwere Körperverletzung. Innerhalb der Gewaltkriminalität entfallen auf vorsätzliche Tötungsdelikte<br />
etwas mehr als 1%. ... Die schwersten Formen der Gewaltdelikte – Mord und Totschlag – sind seit Anfang<br />
1
auch nach der hessischen Landtagswahl anderes propagieren 5 , so ist der<br />
Presseinformation des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom<br />
17.01.2008 zu entnehmen, „dass der Anteil der Kinder an den Tatverdächtigen<br />
insgesamt mit 3,6 Prozent auf dem Vorjahresniveau blieb. Auch der Anteil der<br />
Jugendlichen und Heranwachsenden habe sich nur unwesentlich verändert, <strong>von</strong><br />
10,5 Prozent auf 10,7 Prozent bei den Jugendlichen und <strong>von</strong> 9,0 Prozent auf 9,1<br />
Prozent bei den Heranwachsenden. Bei der Gewaltkriminalität ist die Anzahl der<br />
tatverdächtigen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden im Wesentlichen<br />
gleich geblieben. (…) Mit diesen 20,6 Prozent lag <strong>Hessen</strong> im Übrigen bereits im Jahr<br />
2006 unter dem Bundesdurchschnitt.“ 6<br />
Dennoch gilt es die erneute Fokussierung auf das Thema Jugendstrafrecht zu nutzen,<br />
mögliche Novellierungen und Verbesserungen für das Arbeitsfeld zu entwickeln und<br />
in die Praxis umzusetzen. Die Einrichtung eines `Haus des Jugendrechts´ strebt dabei<br />
als primäre Zielsetzungen eine Optimierung in den Bereichen der Effektivität bei der<br />
Bekämpfung der Jugendkriminalität/-delinquenz und der behördenübergreifenden<br />
Zusammenarbeit an. 7 Absicht dieses Projektes ist u.a. die räumliche<br />
Zusammenfassung der Institutionen, die sich mit straffällig geworden jungen<br />
Menschen befassen, konkret sind das Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft,<br />
Jugendgerichtshilfe und freie Träger der sozialen Arbeit. Die dort angebotene Arbeit<br />
soll einer „raschen und ganzheitlichen Reaktion“ auf Straftaten junger Menschen<br />
dienen und zudem den betroffenen jungen Menschen „notwendige<br />
Hilfemaßnahmen“ anbieten. 8<br />
Konzeptionell schließt das Stuttgarter Modell des `Haus des Jugendrechts´<br />
nachfolgende Zielvereinbarungen ein:<br />
„1. Optimierung der Effektivität bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität/-<br />
delinquenz;<br />
2. Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit durch Unterbringung<br />
aller Beteiligten in einem Gebäude (…);<br />
3. Beschleunigung staatlicher und kommunaler Reaktionen auf Straftaten junger<br />
Menschen;<br />
4. rasches und zeitnahes Reagieren auf normwidriges Verhalten, bereits bei der<br />
ersten Verfehlung;<br />
5. langfristige Reduzierung der Jugendkriminalität/-delinquenz.“ 9<br />
Die in dem Konzept für das `Haus des Jugendrechts´ vorgesehene beschleunigte<br />
Einschaltung der Jugendgerichtshilfe (JGH) durch die Staatsanwaltschaft (StA)<br />
der 1970er Jahre rückläufig. Körperverletzungsdelikte haben dagegen – in quantitativ-statistischer<br />
Betrachtung – zugenommen. In langfristiger Betrachtung hat auch die Zahl polizeilich bekannt<br />
gewordener Raubdelikte zugenommen: Seit 1997 sind hier die Zahlen rückläufig, in den letzten Jahren<br />
blieben sie weitgehend konstant. Insgesamt gesehen gehen die Täter-Opfer-Konstellationen bei diesen<br />
Delikten zu Lasten <strong>von</strong> jungen Menschen. Opfer <strong>von</strong> Gewalt Erwachsener sind häufig junge Menschen,<br />
Opfer <strong>von</strong> Gewalt junger Menschen sind in der Regel Gleichaltrige. (...) Unter den Tatverdächtigen sind<br />
junge Menschen überproportional vertreten. Junge Menschen weisen allerdings in jeder Gesellschaft<br />
und zu allen Zeiten eine deutlich höhere Belastung mit registrierter Kriminalität auf als Erwachsene“`.<br />
5<br />
So der hessische Landtagsabgeordnete Lenhart (CDU): „Die besorgniserregende Entwicklung in der<br />
Jugenddelinquenz wird verdeutlicht durch die seit Jahren steigenden Tatverdächtigenzahlen,<br />
besonders im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität. Noch alarmierender als die allgemeine<br />
Entwicklung ist der überproportionale Anstieg der Gewaltkriminalität bei Kindern und Jugendlichen.“<br />
6<br />
Presseinformation des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 17.01.2008<br />
7<br />
vgl. Feuerhelm (2003), S. 61<br />
8<br />
vgl. Feuerhelm (2003), S. 59<br />
9<br />
Feuerhelm (2003), S. 59 f.<br />
2
entspricht der Vorgabe nach § 38 Abs. 3 JGG. 10 Ein solches Vorgehen wäre<br />
wünschenswert und ist meistens der Sachlage angemessen. Es wird in Frankfurt im<br />
Rahmen der vorhandenen Rahmenbedingungen in der Regel auch praktiziert.<br />
Soweit Verzögerungen festgestellt werden, liegen die Gründe wohl eher in einer<br />
unzureichenden Stellenbesetzung innerhalb der Jugendgerichtsbarkeit und nicht in<br />
der mangelnden Kooperation der im Jugendstrafrecht (zusammen-)arbeitenden<br />
Institutionen.<br />
Hand in Hand im Jugendstrafverfahren: Gemeinsames Handeln im Interesse aller<br />
Beteiligten?<br />
-Vertrauen ist gut, ist Kontrolle wirklich besser?-<br />
Das angestrebte Ziel der optimierten überbehördlichen Zusammenarbeit soll in dem<br />
Model des `Haus des Jugendrechts´ durch die gemeinsame Unterbringung aller<br />
Beteiligten in einem Gebäude ermöglicht werden. Bereits der geringe Arbeitsanteil<br />
<strong>von</strong> nur 11%, den die Jugendhilfe im Stuttgarter Modellprojekt prozentual <strong>von</strong> ihrer<br />
Gesamtarbeitszeit für das Projekt aufgewendet hat 11 , deutet auf die marginale<br />
Einbindung der Jugendhilfe innerhalb des Projektes hin. Die im Vergleich proportional<br />
wesentlich höhere Arbeitseinbindung <strong>von</strong> Polizei (55%) und StA (67 %) an dem<br />
Projekt 12 lässt zugleich den arbeitsinhaltlichen Schwerpunkt des Projektes erahnen.<br />
Bedenklich oder zumindest zu bedenken ist bei der geplanten engen und<br />
behördenübergreifenden Zusammenarbeit die anscheinende und für den<br />
Betroffenen nicht mehr eindeutig wahrzunehmende Trennung der Organe der<br />
Jugendhilfe und des Jugendstrafrechts sowie die augenscheinliche Vermischung der<br />
originären und unterschiedlichen Arbeitsaufträge.<br />
Gerade im Bereich der Jugend(straffälligen)hilfe lassen sich schon jetzt durch die<br />
wahrzunehmende polizeiliche Offensive in diesem Bereich immer mehr<br />
Überschneidungen des Handlungsfeldes der Polizei mit dem Aufgabengebiet der<br />
Jugendsozialarbeit wahrnehmen. 13 Zu verzeichnen ist an solchen Überschneidungen,<br />
eine nicht mehr an dem Bereich der primären Prävention orientierte Sozialarbeit,<br />
sondern eine Verstärkung der sozialen Kontrolle unter Leitung der Polizei. Es gilt eine<br />
inhaltliche Prüfung des jeweiligen Präventionsbegriffes dahingehend vorzunehmen,<br />
ob es mit der Begrifflichkeit einer „effizienten Förderung in der Jugendhilfe und um<br />
Begrenzung kriminalisierender Risiken“ geht oder der „strafrechtliche Blick“ im<br />
Vordergrund steht. 14 Dabei wird allgemein im Umgang mit straffällig Auffälligen das<br />
selektive Vorgehen sozialer Instanzen kritisiert, welches die Gefahren <strong>von</strong><br />
Stigmatisierungen und Zuschreibungen in sich birgt und gegenläufig zum<br />
Förderprinzip des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zusehen ist. Das Angebot der<br />
Jugendhilfe muss als eine die Familie ergänzende Förderung verstanden werden, die<br />
(Straf-)Justiz hingegen ist für die Strafverfolgung zuständig. 15<br />
Eine Zugriffsbarriere zwischen den Kooperationspartnern Jugendhilfe und<br />
Jugendgerichtsbarkeit stellt zudem der Datenschutz des Kinder- und<br />
Jugendhilfegesetztes dar. „Am Schnittpunkt zwischen Jugendhilfe und Justiz muss der<br />
Schutz personenbezogener Daten besonders sorgfältig gehandhabt werden, weil<br />
durch das Agieren mehrerer Berufsgruppen verschiedenartige Interessen<br />
10<br />
„Im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die Jugendgerichtshilfe heranzuziehen. Dies<br />
soll so früh wie möglich geschehen.“<br />
11 vgl. Feuerhelm (2003), S. 84<br />
12 vgl. Feuerhelm (2003), S. 84<br />
13<br />
nachfolgende Erörterungen vgl. Plewig (2005), S. 164 f.<br />
14 vgl. Plewig (2005), S. 165<br />
15 vgl. Plewig (2005), S. 165<br />
3
aufeinander treffen. Grundsätzlich dürfen Informationen nur unter Mitwirkung des<br />
betroffenen Jugendlichen und gegebenfalls seiner Personensorgeberechtigten<br />
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, und nur soweit dies zur Erfüllung des<br />
jeweiligen Auftrags notwendig ist.“ 16 Hinsichtlich des Arbeitsauftrages der Jugendhilfe<br />
im Strafverfahren gilt: die Jugendgerichtshilfe ist ein Fachteam der Jugendhilfe, nicht<br />
der Justiz. 17 Ihren primären Arbeitsauftrag erhält die Jugendgerichtshilfe, als Teil der<br />
Jugendhilfe, aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, welches auch die<br />
fachliche und inhaltliche Ausgestaltung der JGH regelt. Ziel der Jugend(gerichts)hilfe<br />
ist die Förderung und Sicherstellung einer kindeswohlgemäßen Erziehung (i.S.d. § 1<br />
SGB VIII). 18 Dabei sind stets die im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgeschriebenen<br />
Voraussetzungen zu wahren, nämlich unter anderem Freiwilligkeit und Mitwirkung der<br />
betroffenen jungen Menschen und deren Sorgeberechtigten. Repressive und (straf-<br />
)sühnende Momente in der Erziehung schließt das Kinder- und Jugendhilfegesetz<br />
nicht nur aus, sondern versucht gerade diesen mit den Mitteln der Jugendhilfe<br />
entgegenzuwirken. Die JGH hat „die sozialpädagogische Fachkompetenz vor<br />
Gericht zu vertreten, nicht die strafrechtliche, und die Polizei (…)“ hat „in der<br />
Sachaufklärung zu unterstützen. Diese Eigenständigkeit (…) geschieht nur auf<br />
Augenhöhe und die Kooperation sollte ohne Zwangsharmonisierung stattfinden.“ 19<br />
Ist eine behördenübergreifende Zusammenarbeit prinzipiell machbar und unter<br />
gewissen Voraussetzungen wünschenswert, so muss diese, neben der<br />
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Voraussetzungen, vor allem für den<br />
betroffenen Adressaten eine klar nachvollziehbare und transparente Unterscheidung<br />
der Arbeitsweise der einzelnen Institutionen aufweisen, damit sich der Betroffene<br />
darauf einlassen kann. Zweifel diesbezüglich bestehen schon aufgrund der<br />
institutionellen Dichte, sowohl im räumlichen als auch inhaltlichen Sinne,<br />
beispielsweise dann, wenn die Jugendhilfe zu Gesprächen mit dem Betroffenen bei<br />
der StA oder Polizei hinzugezogen wird.<br />
In wieweit dieses klar getrennte Rollenverständnis aufgrund der regelmäßig<br />
stattfindenden und behördenübergreifenden Fallkonferenzen im `Haus des<br />
Jugendrechts´ und der fallübergreifenden Zusammenarbeit bei den<br />
multiprofessionellen Mitarbeiter jeweils Berücksichtigung gefunden hat, bleibt offen.<br />
Die Fallkonferenzen sind dabei als zentraler Ort des inhaltlichen Austausches zum<br />
Zwecke einer zeitnahen Abstimmung der unterschiedlichen Institutionen<br />
konzeptioniert. 20 Der Hinweis darauf, dass bei der Installierung der Integrierten<br />
Kriminalstatistik der Abgleich, ob die betreffende Person bereits bekannt ist, anhand<br />
einer Namensliste durch die Polizei dahingehend geändert werden müsse, dass kein<br />
Rückschluss auf den Klarnamen mehr erfolgen kann 21 , bietet hinsichtlich<br />
datenschutzrechtlicher Voraussetzungen zumindest Platz für Spekulationen.<br />
Kriminalitätsprävention durch ein rasches und zeitnahes Handeln, generell ein<br />
sinnvolles Konzept?<br />
16<br />
<strong>DVJJ</strong>-Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendgerichtshilfe (2003), S.12<br />
17<br />
Dies betonte der Gesetzgeber mit der Schaffung des Kinder- und Jugendhilfegesetzt (SGB VIII) <strong>von</strong><br />
1990, indem er die fachliche Verortung der Jugendgerichtshilfe klar und unmissverständlich durch den<br />
Verweis auf die Jugendhilfe im Strafverfahren hervorgehoben hat; vgl. <strong>DVJJ</strong>-Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
Jugendgerichtshilfe (2003), S.7<br />
18<br />
Um dem im Jugendstrafrecht festgelegten Erziehungsprimat nachkommen und möglichst den<br />
erzieherischen Bedarf entsprechende Reaktionen finden zu können, bringt die Jugendgerichtshilfe die<br />
dafür notwendigen Erkenntnisse ein und zeigt darüber hinaus angemessene Leistungen der Jugendhilfe<br />
auf; vgl. § 52 SGB VIII, § 38 JGG, § 71ff. JGG<br />
19<br />
Breymann in: Förster (2007), S. 322<br />
20<br />
vgl. Feuerhelm (2003), S. 83<br />
21<br />
vgl. Feuerhelm (2003), S. 85 f.<br />
4
Die geplante Konzentration auch auf Ersttäter, durch das rasche und zeitnahe<br />
Reagieren auf normwidriges Verhalten bereits bei der ersten Verfehlung 22 , erscheint,<br />
insbesondere unter Beachtung des Normalitätskonzeptes 23 und den aktuellen<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen über Jugendkriminalität, ein konzeptioneller und<br />
didaktischer Programmfehler des Projektes zu sein, der sich mit aktuellen<br />
kriminalistischen Befunden nicht deckt und das Ziel der Legalbewährung nicht zu<br />
erfüllen mag, sondern eher der Stigmatisierung Vorschub leistet. Denn, „je früher und<br />
je konsequenter auf einen bestimmten Delikttyp strafend reagiert wird, desto größer<br />
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die kriminelle Karriere verlängert wird.“ 24 Ein<br />
frühzeitiges Intervenieren erscheint bei dieser Gruppe nicht angebracht. 25<br />
Wissenschaftliche Erkenntnis ist, dass in der Regel das delinquente Verhalten junger<br />
Menschen mit zunehmender Reife und zunehmendem Alter <strong>von</strong> selbst endet und<br />
strafrechtliche Sanktionen dabei keine feststellbare Rolle spielen. 26 Vielmehr wird der<br />
sogenannten Spontanbewährung ein gelungener Übergang des jungen Menschens<br />
in die Erwachsenenwelt zugesprochen. Die Übernahme einer gefestigten Ich-<br />
Identität, eines gefestigten Normen- und Wertesystems, der Eintritt in den Beruf und<br />
die Bindung an einen festen Lebenspartner sind dabei für den Ausstieg aus<br />
kriminellen Verhaltensweisen junger Menschen <strong>von</strong> Bedeutung. Es besteht kein Anlass<br />
dazu, entwicklungsbedingte, meist periphere und episodenhafte deviante<br />
Auffälligkeiten junger Menschen zu einem Problem der inneren Sicherheit zu<br />
machen, gerade unter Berücksichtigung oben genannter Stagnation delinquenten<br />
in Erscheinungtretens junger Menschen.<br />
Zu bedauern ist, dass aufgrund des befristeten Evaluationszeitraumes des Stuttgarter<br />
Projektes <strong>von</strong> 1999 bis 2002, bisher keine validen Aussagen über das übergestellte Ziel<br />
des Projektes, der langfristigen Reduzierung der Jugendkriminalität/-delinquenz 27 ,<br />
vorliegen und dies trotz einer möglichen wissenschaftlichen Begleitung des Projektes<br />
22 vgl. Feuerhelm (2003), S. 60<br />
23<br />
Dem Normalitätskonzept <strong>von</strong> Jugendkriminalität kann entnommen werden, das delinquentes Handeln<br />
junger Menschen sowohl statistisch als auch entwicklungsbedingt in der Regel als normal,<br />
jugendspezifisch und dazugehörend erklärt. Straffälligkeit junger Menschen ist kein<br />
Minderheitenphänomen, entgegen dem ist da<strong>von</strong> auszugehen, dass nahezu jeder junge Mensch im<br />
Laufe seines Entwicklungsprozesses gegen strafrechtliche Normen verstößt [vgl. Heinz (2003), S.71].<br />
Jugendkriminalität gilt daher als ubiquitär und keinesfalls als individuelle Auffälligkeit mit<br />
Seltenheitscharakter. In der Zeit des Erwachsenwerdens gilt delinquentes Verhalten Jugendlicher aus<br />
entwicklungspsychologischer Sicht als normal und erklärbar. Allgemein werden Jugendlichen in dieser<br />
Phase Statusunsicherheiten zugeschrieben, welche sich in dem Übergang in das Erwachsenenalter und<br />
den damit entstehenden Verunsicherungen begründen. Die erhöhte Auffälligkeit für Normverstöße<br />
kann u.a. erklärt werden mit der Phase der Identitätssuche, in der der Jugendliche ein gesichertes<br />
Normen- und Wertesystem noch nicht verinnerlicht hat. Bei den Verfehlungen der Jugendlichen<br />
handelt es sich dabei überwiegend um Delikte im Bagatellbereich. So gelten Delikte wie<br />
Sachbeschädigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gewaltdelikte als jugendtypisch,<br />
wobei sich die Gewaltdelikte in den meisten Fällen auf einfache Körperverletzung beschränken und<br />
schwere Formen <strong>von</strong> Gewalt selten sind.<br />
24<br />
Albrecht in: Heinz (2008), S. 89; weiter ausführend: „bestimmte rein strafende Sanktionsabfolgen<br />
erhöhen das Risiko, dass es nach einer dritten noch zu einer vierten Straftat kommt, auf das Dreifache.“<br />
25<br />
Diese Einschätzung entspricht auch der polizeilichen Bewertung <strong>von</strong> erstauffälligen jungen Menschen:<br />
„Hierbei ist die hinlänglich bekannte Tatsache <strong>von</strong> Bedeutung, dass die Mehrzahl der jugendlichen Täter<br />
nur einmal und darüber hinaus geringfügig auftritt, während nur ein geringer Teil wiederholt und mit<br />
einer kriminellen Disposition auffällig wird.“; Gloss (2007), S. 281. Einer Untersuchung der Kriminologischen<br />
Forschungsgruppe der Bayrischen Polizei ist zu entnehmen, dass Jugendliche im Alter zwischen 14 und<br />
15 Jahren, die durch Straftaten auffallen, zu einem Drittel einmalig auffallen und danach nicht mehr<br />
polizeilich registriert werden; vgl. Goerdeler (2003), S. 57<br />
26<br />
vgl. Heinz, in: Kiehl (1991), S. 193<br />
27<br />
vgl. Feuerhelm (2003), S. 62<br />
5
durch das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz ab dem Jahr 1999. 28<br />
Seinen präventiven Auftrag kann das `Haus des Jugendrechts´ nicht einlösen, indes<br />
wird es seinem repressivem Arbeitsansatz 29 gerecht. Unabhängig <strong>von</strong> dargelegten<br />
Veränderungen sowohl im Bereich der Diversion als auch im Bereich <strong>von</strong> Weisungen<br />
und Auflagen, die bei einer „bloßen“ Ausweitung dieser Verfahrensweise auf<br />
Bagatell- und Ersttäterdelikten indes kein Ausbau präventiven Vorgehens darstellen,<br />
sondern vielmehr im Sinne einer Sanktionsausweitung zu verstehen sind 30 , bleibt in der<br />
wissenschaftlichen Begleitung der immense Anstieg der Jugendstrafe ohne<br />
Bewährung <strong>von</strong> rund 20% (<strong>von</strong> 6,3 % zu 8,5 % aller Urteile) innerhalb der vierjährigen<br />
Projektzeit vollkommen unkommentiert. 31 Dieser massive Anstieg der Ultima Ratio<br />
Strafe des Jugendstrafrechtes deutet auf eine Zunahme repressiver Sanktionierungen<br />
hin, welche sich mit dem Deckmantel kriminalpräventiven und multiprofessionellen<br />
Zusammenarbeitens kleidet.<br />
Präventionskonzepte sind stets dahingehend zu prüfen, welchem Adressaten sie<br />
gelten und welche Art der Prävention, in Verbindung mit der bezweckten Intention,<br />
sich hinter der jeweiligen Begrifflichkeit verbirgt. Das Model des `Haus des<br />
Jugendstrafrechts´ ist dabei in den Bereichen der sekundären und tertiären<br />
Prävention anzusiedeln, da es für eine bestimmte Risikogruppe konzipiert ist, und es<br />
im speziellen der Vermeidung, bzw. der Vorbeugung neuer delinquenter Auffälligkeit<br />
dienen soll. Eine Einordnung des Konzeptes in eine aufklärende oder intervenierende<br />
Form der Prävention fällt zu Gunsten des aktiv eingreifenden Konzeptes aus, da das<br />
rasche und zeitnahe Eingreifen bei einem bekanntwerden jugendlicher Delinquenz<br />
ein Teilziel des `Haus des Jugendrechts´ ist. Mit dem Wissen, dass durch eine<br />
frühzeitige Sanktionierung die Wiederholungsgefahr erst gesteigert wird, widerspricht<br />
dieses Vorgehen dem Ziel einer langfristigen Reduzierung <strong>von</strong> Jugendkriminalität und<br />
gefährdet zugleich das Ziel der Legalbewährung. Auch Begründungen in Form <strong>von</strong><br />
negativer und spezialpräventiver Abschreckung laufen ins Leere. Die Strategie der<br />
Kriminalitätsvermeidung durch Abschreckung geht in der (jugend-)strafrechtlichen<br />
Praxis nicht auf, gerade wenn man bedenkt, dass die <strong>von</strong> jungen Menschen<br />
begangenen Delikte in aller Regel spontan und unprofessionell ausgeübt werden.<br />
Mögliche (strafrechtliche) Folgen werden zum Zeitpunkt der Tatbegehung <strong>von</strong> den<br />
Agierenden meist nicht bedacht.<br />
Das Model des `Haus des Jugendrechts´ kommt hinsichtlich seiner präventiven<br />
Zielsetzung insofern, da augenscheinlich kein kriminalitätsmindernder Faktor<br />
offensichtlich wird, in Erklärungsnöte.<br />
Die Jugendhilfe, das Kellerkind des `Haus des Jugendrechts´?<br />
28 vgl. Feuerhelm (2003), S. 57<br />
29 vgl. Feuerhelm (2003), S. 79<br />
30 vgl. Kiehl (1991), S. 200<br />
31<br />
Der massive Anstieg der vollstreckten Jugendstrafe wird Anhand Abbildung 7: „Vergleich der<br />
Urteilsinhalte beim AG Bad Cannstadt vor und während der Projektzeit“ ersichtlich; vgl. Feuerhelm<br />
(2003), S. 77<br />
6
Durch die Besonderheit des im Jugendstrafrechtes verankerten, grundlegenden<br />
Erziehungsgedankens (§ 2 Abs. 1 JGG n.F) wird die (jugendstrafrechtliche) Praxis dem<br />
Phänomen jugendlicher Devianz, unter Berücksichtigung des oben genannten<br />
entwicklungsbedingten Normalitätskonzeptes <strong>von</strong> strafrechtlicher Auffälligkeit im<br />
Jugendalter, dadurch gerecht, dass das dem Strafrecht fremde Mittel erzieherischer<br />
Hilfen durch die Einbindung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren nicht nur Einzug<br />
erhält, sondern diese auch vorrangig angewandt werden sollen. 32 Die Dialektik in der<br />
Ausweitung repressiven und kontrollierenden Vorgehens liegt in der Zurückdrängung<br />
helfender und fördernder Ansätze, die den Betroffenen dazu befähigen sollen,<br />
künftig ein straffreies Leben führen zu können. Ein solches Vorgehen missachtet<br />
zugleich die aktuellen Ergebnisse der Ursachenforschung, welche die Entstehung <strong>von</strong><br />
Jugendkriminalität und kriminalitätsbegünstigenden Faktoren, vor allem auf sozioökonomischen<br />
Belastungen und auf marginalisierte Zustände des Einzelnen (aber<br />
auch Gruppen) zurückführen. 33 Dabei sind „Lebenslagen und Schicksale (…) positiv<br />
beeinflussbar – aber nicht mit den Mitteln des Strafrechts. Die Forschungen zeigen,<br />
dass die negativen Entwicklungsdynamiken krimineller Karrieren gebrochen werden<br />
können, aber nicht durch strafrechtliche Intervention, sondern durch `Verbesserung<br />
der Chancen der Jugendlichen auf soziale Teilhabe’.“ 34 Zwar wird auch die Soziale<br />
Arbeit nicht in der Lage sein gesellschaftspolitische Strukturen gänzlich auflösen und<br />
kompensieren zu können. Dennoch ist diese Ausgangslage Ansatzpunkt einer auf<br />
Förderung und Sicherstellung einer kindeswohlgemäßen und gemeinschaftsfähigen<br />
Entwicklung ausgerichteten Arbeitsweise der Jugendhilfe innerhalb des<br />
Jugendstrafverfahrens. Bis auf die JGH hat „niemand der Beteiligten (StA, Ri, Pol) den<br />
fachlichen Sachverstand bezüglich entwicklungspsychologischer und<br />
sozialpädagogischer Fragen“ und sowohl Polizei, als auch Staatsanwaltschaft haben<br />
„originär nichts mit Beratung, Betreuung oder Erziehung zu tun.“ 35 Vor einem<br />
„`Wildern´ einzelner Professionen in fremden Arbeitsgebieten (ist) zu warnen.“ 36<br />
„Jugendhilfe muss ihren Auftrag als `kooperatives Konkurrenzverhältnis´ zur Polizei<br />
und Justiz verstehen: so viel Jugendhilfe wie möglich, so wenig Strafrecht wie nötig.“ 37<br />
Die arbeitsinhaltlichen Unterschiede zwischen Jugendhilfe und Strafverfolgung,<br />
nämlich ressourcenorientierte Förderung auf der einen Seite und die Wahrung<br />
32<br />
Die rechtlichen Folgen einer Jugendstraftat ergeben sich aus § 5 JGG. Dabei sind die Reaktionen in<br />
einem in der Eingriffslegitimität abgestuften System festgeschrieben, welches dem Prinzip der<br />
Subsidiarität folgt. Dabei sind Erziehungsmaßregeln vorrangig anzuordnen, deren Zweck nicht in der<br />
Ahndung der Tat, sondern ausschließlich in der Erziehung des Täters bestehen soll. „Denn die<br />
Erziehungsmaßregel dient ausschließlich der positiven Spezialprävention, der Entwicklung des<br />
Verurteilten.“ 32 Böhm (1996), § 22, S. 147<br />
33<br />
„Kriminalität ist durch eine Vielzahl <strong>von</strong> ökonomischen, sozialen, individuellen und situativen Faktoren<br />
bedingt, die regelmäßig außerhalb des Einflusses des strafrechtlichen Systems liegen. So zeigen z.B.<br />
Untersuchungen zur Kriminalität sowohl jugendlicher Mehrfach- und Intensivtäter wie jugendlicher<br />
Gewalttäter ein hohes Maß sozialer Defizite und Mängellagen bei diesen Tätergruppen, angefangen<br />
<strong>von</strong> erfahrener, beobachteter und tolerierter Gewalt in der Familie, materiellen Notlagen,<br />
Integrationsproblemen vor allem bei jungen Zuwanderern (mit oder ohne deutschen Pass), bis hin zu<br />
Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung und dadurch bedingter Chancen- und Perspektivlosigkeit.“ W.<br />
Heinz (2008), S. 89<br />
Bei der Anamnese jugendlicher Intensivtäter ließen sich vor allem schwerste, aus der Kindheit<br />
resultierende Verlust- und Mangelerfahrungen sowie früh einsetzende Fehlentwicklungen feststellen, vor<br />
allem in den Bereichen: eigener Erfahrung innerfamiliärer Gewalt, gravierender sozialer<br />
Benachteiligungen und schlechter Zukunftschancen aufgrund eines niedrigen Bildungsniveaus; vgl.<br />
Huck (2002), S. 189<br />
34<br />
W. Heinz (2008), S. 89<br />
35<br />
Breymann, nach: Förster (2007), S. 322<br />
36<br />
Breymann, nach: Förster (2007), S. 322<br />
37 DIJuF (2007), S. 324<br />
7
strafrechtlich relevanter Normen, insbesondere unter Anwendung repressiver Mittel 38 ,<br />
auf der anderen Seite, muss insbesondere für den Adressat der Jugendhilfe klar<br />
unterscheidbar sein, damit er die ihm angebotene Hilfe annehmen kann. Nur so<br />
kann der Ansatzpunkt der Jugendhilfe im Strafverfahren, das erzieherische oder<br />
helfende Tätigwerden gegenüber dem straffällig gewordenen jungen Menschen<br />
zum Zwecke der Legalbewährung 39 (u.a.), Umsetzung finden.<br />
So wünschenswert flexible Verfahrensgestaltungen innerhalb des<br />
Jugendkriminalitätsrechts sind, gilt es vermeintlich gut gemeinte Schnellschüsse zu<br />
vermeiden. 40 Das Konzept des Stuttgarter `Haus des Jugendrechts´ wird indes seinen<br />
Primärzielen nicht gerecht. Die angestrebte „Optimierung der Effektivität bei der<br />
Bekämpfung der Jugendkriminalität (…) zur langfristigen Reduzierung der<br />
Jugendkriminalität/-delinquenz“ 41 vermag das Model, bei einem Anstieg der<br />
unbedingten Jugendstrafe <strong>von</strong> ca. 20% (binnen vier Jahre), nicht einlösen zu können.<br />
Auch das Konzept des engen und behördenübergreifenden Zusammenarbeitens<br />
stellt sich, unabhängig auch <strong>von</strong> datenschutzrechtlichen Vorgaben, aufgrund der<br />
originären und unterschiedlichen Arbeitsaufträge, aber auch aufgrund der sich für<br />
den Adressaten darstellenden und undurchschaubaren Vermischung <strong>von</strong> Hilfe- und<br />
Kontrollinstanzen, eher kontraproduktiv dar und droht sich negativ auszuwirken. Die<br />
Errichtung eines derartigen Konzeptes erscheint eine zumindest fragwürdige<br />
Vorgehensweise in Bezug auf das gesteckte Ziel der Bekämpfung <strong>von</strong><br />
Jugendkriminalität zu sein. Statt einen vermeintlich uneffektiven, weil an den<br />
Ursachen vorbeiwirkenden, Ausbau sozialer Kontrollinstanzen, gilt es „Einrichtungen<br />
und Maßnahmen der primären und sekundären Prävention zu fördern, die<br />
anzusetzen haben bei den Familien, Schulen und in den Kommunen.“ 42 Ein erster<br />
Schritt in die richtige Richtung für <strong>Hessen</strong> (aber auch bundesweit) wäre die<br />
Rücknahme der landespolitischen Kosteneinsparungen („Operation sichere Zukunft“)<br />
im Bereich der ambulanten Jugendstraffälligenhilfe und dem dadurch realisierbaren<br />
Ausbau pädagogischer Hilfeangebote. Bei einem Umzug der Jugendhilfe in ein<br />
`Haus des Jugendrechts´ droht ein Wiedereinzug der „Sozialarbeit in das Souterrain<br />
der Justiz“ 43 und der Rückfall in ein traditionell justiznahes Rollenverständnis der im<br />
Jugendverfahren tätigen Sozialarbeit. Die Jugendhilfe als Mietnomade des `Haus des<br />
Jugendrechts´, der weder so recht zu den anderen Mietern passt, noch besucht<br />
wird, kann nicht das Ziel eines gelingenden Kooperationsverhältnisses im<br />
Jugendstrafverfahren sein, so dass aus Sicht aller Beteiligten, aber insbesondere der<br />
Jugendhilfe und ihrer jungen Klientel, da<strong>von</strong> abzuraten ist.<br />
38<br />
„Der Schwerpunkt der polizeilichen Jugendsachbearbeitung liegt eindeutig im repressiven Bereich,<br />
wenngleich auch präventive Sachverhalte aufgearbeitet werden.“; Gloss (2007), S. 280<br />
39<br />
vgl. DIJuF (2007), S. 324<br />
40<br />
Gegen einen Schnellschuss spricht, dass bereits im September 2006 ein Antrag der Fraktion der SPD<br />
betreffend der Schaffung eines “Hauses des Jugendrecht“ in <strong>Hessen</strong> erfolgt ist, dieser aber bisher keine<br />
Umsetzung gefunden hat; Drucksache des hessischen Landtages 16/6071 vom 26.09.2006<br />
41<br />
Feuerhelm (2003), S. 59 f.<br />
42<br />
Heinz (2005), S. 17<br />
43<br />
Gleichnamiger <strong>Beitrag</strong> <strong>von</strong> Müller & Otto: „Sozialarbeit im Souterrain der Justiz“; in: Trenczek und in:<br />
Becker-Textor, I., Textor M.R<br />
8
L I T E R AT U R V E R Z E I C H N I S<br />
Becker-Textor, I., Textor M.R (Hrsg.). SGB VIII – Online-Handbuch. [http://www.sgbviii.de/S110.html]<br />
Böhm, A. (1996). Einführung in das Jugendstrafrecht. (3. Aufl .). München: Beck.<br />
Förster, A. (2007). Polizei und Sozialarbeit IV: „Arbeit vor Ort – Schwere Fälle – Intensivtäter“. (Tagungsbericht).<br />
Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 18 (3), 320-322.<br />
DIJuF – Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht: Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit (2007). Die<br />
Unterschiede als Chance verstehen! Kommunikation, Kooperation und der § 36 a SGB VIII. Zeitschrift für<br />
Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 18 (3), 323-329.<br />
<strong>DVJJ</strong>-Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendgerichtshilfe (Hrsg.) (2003). Grundsätze: Jugendhilfe im Strafverfahren.<br />
Hannover: <strong>DVJJ</strong> Eigenverlag. <strong>DVJJ</strong>-Erklärung (2008). Für ein rationales Strafrecht. Zeitschrift für<br />
Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 19 (1), 96 f.<br />
Feuerhelm, W. (2003). Das Haus des Jugendrechts in Stuttgart Bad Cannstatt. (Institut für Sozialpädagogische<br />
Forschung, Mainz). [http://www.uniheidelberg. de/institute/fak2/krimi/<strong>DVJJ</strong>/Aufsaetze/Feuerhelm2003.pdf].<br />
Gloss, W. (2007). Standards in der polizeilichen Jugendarbeit. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe,<br />
18 (3), 278-283.<br />
Goerdeler, J. (2003). Junge Mehrfachtäter: Hintergründe und sinnvolle Interventionen (Tagungsbericht). <strong>DVJJ</strong>-<br />
Journal, 14 (1), 57-61.<br />
Heinz, W. (2003). Jugendkriminalität in Deutschland. Kriminalistische und kriminologische Befunde.<br />
[www.unikonstanz.de/rtf/kik/Jugendkriminalitaet-2003-7-e.pdf].<br />
Heinz, W. (2005). Kriminalprävention auf justitieller Ebene: Hilft weniger mehr? Alternativen zu „klassischen“<br />
Sanktionen – Erfahrungen aus Deutschland.<br />
[http://www.unikonstanz.de/rtf/kis/Heinz_Alternativen_zu_klassischen_Sanktionen.pdf].<br />
Heinz, W. (2008). Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um eine Verschärfung des Jugendstrafrechts.<br />
Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 19 (1), 87-91.<br />
Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (2008). Presseinformation vom 17. Januar: Erneut Rückgänge<br />
bei Straßenkriminalität, Einbruchsdiebstahl und Gewaltkriminalität. [http://www.hmdi.hessen.de/].<br />
Hessisches Ministerium der Justiz (2008). Keine rechtsfreien, sondern nur angstfreie Räume. Pressemitteilung<br />
vom 07.03.2008. [http://www.hmdj.hessen.de] (Hessische Landtag: Drucksache 16/6071 vom 26.09.2006).<br />
[http://starweb.hessen.de/cache/DRS/16/1/06071.pdf].<br />
Huck, W. (2002). Kinder und Jugendliche als Intensivtäter: Anamnese, Früherkennung und dissoziales Verhalten.<br />
<strong>DVJJ</strong>-Journal, 13 (2), 187-193.<br />
Kiehl, W.H. (1991). Jugendgerichtshilfe: Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Jugendhilfe und<br />
Jugendstrafgericht. In R. Wiesner & W.H. Zarbock (Hrsg.), Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und<br />
seine Umsetzung in der Praxis. Köln u.a.: Heymanns.<br />
9
Lenhart, R. (2008). [http://www.roger-lenhart.de/lw08/c/aktuelles/2008/080115 jugendrecht.htm – 15.01.2008].<br />
(Stand April 2008).<br />
Müller, S. & Otto, H.-U. (1986). Sozialarbeit im Souterrain der Justiz.Plädoyer zur Aufkündigung einer<br />
verhängnisvollen Allianz. In S. Müller & H. Otto (Hrsg.), Damit Erziehung nicht zur Strafe wird (S. VII ff.).<br />
Bielefeld.<br />
Plewig, H.-J. (2005). Cop4U (Teil2): Kritische Anmerkungen. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe,<br />
16 (2), 164 f.<br />
Trenczek, T. (2003). Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren<br />
– Jugendgerichtshilfe. Weinheim: Beltz-Votum.<br />
10