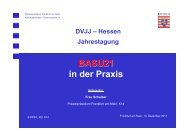Ist das deutsche Jugendstrafrecht noch zeitgemäà ? - DVJJ-Hessen
Ist das deutsche Jugendstrafrecht noch zeitgemäà ? - DVJJ-Hessen
Ist das deutsche Jugendstrafrecht noch zeitgemäà ? - DVJJ-Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr. Arthur Kreuzer, Direktor des Instituts für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen<strong>Ist</strong> <strong>das</strong> <strong>deutsche</strong> <strong>Jugendstrafrecht</strong> <strong>noch</strong> zeitgemäß?Zum Thema der Abteilung Strafrecht des 64. Deutschen JuristentagesI. Das <strong>Jugendstrafrecht</strong>sthema im Kontext kriminalpolitischer DiskussionWarum – so ist zu fragen – befasst sich der Deutsche Juristentag nach fast 100 Jahrenerstmals wieder mit dem <strong>Jugendstrafrecht</strong>? Es gibt derzeit völlig diskrepante Tendenzen inPolitik, Praxis und Wissenschaft. Das war <strong>noch</strong> anders, als 1990 <strong>das</strong> 1. JGGÄndG mit derVerpflichtung erlassen wurde, ein weiteres Änderungsgesetz zur Vervollständigung derReform alsbald zu verabschieden. Der erste Reformschritt war gekennzeichnet vonAnnäherungen an jugendkrimologische Erkenntnisse und an praktisch erprobte Modelle der„Diversion“. U. a. wurden Betreuungsweisungen, soziale Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich und Arbeitsauflagen, insgesamt der Vorrang erzieherisch konzipierter undambulanter Rechtsfolgen sowie der informellen Verfahrensabschlüsse bekräftigt undausgebaut, dies in großer Einmütigkeit. 1Der zweite Reformschritt in gleicher Richtung blieb aus, weil die Einmütigkeit verloren ging.Während etwa die Jugendgerichtstage, die Reformkommission der Deutschen Vereinigung fürJugendgerichte und Jugendgerichtshilfen (<strong>DVJJ</strong>) und ganz überwiegend die entsprechendenKriminalwissenschaften einen weiteren Abbau verzichtbarer strafender Elemente des JGGanmahnen, 2 fordern einige Gesetzesentwürfe gegenläufig eine Verschärfung des Strafens,namentlich die Anhebung der Jugendstrafe auf 15 Jahre, die Einführung des„Einstiegsarrests“ und Fahrverbots sowie eine weitgehende Anwendung vonErwachsenenstrafrecht auf Heranwachsende. 3 Diese Abkehr vom Reformimpetus undRückkehr zu konservativer Strafmentalität in Teilen der Politik steht im Zusammenhang mitzwei zeitgeschichtlichen Strömungen:1 Dazu u. a. Böhm, NJW 1991, 537; Heinz, ZRP 1991, 183; Schüler-Springorum/FS Kaufmann, 1993, 645.2 <strong>DVJJ</strong> – Reformvorschläge in <strong>DVJJ</strong> – J 1992, 4; 2001, 345; Erklärung von über 50 Professoren derKriminologie und des <strong>Jugendstrafrecht</strong>s 1998, ZRP 1998, 446; Walter u. Stellungnahmen weiterer Professoren,Strafrechtslehrertagung 2001, ZStW (113) 2001, 743, 827, 846.
2Zum einen ist es die von den USA auf Europa ausstrahlende neoklassizistische Strömung derBetonung klassisch-generalpräventiv-repressiven (Erwachsenen-) Schuld-Strafrechts undeiner Strafverhärtung („get tough“), die nicht nur von konservativen Kräften getragen wird.Beide großen Parteien in den USA haben den Ausbau der Todesstrafe – für Jugendliche ab 16Jahren –, des „Lebenslang“ ohne Restaussetzung, der Überstellung Jugendlicher inErwachsenengerichte („waiver“, „transfer system“) und entsprechender Sanktionen beiVerbrechen, auch der Drillerziehung („boot camps“) mitgetragen. In Großbritannien – denUSA bekanntlich näher stehend – hat „New Labour“ („New Left Wing Realism“) u. a. <strong>das</strong>Alter unbedingter Strafmündigkeit auf 10 Jahre herabgesetzt und Lebenslang für Jugendlichebei Verbrechen eingeführt. Demgegenüber nehmen sich Verschärfungsforderungen – zumeistaus unionsgeführten <strong>deutsche</strong>n Ländern und dem Bundestag – vergleichsweise bescheidenaus, wie es umgekehrt auch bei der Bundesregierung Symptome in RichtungStrafverschärfung gibt, denkt man etwa an die „Wegschließen – für – Immer“-Parole.Zum anderen stützt sich die Verschärfungsforderung auf einen tatsächlichen oder sowahrgenommenen „beängstigenden Kriminalitätsanstieg“, zumal bei Gewalt, seit 1990.Dieser fällt allerdings kriminalstatistisch deutlich höher aus als bei Beachtung derDunkelfeldforschung und qualitativer Kriterien; außerdem ist er seit etwa 1999 leichtrückläufig. 4 Hinzu kommt, <strong>das</strong>s spektakuläre Vorfälle vermehrt massenmedial skandalisiertwerden und gesetzgeberisch-symbolisch-strafende Reaktionen herausfordern (vgl. die Fälle„Bulger“ in England, „Mehmet“ in Süddeutschland). Solche Forderungen wurden namentlichangesichts der vorangegangenen und jetzt bevorstehenden Bundestagswahl erhoben.II.Forderung nach Beseitigung der erzieherischen Zielsetzung1. Die Gesetzesentwürfe zur Änderung des JGG wollen nicht umfassend denErziehungsgedanken streichen, lediglich insoweit eingrenzen, als vergeltendem, härteremStrafen und weitgehender Ausgliederung der Heranwachsenden <strong>das</strong> Wort geredet wird. DieErziehungsidee strikt zu beseitigen, entsprach bislang lediglich einer Außenseitermeinung in3 Vgl. u. a. BT-Drucks. 14/3189, 14/6539; BR-Drucks. 741/96, 562/97, 580/97, 459/98, 449/99, 549/00, 564/00,637/00, 759/00.4 Vgl. H.-J. Albrecht Gutachten für den DJT, <strong>noch</strong> unveröff. Fassung 2002, 3.1; Erster Sicherheitsbericht derBReg. 2001, im Teil zur Jugendkriminalität nachgedruckt: <strong>DVJJ</strong>-J 2001, 399; Langfassung (zu 2.1.):http://www.bmi.bund.de.
5interpretierbar und vom Schuld- sowie Verhältnismäßigkeitsprinzip her kasuistischeingrenzbar. Erziehung i. S. d. JGG kann verstanden werden als Einflussnahme auf jungeStraffällige mit dem Ziel, künftig Strafnormen einzuhalten. „Erziehung ist nicht <strong>das</strong> Ziel des<strong>Jugendstrafrecht</strong>s, sondern nur ein Mittel zum Zweck künftigen Legalverhaltens.“ 8 Erziehungist zentriert auf sozialisationsstützende Angebote und Hilfen.• Weiter heißt es, mit Erziehung und Resozialisierung verbänden sich Fehlerwartungen anindividualpräventive Wirkungen des Strafrechts, wie auch generalpräventive Wirkungenkaum erzielbar seien. Demgegenüber ist hervorzuheben, <strong>das</strong>s die Erwartungen teilstatsächlich überzogen erscheinen, andererseits für totale Skepsis ebenso wenig Grund besteht.Auch sollten wir als Kriminologen unsere Möglichkeiten, präventive Effekte des Strafrechtsan sich oder bestimmter Rechtsfolgen zu messen, nicht überschätzen; dazu wäreExperimentalforschung angezeigt, die sich jedoch rechtlich und praktisch verbietet. Dass abergeneralpräventive Wirkungen möglich sind, wird schon durch den Blick auf die Handhabungdes Straßenverkehrsrechts plausibel.• Kritisch wird überdies betont, die meisten jungen Straftäter bedürften gar keinerstaatlichen Erziehungseingriffe; schwere Delikte, „Karriere-„ und „Intensivtäter“ seien relativseltene Ausnahmen. Dem liegen richtige und wichtige kriminologische Erkenntnisse zuGrunde. Jugenddelikte sind überwiegend „normal“, „ubiquitär“, „episodenhaft“. Dies belegtdie Dunkelfeldforschung. 9 Fast alle begehen nämlich – kulminierend zwischen 15 und 25Jahren – gelegentlich kleinere Delikte, dies in allen Schichten und an allen Orten. Fast allebleiben frei von Strafverfolgung; nach dieser Episode gelingt bei den meisten unschwer dieSozialisation, unabhängig von staatlichen Eingriffen. Nur ein geringer Teil fällt miterheblicher Delinquenz auf; bei einigen aus dieser Gruppe verfestigt sich die kriminelleEntwicklung, ohne <strong>das</strong>s solche „Karrieren“ sicher prognostizierbar wären, so <strong>das</strong>s frühesichernde, resignierende Intensivinterventionen zu viele erfassen würden. Bei den erheblichund wiederholt Auffälligen stößt man indes erfahrungsgemäß auf deutlich in ihrerSozialisation – teils bereits in früher Kindheit – Geschädigte. Der Masse nichterziehungsbedürftiger junger Strafttäter leichter und mittlerer Delinquenz wird die üblicheverfahrens- und eingriffsarme Diversions-Bewältigung von Strafverfahren gerecht. Wo wegenGewalt oder Vandalismus wiedergutmachende Leistungen, Täter-Opfer-Ausgleich odergemeinnützige Arbeit angezeigt erscheinen, kann diese Verfahrenserledigung - geradeerzieherisch begründet - sinnvoll sein. Umgekehrt veranlasst <strong>das</strong> Erziehungsdenken,8 Heinz in: Dünkel u. a. (Hrsg.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien ... 1997, 3, 58; Schöch o. Fn.4,12.9 Statt vieler: Kreuzer/Görgen u. a. Jugenddelinquenz in Ost und West, 1993; Kreuzer NStZ 1994, 10, 164.
6Verfahren bei Bagatelldelikten gerade nicht „ohne alles“, formal, schriftlich, bürokratischroutiniert,ohne persönlich mahnendes Gespräch einzustellen, weil damit erzieherischnegative Signale des Nicht-Ernst-Nehmens von Normen verbunden wären.• Albrecht behauptet mit anderen 10 ferner, Jugendliche, vor allem aber Heranwachsendewürden härter sanktioniert als Erwachsene („Erziehungszuschlag“); bei der Strafzumessungdominierten im Übrigen wie im Erwachsenenrecht Gesichtspunkte der Deliktsschwere undVorstrafenbelastung; es gäbe keinen Anhaltspunkt für mildere Sanktionierung im<strong>Jugendstrafrecht</strong>. Die Belege sind nicht durchweg überzeugend, manchmal irreführend odernicht erbracht. Insgesamt kann nach Gesetz und vorliegenden Erfahrungen, Untersuchungenund Rechtsprechungsanalysen summarisch angenommen werden, <strong>das</strong>s <strong>Jugendstrafrecht</strong> zuteils milderer, teils andersartiger, teils eingriffsintensiverer Reaktion bei kleiner und mittlererDelinquenz führt, zu deutlich geringeren Strafen bei schweren Delikten. Für die schwerenTaten ergibt sich dies schon aus den reduzierten gesetzlichen Strafrahmen und aus derTendenz des BGH, trotz Schwere der Schuld den Erziehungsgedanken alsstrafhöhenmindernd heranzuziehen. Nach unseren laufenden Befragungen in derRichterfortbildung treten übrigens neben herkömmliche Strafzumessungskriterien dominant<strong>noch</strong> die Geständigkeit und Einsicht, die im Jugendalter häufiger sind; weitere erzieherischeErwägungen mit geringerem Gewicht sind erkennbar, die sich ambivalent, aber mitabnehmender Tendenz straferhöhend auswirken (beispielsweise Strafzeitbemessung nachMindestzeiten für Ausbildungsgänge). Eine Klarstellung in einer Strafzumessungsvorschriftim JGG ist aus diesen und anderen Gründen – insofern Albrecht folgend – angebracht;entsprechend sind Schuld-, Verhältnismäßigkeits- und ultima-ratio-Prinzip für dieStrafzumessung verbindlich zu machen; zugleich können erzieherische Erwägungen –insofern entgegen Albrecht – zur Herabsetzung der Obergrenze und zur Unterschreitung derschuldangemessenen Mindesthöhe führen.• Insbesondere wird kritisch eine Schlechterstellung junger Strafgefangener unter Berufungauf <strong>das</strong> Erziehungsziel des § 91 I JGG betont. 11 Es trifft zu, <strong>das</strong>s der Mindeststrafsockel mitsechs Monaten (§ 18 I 1 JGG) höher liegt als der für Freiheitsstrafen (ein Monat, § 38 I StGB,freilich relativiert durch den Ausnahmecharakter kurzer Strafen, § 47). Ob <strong>das</strong> ultima-ratio-Gebot des § 17 II JGG dies hinreichend kompensiert, ist fraglich. Auch ist festzustellen, <strong>das</strong>sjungen Gefangenen Vollzugslockerungen stärker vorenthalten und gegen sie häufigerDisziplinarmaßnahmen verhängt werden; <strong>das</strong> Erziehungsziel wirkt dabei legitimierend.Freilich dürfte <strong>das</strong> Ergebnis kaum anders ausfallen, beriefe man sich auf „Sicherheit und10 H.-J. Albrecht o. Fn. 4, 2002; P.-A. Albrecht o. Fn. 5, 74 m. Nachw.; Frommel-Maelicke o. Fn. 5.
8Jüngerer bisher schwächer als im Erwachsenenrecht und deswegen künftig kompensierendauszubauen. Ebenso ist die unzureichend auf <strong>das</strong> Erziehungsprinzip gestützte Einschränkungder Rechtsmittel Jugendlicher nach § 55 I JGG zu streichen.4. Zusammenfassend ist festzustellen, <strong>das</strong>s mit der h. M. am Erziehungsziel des JGGfestgehalten werden soll. Mit notwendigen Korrekturen in Gesetz und Praxis kannberechtigten Einwänden begegnet werden. Das so eingegrenzte Erziehungsziel im JGG istunverzichtbare Stütze für folgende Funktionen:Eigenständigkeit eines <strong>Jugendstrafrecht</strong>s, die nicht allein mit geringerer Verantwortlichkeitund Strafmilderung bei jungen Tätern unter sonstiger Anpassung an <strong>das</strong> Erwachsenenrecht zubegründen ist; informelle, teils durch sozialisationsstützende Maßnahmen ergänzte Diversion;Schrittmacherfunktion des JGG und Innovation, die es neu zu beleben gilt; Subsidiaritätprimär strafender, stationärer, eingriffsintensiverer Rechtsfolgen; Unterschreiten derschuldangemessenen Ober- und Untergrenze von Strafen; Annäherung der Haftgestaltung an<strong>das</strong> erzieherisch Mögliche und Nötige; Leitidee für jugendrichterliches Handeln (vgl. § 37JGG15 ) und Selbstverständnis (intensiveres, durch Spezialisierung und Fortbildungfundierteres Sich-Befassen mit der Person junger Beschuldigter); Wahrnehmung dessubsidiären staatlichen Erziehungs-Wächteramtes bei Wegfall oder Versagen primärErziehungsberechtigter gegenüber Jugendlichen, um beispielsweise bei Freiheitsentzug keinErziehungsvakuum entstehen zu lassen (Art. 6 II GG), weshalb bei Schulpflichtigen imJugendstrafvollzug gar nicht auf diese staatliche Erziehung verzichtet werden darf.Ebenso gilt es, die überwiegend bewährte maßvolle Verzahnung von JGG und KJHGbeizubehalten. 16 Sie könnte sogar belebt werden vor allem bei Alternativen desJugendhilferechts zu Freiheitsentzug im Jugendstrafverfahren (etwa Heimalternativengegenüber der Untersuchungshaft, §§ 71, 72 JGG) und bei der Jugendgerichtshilfe (§ 38JGG), die gerade als Mittler erzieherischer, strafvermeidender oder strafmodifizierenderErkenntnisse und Möglichkeiten zwischen Sozialarbeit und Jugendamt einerseits,Jugendgericht andererseits – trotz der Rollenkonflikte - unersetzbar ist. Die Auflage,jugendhilferechtliche Leistungen in Anspruch zu nehmen (§ 12 JGG), erscheint dagegenentbehrlich.15 Dazu schon Kreuzer StV 1982, 438; ders. ZRP 1987, 235.
9III.Altersgruppe Jugendlicher und Heranwachsender1. Nachdem 1923 die bedingte Strafmündigkeit auf 14 Jahre hochgesetzt war, kam es in derzweiten Jahrhunderthälfte zu Diskussionen sowohl in Richtung Heraufsetzung auf 16 als auchHerabsetzung auf 12 Jahre. Rechtshistorisch und –vergleichend betrachtet schwanken dieFestlegungen beträchtlich. Es gibt keine entwicklungspsychologisch begründbaren Kriterienfür bestimmte altersmäßige Fixierungen. 17Die im Rahmen anstehender Gesetzesreformberatungen zunächst eingebrachten Vorschläge,die Strafmündigkeitsgrenze herabzusetzen, werden in der Politik nicht mehr aufrecht erhalten.Sie tauchen lediglich sonst gelegentlich auf. 18Eine Herabsetzung wird überwiegend begründet mit insgesamt zunehmenden undspektakulären Gewaltdelikten von Kindern sowie dem „Mehmet-Syndrom“, ferner mitfrüherer (biologischer) Reife, mit intensivierter Schulbildung sowie mit einer „Kontrolllücke“des KJHG als bloßem Leistungsgesetz gegenüber kindlichen Intensivtätern. Dieüberwiegende Meinung hält an der geltenden Regelung fest. 19 Es zeigt sich nämlich, <strong>das</strong>seiner früher einsetzenden Pubertät und allgemeiner Schulpflicht nicht eine frühere emotionale,moralische und soziale Reife entspricht, <strong>das</strong>s solche Reife heute vielmehr erschwert und eherverzögert ist durch die schwieriger werdende Orientierung, durch Wertumbrüche, durch „Mit-Erziehung“ außerfamiliärer Institutionen der Freizeit und Medien sowie durch interkulturelleMigration. 20 Zumal bei jungen Gewalttätern und vielen Migrantenkindern zeigen sichdefizitäre Gemütsbildung, Schul- und soziale Integrationsprobleme. Zu erinnern ist in diesemZusammenhang an nachteilige Ergebnisse der „Pisa-Studie“ hinsichtlich unterer sozialer undBildungs-Schichten sowie Randgruppen, ferner an Erkenntnisse über verbreitetesSchulschwänzen und wachsendes Analphabetentum. 21Eigentlicher Stein des Anstoßes ist letztlich die Handhabung der 12 - 15jährigen Intensivtäter.Es geht deswegen um die Forderung nach geschlossener Heimunterbringung – ob über einen16 Für strikte Trennung H.-J. Albrecht DJT-Gutachten o. Fn. 4; U. Frommel/Maelicke o. Fn. 5.17 Dünkel RdJB 1999, 291; Remschmidt Adoleszenz 1992, 173.18 Z. B. Hinz ZRP 2000, 107; Polizeigewerkschaft im DBB Kriminalistik 1997, 420; früher WeinschenkMschrKrim 1984, 15.19 Z. B. Professorenstellungnahme o. Fn. 2; H.-J. Albrecht DJT Gutachten o. Fn. 4; Hefendehl JZ 2000, 600;Heinz, Kaiser, Kreuzer 1999, Walter, jeweils o. Fn. 5; Kerner/Weitekamp Neue Praxis 1997, 486; Wolfslast FSBemmann 1997, 254.20 Statt vieler: Frehsee FS Schüler-Springorum 1993, 379; Wolfslast o. Fn. 19, jew. mit Nachw.
10straf- oder jugendhilferechtlichen Eingriff. Dazu bedürfte es keinerlei Gesetzesänderung, denndie Ausgestaltung der Heime (§§ 34 SGB VIII, 12, 71 II JGG) obliegt der Jugendhilfe. Nichtdie Rückkehr zu geschlossener „Fürsorgeerziehung“ von ehedem scheint angezeigt. Es dürftesich um eine sehr kleine Gruppe von bundesweit wenigen hundert Kindern und Jugendlichenhandeln, die zumindest kurzfristiger Abschließung bedürfen, um den Rahmen nötigererzieherischer Initiativen zu gewährleisten und den Kreislauf fortwährender erheblicherDelinquenz zu durchbrechen. Diese resignativ einfach laufen zu lassen und später über U-Haftund Jugendstrafe mit einem „Nachschlag“ zu belegen oder in die Jugendpsychiatrie oder inHeime anderer Bundesländer zu überstellen oder „erlebnispädagogisch“ in ferne Länder zuverbringen, entspricht ebensowenig verantwortungsvoller Reaktion wie frühe, haftähnlicheEinschließungen. Experten müssen – frei von ideologischen Scheuklappen – Erfahrungenauswerten und flexible, differenzierte Modelle herausarbeiten, Zielgruppen definieren,Bedarf, Kosten und Zuständigkeiten klären. Oft genügt anfängliche – sogar nur nächtliche –Abschließung in einem Zimmer oder Trakt einer bestehenden offenen Einrichtung.Voraussetzungen sind pädagogisch intensive Personalausstattung, Flexibilität und individuelleEntscheidungen in der Einrichtung selbst, außerdem zwischenbehördlich koordiniertesHandeln. 222. In Gesetzesinitiativen von unionsgeführten Ländern und im Beschluss des Bundesrats vom10.11.2000 wird die weitgehende Herausnahme der Heranwachsenden aus § 105 JGG undderen Überführung in <strong>das</strong> Erwachsenenstrafrecht gefordert. 23 Begründet wird <strong>das</strong> vor allemmit gewachsener Kriminalität, namentlich rechtsextremistischen Gewalttaten; dies erfordereenergischere, auch generalpräventive strafende Reaktionen. Außerdem seien Heranwachsendevolljährig und als solche voll strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Die Rechtsprechunghabe entgegen gesetzgeberischer Intention aus der Ausnahme jugendstrafrechtlicherRechtsfolgen eine Regel gemacht. Diese Relation müsse wieder umgekehrt werden.Die Forderung wird – und dies seit langem und in seltener Einmütigkeit – von Wissenschaft,Praxis, Jugendgerichtstagen und Fachverbänden abgelehnt. 24 Für Wissenschaftler und21 Wetzels et al. Jugend und Gewalt, 2001.22 Dazu z. B. Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) Schnelle Reaktion, 2001; H.-J. Albrecht, DJT-Gutachten o. Fn. 4;Kreuzer o. Fn. 5, 1999, 61 ff.; Lösel/Pomplun Jugendhilfe statt Untersuchungshaft, 1998; WolffersdorffGeschlossene Unterbringung, 1999, 129 ff.23 S. o. Fn. 3, insb. BR-Drucks. 564/00; im Schrifttum fast nur der Praktiker Hinz ZRP 2001, 106; ders. JR 2001,50.24 Vgl. z. B. <strong>DVJJ</strong>-Kommission, <strong>DVJJ</strong>-J 2001, 99, 341, 345; Professorenstellungnahmen o. Fn. 2; H.-J. AlbrechtDJT-Gutachten o. Fn. 4; die in Fn. 5 Genannten; Kreuzer Generalreferat zum Jugendgerichtstagsthema „Junge
11Praktiker gibt es keinen stichhaltigen Grund, Heranwachsenden <strong>das</strong> keineswegs durchwegmildere, jedoch flexiblere, altersangemessenere, bewährte <strong>Jugendstrafrecht</strong> vorzuenthalten.Im Gegenteil: Die Gründe, welche für die schon vom 6. Deutschen Jugendgerichtstag 1927vorgeschlagene Einführung des § 105 bestimmend waren, bestehen fort und haben sichverstärkt. § 105 war nach der Vorstellung der Reformer von 1953 ein „Experiment“, ein„mühsam gefundener Kompromiss“, ein „erster Schritt auf einem neuen Weg“, „nichtsEndgültiges“, eine Lösung, die alsbald, wenn Erfahrung gesammelt sei, durch eine bessereersetzt werden solle. Reichliche Erfahrungen seither sprechen für eine weitergehende Lösung,in einem „zweiten Schritt“ alle Heranwachsenden auch materiell-rechtlich in <strong>das</strong><strong>Jugendstrafrecht</strong> einzubeziehen, damit zugleich erheblichen Gutachteraufwand zu vermeidenund Rechtsgleichheit herzustellen; einige Rechtsfolgen und Verfahrensmodalitäten sind danngeringfügig zu modifizieren.Es ist schlicht falsch, wenn der Rechtsprechung vorgeworfen wird, sie sei zu milde und habeaus dem Regel- einen Ausnahmefall gemacht. Zum einen sind jugendstrafrechtlicheReaktionen nicht generell milder; sie sind qualitativ anders, stärker auf (Nach-)Erziehung,soziale Stabilisierung – und damit letztlich auf längere Sicht auch auf geeigneteren Schutz derAllgemeinheit – ausgerichtet. Zum anderen hat § 105 der Justiz freigestellt, Erfahrungen zusammeln; er sieht kein Regel-Ausnahme-Verhältnis vor. Vielmehr hat sich in der Praxis ausder Erfahrung eine stete Tendenz zur Anwendung jugendrechtlicher Sanktionen gebildet.Diese erfahrungsgestützte Praxis ist vom BGH schon 1958 bekräftigt worden: Im Zweifel ist<strong>Jugendstrafrecht</strong> anzuwenden, weil <strong>das</strong> jugendrechtliche Instrumentarium altersangemessenereSanktionen anbietet und die Persönlichkeit <strong>noch</strong> nicht ausgeformt ist. 25 DiePraxiserfahrung spiegelt sich wider in Forschungsbefunden zur Entwicklung der Anwendungdes § 105: Seit 1953 ist der Anteil der <strong>Jugendstrafrecht</strong>sanwendung von 30 % auf 60 %gestiegen; er steigt bei schweren Delikten auf über 90 % und liegt nur bei Bagatell- undStraßenverkehrsdelikten wegen des dem Erwachsenenrecht vorbehaltenenStrafbefehlsverfahrens unter 50 %; besonders hoch ist er in Großstädten und höher inNorddeutschland entsprechend dem Nord-Süd-Gefälle und der stärkeren Spezialisierung inJugendgerichten und JGH der Ballungsräume. Gerade bei schweren Delikten werdenemotionale und soziale Defizite in der Reife junger Menschen sichtbar.Volljährige im Kriminalrecht“, 1977, MschrKrim 1978, 1 (dort Nachw. zum Folgenden), zuletzt UJ 1999, 56;Remschmidt in: <strong>DVJJ</strong> (Hrsg.) Junge Volljährige im Kriminalrecht, 1977, 81.25 BGHSt 12, 116, 119.
12Die Rechtfertigung von <strong>Jugendstrafrecht</strong>sanwendung beruht auf ebenjenen Gründen, die derVerf. 1977 auf dem Deutschen Jugendgerichtstag erläutert hat und die seither <strong>noch</strong> deutlichergeworden sind: 26 Die generelle Einbeziehung Heranwachsender bedeutet Rücksichtnahme aufEigenheiten und Veränderungen in der Sozialisation dieser Altersstufe. Die Jugendphase istinsgesamt länger, komplexer, risiko- und konfliktbeladener geworden. Sie verliert klareKonturen, verläuft individuell ungleich nach Länge, Intensität und Schwierigkeit. Stichwortewie Verschulung, erschwerte Berufsfindungsprozesse, späteres Selbstständigwerden,Umbrüche in Erziehung und Werteorientierung, wachsende ambivalente Einflüsse vonFreizeitgruppen und Medien sowie Migrationen deuten es an. In dieser Altersphase sindaußerdem positive und negative Einflussnahme und Prägbarkeit <strong>noch</strong> besonders groß,jugendstrafrechtliche Reaktionen also chancenreicher. Nicht von ungefähr werden sogar mitFreiheitsstrafen belegte Jungtäter oftmals <strong>noch</strong> in den Jugendstrafvollzug überstellt. Weiterhinbesteht eine weitgehende strukturelle und motivationelle Ähnlichkeit der DeliquenzJugendlicher und Heranwachsender. Die Delikte tragen <strong>noch</strong> überwiegend jugendtümlicheZüge, wofür wenige beispielhafte Stichworte genügen müssen: Ausdruck von AnpassungsundIntegrationsschwierigkeiten, Gruppenbezug, Drogen- und alkoholbedingteEnthemmungen, Suche nach Statussymbolen Erwachsener, geringere Ziel- und größereBegleitschäden, Spontaneität, Impulsivität, mangelnde Planung und größereGeständnisbereitschaft, Aufbegehren und Protest, Kompromisslosigkeit, Problemflucht,Risikosuche. Schließlich bedeutet die Beibehaltung des <strong>Jugendstrafrecht</strong>s eine der seinerzeitgeforderten, aber sonst ausgebliebenen „flankierenden Maßnahmen“ des Gesetzgebers, als erdie Volljährigkeit auf 18 Jahre senkte, wohl wissend, <strong>das</strong>s dies angemessen war für dieNormalgruppe sich problemlos in Erwachsenenrollen einfindender junger Menschen, aberzumindest korrekturbedürftig für die Randgruppen der in ihrer Sozialisation Gefährdeten.Bezeichnend für späte Einsicht oder widersprüchliche Argumentation sind in diesemZusammenhang Reaktionen von Politikern nach der schrecklichen Tat eines Erfurter 19-jährigen gescheiterten Gymnasiasten: Der Bundesinnenminister kritisierte jetzt dievorverlagerte Volljährigkeit; die CSU setzte sich im Gesetzgebungsverfahren sogar damitdurch, – entgegen ihrer These, Volljährige im Recht als solche zu behandeln – <strong>das</strong>Mindestalter für den Sport-Schusswaffenerwerb wegen altersbedingter Risiken von 18 auf 21Jahre heraufzusetzen und bis 25 Jahren den Erwerb von einer medizinisch-psychologischenBegutachtung abhängig zu machen. 2726 Eingehend Kreuzer o. Fn. 24, 1978.27 BT-Drucks. 14/9432; BR-Drucks. 524/02; FAZ vom 15.06. u. 22.06.2002; Schily nach FAZ v. 30.04.2002;Beckstein nach DER SPIEGEL 19/2002.
13Wenn also entschieden einer Kehrtwende im Heranwachsendenrecht widersprochen wird, sosei doch ein schon 1977 vom Verf. eingebrachter Vorschlag wiederholt – der allerdings nurbedingt der Forderung von Gesetzgebungsbeteiligten entspricht –, bei Kapitaldelikten (§§ 41 INr. 1 JGG, 74 II GVG) <strong>das</strong> Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende auf 15 Jahreanzuheben. Bedingungen sind: die Ausweitung der <strong>Jugendstrafrecht</strong>sanwendung auf alleHeranwachsenden, so <strong>das</strong>s der Rückgriff auf die lebenslange oder nach § 106 JGG fakultativmögliche 10 – 15-jährige Freiheitsstrafe entfällt; ferner <strong>das</strong> Beibehalten des erzieherischausgestalteten Jugendstrafvollzugs und der günstigeren Strafrestaussetzungsmöglichkeiten.Die Anhebung ist vertretbar, weil der Sprung zum „Lebenslang“ zu groß wäre, andererseits inwenigen Fällen schwerer oder mehrfacher vorsätzlicher Tötungen sowie der Einbeziehungvorangegangener Verurteilungen <strong>das</strong> Höchstmaß von 10 Jahren unangemessen niedrigerschiene. Wenn Albrecht im DJT-Gutachten dem entgegen hält, die bisherige Höchststrafewerde nur selten angewandt, woraus auf fehlenden Bedarf einer Anhebung zu schließen sei,so irrt er: Es entspricht gerade dem Wesen von Strafzumessung, selten den Strafrahmen nachoben voll auszuschöpfen; selbst bei Schwersttaten werden in der Regel strafmilderndeUmstände (z. B. Geständnis) zu finden sein, die zumindest geringes Unterschreiten desHöchstmaßes nahe legen. 28 Außerdem zeigt der BGH den Bedarf an, wenn er – stark kritisiert– nach § 31 JGG „aus erzieherischen Gründen“ eine frühere Strafe nicht einbezieht, um fürdie neue ein möglichst hohes Maß zu gewährleisten. 29 Ferner sollte ein demStrafbefehlsverfahren angeglichenes summarisches Verfahren für Heranwachsende inBagatellsachen geschaffen werden.IV.<strong>Jugendstrafrecht</strong>liche Rechtsfolgen1. Mit einer vordringenden Meinung in der Wissenschaft 30 ist zu fordern, die kategorialeUnterscheidung von Erziehungsmaßregeln und (dem gegenüber ahndenden) Zuchtmittelnaufzugeben sowie alle Rechtsfolgen nach dem Subsidiaritätsprinzip deutlicher zu konturieren.Auch Erziehungsmaßregeln haben ahndende Komponenten und Zuchtmitteln erzieherische.Einige Erziehungsmaßregeln sind sogar eingriffsintensiver. Zu widersprechen ist Albrecht28 H.-J. Albrecht DJT-Gutachten o. Fn. 4, 11.3.6.2. Er irrt auch bei der Aussage, die Freiheitsstrafe sei fürHeranwachsende auf 15 Jahre begrenzt; § 106 I JGG erlaubt dies nur fakultativ. Wie hier schon Kreuzer o. Fn. 5u. 24, 1978 u. 1999. Forderungen nach Anhebung auf 15 Jahre: BT-Drucks. 14/3189, BR-Drucks. 449/99; HinzZRP 2001, 106, 110.29 BGH NStZ 1989, 574; a. A. Ostendorf o. Fn. 5 Rn. 15 zu § 31 m. weit. Nachw.
14indes, wenn er alle Rechtsfolgen in zu standardisierende „Aufgaben- undBeschränkungsstrafen“ einerseits, „freiheitsentziehende Strafen“ andererseits aufteilen will. 31Die erzieherische Flexibilität und Individualisierung sollte beibehalten werden. Vor allemsind beispielsweise Betreuungsweisungen und Trainingskurse oder gar therapeutischeWeisungen nach § 10 II JGG keine kriminalrechtlichen „Strafen“. Wären sie es, bedeutetensolche Kurse im Jugendstrafvollzug (verbotene) zusätzliche, über den Freiheitsentzughinausgehende, Strafen. Ebensowenig sollte man den Täter-Opfer-Ausgleich als „Strafe“diskreditieren.2. Der Vorschlag einzelner Bundesländer, ein Fahrverbot als Zuchtmittel einzuführen, 32erscheint diskutabel. Es soll zu einer „eigenständigen“, nicht auf Taten im Zusammenhangmit dem Straßenverkehr beschränkten Sanktion ausgebaut werden. Dem könnte man imErwachsenenstrafrecht ohne weiteres zustimmen. Die Gegenargumente, Adressaten würdenungleich getroffen, weil sie unterschiedlich stark auf Mobilität angewiesen seien, <strong>das</strong> Verbotentbehre zudem eines Sinnzusammenhangs zwischen Straftat und Motorisierung, sind nichtdurchgreifend, denn auf berufliches Angewiesensein kann Rücksicht genommen werden;bisherige Hauptstrafen, wie Geld- und Freiheitsstrafen, lassen gleichfalls nicht unmittelbareSinnzusammenhänge erkennen und treffen Menschen ebenfalls ungleich. Im Übrigen könnenGerichte Strafen individuell auswählen und bemessen. Als jugendstrafrechtliche Sanktionwäre ein Fahrverbot aber eventuell kontraproduktiv angesichts besonders großer Anreize desFahrens als Statussymbols Erwachsener; junge Straffällige würden so womöglich in eineSanktionseskalation oder „Strafbarkeitsfalle“ gelockt. 333. Vor allem wird gelegentlich aus der Praxis und in Anträgen von CDU/CSU vorgeschlagen,den nach geltendem Recht unzulässigen „Einstiegs-Jugendarrest“ bei Entscheidungen nach§§ 27, 21 JGG über die Aussetzung der Verhängung oder Vollstreckung einer Jugendstrafezur Bewährung als zusätzliche Maßnahme einzuführen. 34 Er könne dem Verurteilten denErnst der Bestrafung verdeutlichen, Missverständnissen von einem „Freispruch aufBewährung“ entgegenwirken, die Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe fördern undeinen präventiven Vorgeschmack auf dauerhaften Freiheitsentzug geben, gleichzeitig Schäden30 Walter <strong>DVJJ</strong>-J 2001, 358, dort Nachw. Fn. 78, 79; im Grundsatz auch H.-J. Albrecht DJT-Gutachten o. Fn. 4,11.3.3/4.31 H.-J. Albrecht, wie Fn. 30.32 Bay. u. Ba-Wü., Meck.-Vorp.: BR-Drucks. 564/00, 637/00, 759/00.33 Ostendorf u. a., Nachw. b. H.-J. Albrecht o. Fn. 4, 11.2 (Fn. 515).34 Z. B. Bandemer ZBlJR 90, 421; Hinz ZRP 2001, 106, 111 f.; BR-Drucks. 449/99, 549/00, 564/00; BT-Drucks.14/3189.
15längerer Inhaftierung vermeiden. Er wird indes – mit Recht – von großen Teilen der Praxisund Wissenschaft abgelehnt. 35Abschrecken kann Kurzinhaftierung allenfalls kurzfristig und auch nur dann, wenn sie nachdem bei uns längst überholten „short sharp shock“-Konzept gestaltet ist. Neuerliche Versuchein anderen Ländern mit entsprechenden „drill-“ oder „boot camps“ scheinen gerade nicht dengewünschten Erfolg zu bringen. 36 „Taste of prison“ kann zu freilich nur kurzfristigabschreckenden, ebenso zu Gewöhnungseffekten („Statt abzuschrecken, hat der Arrest dazubeigetragen, dem Gefängnis den Schrecken zu nehmen“ 37 ) führen, ferner zu Bockigkeit oderGleichgültigkeit („sitze ich auf einer Backe ab“). Ohnehin sollte der Dauer-Jugendarrestinsgesamt tendenziell weiter zu einem sozialen Trainingskurs ausgestaltet werden. Kurzhaftbedeutet immer auch „ein Bisschen“ Inhaftierung, Lernen von anderen Inhaftierten, Stigmavon „Knast“, Subkulturerfahrung. Der Einstiegsarrest folgt übrigens nicht dem Urteil, schongar nicht der Tat „auf dem Fuße“, fällt vielmehr mit etwa einem Jahr Abstand zur Tat mittenin die schon begonnene Bewährungsarbeit und belastet diese. 38 Den „Ernst der Lage“ zuverdeutlichen eignet sich notfalls besser eine Arbeitsauflage. Sinn von Bewährung zuerläutern und subkultureller Gegeninformation („Freispruch“) zu begegnen, erfordert imÜbrigen die überlegte persönliche Erläuterung durch Gericht und Bewährungshilfe, nichtdagegen Freiheitsentzug.4. Dass die Jugendstrafe in ihrer erzieherischen Konzeption beizubehalten ist, wurde schondargelegt. Im Detail sind indes die Anknüpfungsbegriffe „schädliche Neigungen“ und„Schwere der Schuld“ in § 17 JGG seit langem kritischen Einwänden ausgesetzt und zuersetzen. 39 Jugendstrafe darf sich nicht allein auf schädliche Neigungen, also den Charakterder Tat als Symptom fehlgelaufener und prognostisch ungünstig erscheinender Entwicklungstützen. Das wäre ein Verstoß gegen <strong>das</strong> Schuldprinzip. Auch dürfen diese „Neigungen“ nichtGrund für eine höhere Strafzumessung sein. Das Diagnose- und Prognosekriterium istallerdings samt der Möglichkeit, aus erzieherischen Gründen unter dem schuldangemessenen35 Z. B. <strong>DVJJ</strong>-Stellungn. ZfJ 2001, 97; H.-J. Albrecht DJT-Gutachten o. Fn. 4, 4.7, 11.2; Höynck/Sonnen ZRP2001, 245, 248; Ostendorf o. Fn. 5, Grdl. zu §§ 13 – 16 Rn 9; Schaffstein/Beulke o. Fn. 5, 171 f; Walter o. Fn. 2.36 Pool/Slavick Boot camps: The Washington State update and overview of national findings, Olympia 1995;Sherman et al. Preventing Crime, 1998; weitere Nachw. b. H.-J. Albrecht, wie o. Fn. 33.37 Schumann, ZfR 1986, 367.38 So schon Pfeiffer MschrKrim 1981, 32; Ostendorf MschrKrim 1995, 364; Schwegler Dauerarrest alsErziehungsmittel für junge Straftäter, 1999, 279.39 H. L. Vgl. z. B. <strong>DVJJ</strong>-J 1992, 4; 1998, 295; 2001, 343; H.-J. Albrecht o. Fn. 4; Ostendorf o. Fn. 5, Grdl. zu §§17 u. 18, jew. m. Nachw. A. A. Dölling in ders. (Hrsg.), Das Jugendstrafr. an d. Wende zum 21. Jahrh., 2001, 21,193.
16Strafmaß zu bleiben, in eine eigene Strafzumessungsvorschrift einzufügen. 40 Diese müsstezugleich die Schuld allgemein zur Grundlage der Strafzumessung bestimmen und dieSubsidiarität der Jugendstrafe gegenüber Jugendarrest und ambulanten Maßnahmenhervorheben, wenn es sich nicht um ausnahmsweise schwere Taten mit entsprechenderVorwerfbarkeit handelt. Zudem wären weitere Bemessungskriterien analog §§ 46, 46 a StGBeinzufügen. Zu widersprechen ist dem Vorschlag, ein eigenes System jugendgemäßerStrafrahmen zu entwickeln. 41 Das ginge schon deswegen nicht, weil die Rechtsfolgen imJugendrecht stärker täterorientiert, relativ offen, vielfältig und erzieherisch konzipiert sind;außerdem widerspräche es dem genannten Subsidiaritäts- oder ultima-ratio-Charakter derJugendstrafe sowie der sinnvollen Rechtsfolgenbündelung nach dem Einheitsprinzip des § 31JGG. „Vorbewährung“ – von der Praxis i. R. d. § 57 JGG entwickelt – sollte entgegen demGutachten von Albrecht 42 sogar gesetzlich festgeschrieben werden als „letzte Chance“ voreiner Jugendstrafvollstreckung. Die gegen Möglichkeiten individualprognostischenErkenntnisgewinns durch Vorbewährungszeiten vorgebrachten Argumente überzeugen nicht;sie beträfen alle Bewährungsentscheidungen gleichermaßen; sie lassen sich entkräften durchBeispiele positiver Erfahrung, etwa der Entfernung vom Drogenmilieu und –konsum, belegtdurch engmaschige Urintests, oder der nach dem Urteil erfolgreich eingeleiteten Behandlungentwicklungsbezogener Sexualdelinquenz. Die Bewährungsaussetzung sollte nach denVoraussetzungen des § 21 I JGG generell für Jugendstrafen bis zu 2 oder 3 Jahren vorgesehenwerden. Wirksame Bewährungshilfe setzt indes nach ausländischen Vorbildern voraus, dieProbandenzahlen je Bewährungshelfer von 60 – 90 drastisch auf 20 – 30 (wie z. B. inKanada) herabzusetzen, Bewährungszeiten zu kürzen und zu intensivieren. An dererzieherischen Gestaltung des Jugendstrafvollzugs ist entschieden festzuhalten. Dies sollte ineinem überfälligen JStrVollzG betont werden. Die unter erzieherischen Gesichtspunktenfrüheren Strafrestaussetzungsmöglichkeiten des § 88 JGG sollten verbindlicher formuliertwerden, da sich gegen <strong>das</strong> Gesetz eine Anpassung an die 2/3-Praxis im Erwachsenenrechtherausgebildet hat.40 Nur insoweit folge ich H.-J. Albrecht DJT-Gutachten o. Fn. 4, 6.2.4.41 So aber H.-J. Albrecht o. Fn. 4, 6.2.5.42 H.-J. Albrecht o. Fn. 4, 11.3.7.