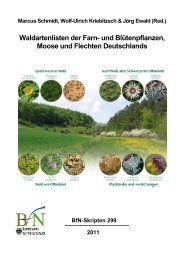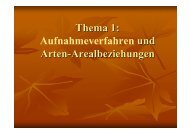Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen ...
Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen ...
Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schwermetallvegetation</strong>, <strong>Bergbau</strong> <strong>und</strong> <strong>Hüttenwesen</strong> <strong>im</strong> <strong>westlichen</strong> Geopark Harz<br />
den Geröllflächen <strong>und</strong> Wiesen wachsen noch auf 1 St<strong>und</strong>e Entfernung vom Flusse die<br />
beiden Charakterpflanzen des Harzes, Alsine verna <strong>und</strong> Armeria Halleri <strong>im</strong> Diluvium bis<br />
Ringelhe<strong>im</strong> …“ (S. 304), also bis gut 10 km vom Harzrand entfernt. Es ist demnach<br />
davon auszugehen, dass Schwermetallfluren noch zu Beginn des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>im</strong><br />
Harz <strong>und</strong> seinem Vorland in großer Ausdehnung vorhanden waren. Hellwig (2002)<br />
beschreibt auch umfangreichere Bestände <strong>im</strong> Innerstetal bei Grasdorf oberhalb Hildeshe<strong>im</strong>.<br />
Die floristische Eigenart <strong>und</strong> Ähnlichkeit der Schwermetallrasen macht es<br />
sinnvoll, alle Bestände, die wenigstens einen der drei genannten Metallophyten besitzen,<br />
<strong>im</strong> Harz zu einer Assoziation zusammenzufassen. Es ist dies das schon frühzeitig<br />
beschriebene Armerietum halleri Libbert 1930. Teilweise lassen sich bereits kleinräumig<br />
mehr oder weniger deutliche Vegetationsunterschiede erkennen, die als verschiedene<br />
Subassoziationen <strong>und</strong> Varianten eingestuft werden können.<br />
4.2 Die Galmeigrasnelken-Gesellschaft<br />
(Armerietum halleri Libbert 1930) <strong>im</strong> Harz<br />
Die Galmeigrasnelken-Gesellschaft (botanisch Armerietum halleri) ist die charakteristische<br />
Pflanzengesellschaft auf alten Abraum- <strong>und</strong> Schlackenhalden früherer <strong>Bergbau</strong>-<br />
<strong>und</strong> Verhüttungsbetriebe <strong>und</strong> anderen mit Schlacken durchsetzten Substraten<br />
mit hohen Gehalten an Schwermetallen sowie auf durch Pochsande kontaminierten<br />
Flussschottern <strong>im</strong> Harz <strong>und</strong> seinem Vorland. Vor allem <strong>im</strong> Nordwestteil des Harzes gibt<br />
es noch ein weit gespanntes Netz kleinerer <strong>und</strong> größerer Stellen mit hohen Schwermetallgehalten<br />
inmitten „normaler“ Ausprägungen von Grasland bis zu Laubwäldern<br />
<strong>und</strong> Fichtenforsten. Es gibt aber heute nur noch wenige Flächen, wo das Armerietum<br />
in guter Ausbildung zu finden ist. Oft lassen sich nur noch einzelne Pflanzen erkennen,<br />
die auf Schwermetallstandorte hinweisen. Gut ausgebildet <strong>und</strong> teilweise großflächiger<br />
ist das Armerietum halleri vor allem auf den Schotterebenen von Innerste <strong>und</strong><br />
Oker zu finden. Wie Wuchsstörungen mit Chlorosen in den angrenzenden Getreideäckern<br />
erkennen lassen, reichen die Kontaminationen teilweise weit über den heutigen<br />
Bereich der Schwermetallrasen hinaus (Drude 1902). Auch die in diesen Bereichen<br />
liegenden Haldenreste zeigen gut differenzierte Bestände. Dagegen ist das Armerietum<br />
halleri auf Schlackenplätzen in den engen Harztälern nur noch selten weiträumig<br />
vorhanden. Ausgedehntere Bestände gibt es außerdem auf den Bergwerkshalden bei<br />
Lautenthal (Kap. 5.8).<br />
Die folgende Beschreibung beginnt mit einer sehr artenarmen Pionierphase <strong>und</strong> endet<br />
mit dichten, bereits in floristischer Degeneration befindlichen, wiesenartigen Beständen<br />
des Armerietum halleri. Bedingt durch unterschiedliche Nährstoff- <strong>und</strong> Wasserversorgung<br />
der Standorte sowie durch verschiedene Schwermetallkonzentrationen lassen<br />
sich nach Dierschke & Becker (2008) eine Pionierphase (die nicht zur eigentlichen Assoziation<br />
gehört) sowie drei Untergesellschaften der Galmeigrasnelken-Gesellschaft<br />
unterscheiden (s. a. Ernst 1974):<br />
Taubenkropfle<strong>im</strong>kraut-Pionierphase auf Halden aus grobem, durchlässigem Gesteins<strong>und</strong><br />
Schlackenmaterial. Als erster Pionier der Phanerogamen tritt hier meist Silene<br />
16<br />
BNS_2011_Band_10_001-148_CS4.indd 16 30.08.11 12:47