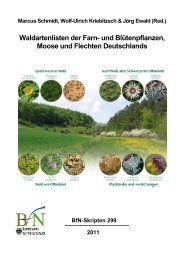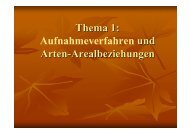Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen ...
Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen ...
Schwermetallvegetation, Bergbau und Hüttenwesen im westlichen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schwermetallvegetation</strong>, <strong>Bergbau</strong> <strong>und</strong> <strong>Hüttenwesen</strong> <strong>im</strong> <strong>westlichen</strong> Geopark Harz<br />
In der ehemaligen freien Bergstadt Lautenthal wurde vom Anfang des 13. bis Mitte des<br />
20. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>Bergbau</strong> betrieben. Ein abbauwürdiges Erzvorkommen war auf etwa<br />
2 km Länge <strong>im</strong> Bereich zwischen Bromberg <strong>und</strong> Kranichsberg vorhanden. Die wichtigsten<br />
Erze waren silberhaltiger Bleiglanz <strong>und</strong> Zinkblende, daneben fanden sich die<br />
nicht nutzbaren Minerale Kalkspat <strong>und</strong> Quarz. Das Grubengelände wurde über mehrere<br />
Schächte am Kranichsberg aufgeschlossen <strong>und</strong> der Abbau erfolgte unter Tage bis<br />
in eine Tiefe von zuletzt r<strong>und</strong> 1.000 m. Um die Kunst- <strong>und</strong> Kehrräder der Schächte mit<br />
Antriebswasser zu versorgen, wurde nach <strong>und</strong> nach ein aufwendiges System von Teichen<br />
<strong>und</strong> Gräben geschaffen. Die Erze wurden zunächst in Pochwerken an der Innerste<br />
aufbereitet, wo das Gestein mittels Wasserkraft zerkleinert <strong>und</strong> anschließend per Hand<br />
sortiert wurde. Vor r<strong>und</strong> 100 Jahren entstand dann am Hang des Kranichsbergs eine<br />
modernere maschinelle Aufbereitungsanlage. Die nicht nutzbaren Nebengesteine <strong>und</strong><br />
Minerale verblieben hier in Abraumhalden, wogegen das nutzbare Konzentrat in der bis<br />
1967 betriebenen Lautenthaler Silberhütte zu Silber <strong>und</strong> Blei, später auch zu Zink <strong>und</strong><br />
Kupfer verarbeitet wurde. Aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte 1930 die Betriebseinstellung,<br />
doch noch bis 1956 erfolgten verschiedene Erk<strong>und</strong>ungsarbeiten <strong>im</strong> Bergwerk.<br />
Nachdem diese keine wirtschaftlich nutzbaren Erzvorkommen mehr ergaben, wurde<br />
das Bergwerk endgültig geschlossen. Die alten Halden wurden von 1950 −1957 <strong>und</strong><br />
1971 −1975 abgetragen <strong>und</strong> in die Aufbereitung des Erzbergwerks Bad Gr<strong>und</strong> gebracht.<br />
Heute führt ein mit zahlreichen Schautafeln versehener <strong>Bergbau</strong>-Lehrpfad durch das<br />
Gebiet (nach Baumann 2009).<br />
Der schutzwürdige FFH-Lebensraumtyp 6130 (Schwermetallrasen) ist hier die Gr<strong>und</strong>lage<br />
des FFH-Gebietes „Schwermetallrasen bei Lautenthal“ (NI-144, EU-Melde-<br />
Nr. 4127 −301). Im Südwesten des Gebietes befindet sich ein großer zusammenhängender,<br />
nordexponierter Schwermetallrasen. Vermutlich hat man die Halden in diesem<br />
Bereich zwischen 1971 <strong>und</strong> 1975 abgetragen <strong>und</strong> auf diese Weise ein natürlich anmutendes<br />
Geländeprofil hergestellt. Die Vegetation hat sich seitdem offenbar ungestört<br />
entwickelt. Der resultierende Schwermetallrasen ist lückig, flechten- <strong>und</strong> moosreich<br />
<strong>und</strong> auch reich an allen kennzeichnenden Gefäßpflanzen <strong>und</strong> damit sehr typisch entwickelt.<br />
Der Bestand der Frühlingsmiere (Minuartia verna ssp. hercynica) ist so groß, dass<br />
der Hang zur Blütezeit weißlich überlaufen erscheint. Die Galmei-Grasnelke (Armeria<br />
marit<strong>im</strong>a ssp. halleri) kommt dagegen nur an weniger geneigten, besser wasserversorgten<br />
Stellen zur Massenentfaltung. Derzeit ist keine Tendenz zur Vergrasung oder<br />
Verbuschung erkennbar, was sicher auf dem geringen Alter des Schwermetallrasens<br />
in Verbindung mit der steilen Hanglage beruht. Allerdings grenzen Pionierwälder mit<br />
Weiden, Birken <strong>und</strong> Fichten an den Rasen an, so dass ein erhebliches Samenpotential<br />
gegeben ist. Zum längerfristigen Offenhalten ist ein (nicht zu intensives) Betreten<br />
durch Besucher gr<strong>und</strong>sätzlich positiv zu sehen.<br />
Weitere Teilflächen des Gebietes weisen ältere Abraumhalden in verschiedenen Ebenen<br />
<strong>und</strong> mit wechselnden Expositionen auf. Die dadurch resultierende große standörtliche<br />
Vielfalt spiegelt sich auch in der Vegetation wider: Die Steilhänge sind durch<br />
Rutschungen nahezu vegetationsfrei, mäßig geneigte Hänge von lückigen <strong>und</strong> Verebnungen<br />
von meist geschlossenen Schwermetallrasen bewachsen. In kleinen Senken<br />
haben sich Grasfluren entwickelt. Das Aufkommen von Fichten ist hier vielerorts stark<br />
<strong>und</strong> wird durch die überwiegende Nordexposition mit seinem feuchteren Mikrokl<strong>im</strong>a<br />
34<br />
BNS_2011_Band_10_001-148_CS4.indd 34 30.08.11 12:48