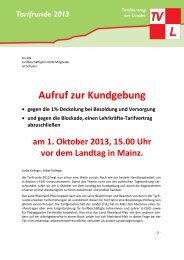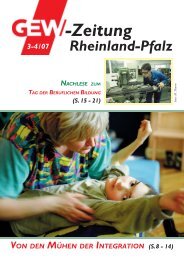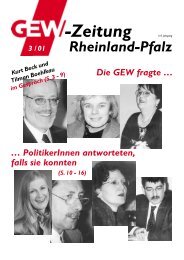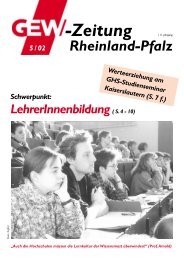GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
GEW-ZEITUNG Rheinland-Pfalz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schulen<br />
Integration darf nicht mit der Grundschule enden<br />
Positionspapier von <strong>GEW</strong> und LAG „Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen“<br />
Anlässlich eines Arbeitstreffens von<br />
VertreterInnen der <strong>GEW</strong> und der<br />
Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam<br />
Leben - Gemeinsam Lernen“<br />
<strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> e.V. (LAG) haben<br />
die beiden Organisationen ein Positionspapier<br />
verabschiedet.<br />
In elf rheinland-pfälzischen Grundschulen<br />
wird seit dem Schuljahr 1997/98<br />
nach dem Folgekonzept gearbeitet, nachdem<br />
dort einer der beiden Schulversuche<br />
„Gemeinsamer Unterricht von Kindern<br />
mit und ohne Beeinträchtigungen“ bzw.<br />
die „Lern- und Spielschule“ ausgelaufen<br />
ist. Die elf Grundschulen befinden sich<br />
mit diesem Konzept jetzt im vierten Jahr.<br />
Die Erfahrungen an den Schulen haben<br />
gezeigt, dass die personelle Ausstattung<br />
nicht ausreicht, um dem integrativen<br />
Auftrag nachzukommen und die Integration<br />
behinderter Kinder zu sichern.<br />
Aufgrund dieser Situation fordern LAG<br />
und <strong>GEW</strong> die Landesregierung auf, die<br />
für die Schulen notwendigen Voraussetzungen<br />
für Integration zu schaffen. Zentrale<br />
Forderungen in ihrem Positionspapier<br />
sind: Folgekonzeptschulen brauchen<br />
mehr Stunden von SonderpädagogInnen;<br />
sie brauchen flexible Rahmenbedingungen;<br />
in <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> muss ein flächendeckendes<br />
Angebot an Schulen, die<br />
gemeinsamen Unterricht anbieten, aufgebaut<br />
werden; die Integration darf nicht<br />
mit der Grundschule enden, sondern ist<br />
in der Sekundarstufe I fortzuführen; alle<br />
Beteiligten müssen ausreichend informiert<br />
sein.<br />
gebots für gemeinsamen Unterricht.<br />
Das Recht behinderter Kinder auf gemeinsames<br />
Lernen mit nicht behinderten<br />
MitschülerInnen muss in einer vertretbaren<br />
Zeitspanne im gesamten Land<br />
umgesetzt werden. Wir fordern daher ein<br />
flächendeckendes Angebot an Schulen,<br />
die gemeinsamen Unterricht anbieten.<br />
Hierzu sind „Schwerpunktschulen“ einzurichten,<br />
die für beeinträchtigte Kinder<br />
in einer angemessenen Fahrzeit erreichbar<br />
sind.<br />
Keine Begrenzung des gemeinsamen<br />
Unterrichts auf bestimmte Klassenstufen.<br />
Integration ist ein lebenslanger Prozess.<br />
Deshalb darf Integration nicht mit der<br />
Grundschule enden und nicht davon<br />
abhängig gemacht werden, dass der Abschluss<br />
der Regelschule erreicht werden<br />
kann. Das pädagogische Prinzip des zieldifferenten<br />
Unterrichts muss für die gesamte<br />
Schullaufbahn angewandt werden.<br />
Es müssen Konzepte entwickelt werden,<br />
wie gemeinsamer Unterricht von beeinträchtigten<br />
und nicht beeinträchtigten<br />
Kindern auch in der Sekundarstufe I<br />
außerhalb von Schulversuchen fortgeführt<br />
werden kann.<br />
Integration muss in einem für alle<br />
Beteiligten verlässlichen Rahmen<br />
stattfinden.<br />
Hierzu gehören Information aller Beteiligten<br />
und Konstanz: An den Übergangsstellen<br />
innerhalb des Schulsystems, d.h.<br />
beim Wechsel vom Kindergarten zur<br />
Grundschule und von der Grundschule<br />
zur Sekundarstufe I wird eine Fortführung<br />
der Integration häufig blockiert. Eltern<br />
beeinträchtigter Kinder müssen<br />
rechtzeitig vor der Schulanmeldung über<br />
integrative Angebote informiert werden<br />
(Informationssicherheit). Schulen müssen<br />
frühzeitig Informationen darüber haben,<br />
welche sonderpädagogischen Ressourcen<br />
für beeinträchtigte Kinder zu Verfügung<br />
gestellt werden (Planungssicherheit für<br />
die Schulen). Eine Überweisung eines beeinträchtigten<br />
Kindes an eine Sonderschule<br />
darf nicht ohne das Einverständnis<br />
der Eltern erfolgen (Zukunftssicherheit<br />
für Eltern und Kinder).<br />
Integration ist ein zentrales Thema<br />
der Schulentwicklung.<br />
Jede Schule hat sich der Frage zu stellen,<br />
welchen Stellenwert sie der Integration<br />
Die Forderungen im Einzelnen:<br />
Folgekonzeptschulen brauchen mehr<br />
sonderpädagogische Ressourcen.<br />
Folgekonzeptschulen sollen alle Kindes<br />
der Einzugsgebietes ungeachtet ihrer Beeinträchtigungen<br />
aufnehmen und fördern.<br />
Für eine verantwortbare Integration<br />
reichen die sonderpädagogischen<br />
Ressourcen, die den Schulen zugewiesen<br />
werden, nicht aus. Die derzeitige personelle<br />
Ausstattung fördert eher eine integrationshemmende<br />
resignative Haltung<br />
an den Schulen. Wir fordern daher, die<br />
personelle Grundausstattung aufzustokken.<br />
Kinder dürfen nicht erst als behindert<br />
etikettiert werden, um ihnen dann<br />
in oft mühseligen Einzelentscheidungen<br />
zusätzliche Förderstunden zu gewähren.<br />
Keine regionale Begrenzung des Anim<br />
Rahmen ihres Schulprofils einräumen<br />
will. Bei diesem Klärungsprozess brauchen<br />
Schulen Information und Unterstützung<br />
durch eine Koordinierungsstelle, damit<br />
Ängste und Vorbehalte abgebaut und ein<br />
von möglichst vielen getragenes Selbstverständnis<br />
von Integration geschaffen werden<br />
kann.<br />
Folgekonzeptschulen brauchen flexible<br />
Rahmenbedingungen.<br />
Für Klassen, in denen beeinträchtigte<br />
Kinder unterrichtet werden, muss die offizielle<br />
Klassenmesszahl auf 18 SchülerInnen<br />
abgesenkt werden, um die Kontinuität<br />
in der pädagogischen Arbeit zu sichern,<br />
muss den Schülern ein Mitspracherecht bei<br />
der Zuweisung der Lehrkräfte an ihre<br />
Schule eingeräumt werden; Sonderschullehrkräfte<br />
sollten an die Regelschule versetzt<br />
und nicht abgeordnet werden. Da<br />
gemeinsamer Unterricht ohne eine zeitaufwendige<br />
Kooperation der Lehrkräfte<br />
untereinander unmöglich ist, sind Anteile<br />
für die Kooperation in das Stundendeputat<br />
aufzunehmen. Dies sind wichtige<br />
Steuerungselemente für Schulen, um auf<br />
die Besonderheiten vor Ort angemessen<br />
reagieren zu können.<br />
Die Vereinzelung und Isolierung der<br />
Folgekonzeptschulen muss aufgehoben<br />
werden.<br />
Folgekonzeptschulen müssen untereinander<br />
u.a. über die regionale Fachberatung<br />
vernetzt werden. Wir fordern den Erhalt<br />
und den Ausbau der regionalen Fachberatung<br />
und den Aufbau einer Integrationsberatungsstelle,<br />
in der die Informationen<br />
aus den Schulen gebündelt und Erfahrungen<br />
im Sinne einer Qualitätsentwicklung<br />
ausgewertet werden und die ihrerseits<br />
mit innovativen Ansätzen in die<br />
Schulen hinein wirkt.<br />
Konzeptuelle Verknüpfung von Schulsozialarbeit<br />
und Integration.<br />
Folgekonzeptschulen sind häufig an sozialen<br />
Brennpunkten mit deren spezifischen<br />
Problemstellungen angesiedelt. Wir fordern<br />
daher eine stärkere Einbindung der<br />
Schulsozialarbeit und ein verstärktes Angebot<br />
von Ganztagsschulen mit den entsprechenden<br />
Betreuungsangeboten. Eine<br />
Konzentration von Folgekonzeptschulen<br />
in sozialen Brennpunkten ist aber zu vermeiden,<br />
da Integration eine von allen gesellschaftlichen<br />
Gruppen gleichermaßen<br />
zu leistende Arbeit ist.<br />
14 <strong>GEW</strong>-Zeitung <strong>Rheinland</strong>-<strong>Pfalz</strong> 12 / 00