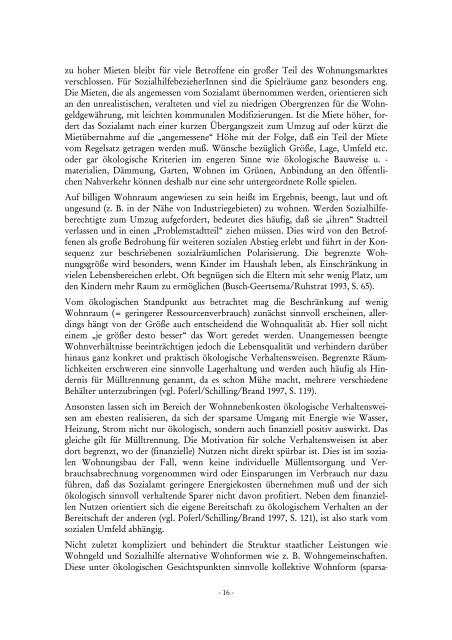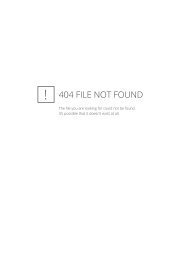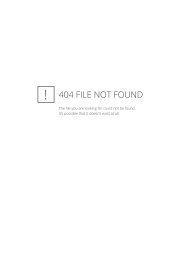Neue Armut und ökologische Verhaltensmöglichkeiten. - WZB
Neue Armut und ökologische Verhaltensmöglichkeiten. - WZB
Neue Armut und ökologische Verhaltensmöglichkeiten. - WZB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zu hoher Mieten bleibt für viele Betroffene ein großer Teil des Wohnungsmarktes<br />
verschlossen. Für SozialhilfebezieherInnen sind die Spielräume ganz besonders eng.<br />
Die Mieten, die als angemessen vom Sozialamt übernommen werden, orientieren sich<br />
an den unrealistischen, veralteten <strong>und</strong> viel zu niedrigen Obergrenzen für die Wohngeldgewährung,<br />
mit leichten kommunalen Modifizierungen. Ist die Miete höher, fordert<br />
das Sozialamt nach einer kurzen Übergangszeit zum Umzug auf oder kürzt die<br />
Mietübernahme auf die „angemessene“ Höhe mit der Folge, daß ein Teil der Miete<br />
vom Regelsatz getragen werden muß. Wünsche bezüglich Größe, Lage, Umfeld etc.<br />
oder gar <strong>ökologische</strong> Kriterien im engeren Sinne wie <strong>ökologische</strong> Bauweise u. -<br />
materialien, Dämmung, Garten, Wohnen im Grünen, Anbindung an den öffentlichen<br />
Nahverkehr können deshalb nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen.<br />
Auf billigen Wohnraum angewiesen zu sein heißt im Ergebnis, beengt, laut <strong>und</strong> oft<br />
unges<strong>und</strong> (z. B. in der Nähe von Industriegebieten) zu wohnen. Werden Sozialhilfeberechtigte<br />
zum Umzug aufgefordert, bedeutet dies häufig, daß sie „ihren“ Stadtteil<br />
verlassen <strong>und</strong> in einen „Problemstadtteil“ ziehen müssen. Dies wird von den Betroffenen<br />
als große Bedrohung für weiteren sozialen Abstieg erlebt <strong>und</strong> führt in der Konsequenz<br />
zur beschriebenen sozialräumlichen Polarisierung. Die begrenzte Wohnungsgröße<br />
wird besonders, wenn Kinder im Haushalt leben, als Einschränkung in<br />
vielen Lebensbereichen erlebt. Oft begnügen sich die Eltern mit sehr wenig Platz, um<br />
den Kindern mehr Raum zu ermöglichen (Busch-Geertsema/Ruhstrat 1993, S. 65).<br />
Vom <strong>ökologische</strong>n Standpunkt aus betrachtet mag die Beschränkung auf wenig<br />
Wohnraum (= geringerer Ressourcenverbrauch) zunächst sinnvoll erscheinen, allerdings<br />
hängt von der Größe auch entscheidend die Wohnqualität ab. Hier soll nicht<br />
einem „je größer desto besser“ das Wort geredet werden. Unangemessen beengte<br />
Wohnverhältnisse beeinträchtigen jedoch die Lebensqualität <strong>und</strong> verhindern darüber<br />
hinaus ganz konkret <strong>und</strong> praktisch <strong>ökologische</strong> Verhaltensweisen. Begrenzte Räumlichkeiten<br />
erschweren eine sinnvolle Lagerhaltung <strong>und</strong> werden auch häufig als Hindernis<br />
für Mülltrennung genannt, da es schon Mühe macht, mehrere verschiedene<br />
Behälter unterzubringen (vgl. Poferl/Schilling/Brand 1997, S. 119).<br />
Ansonsten lassen sich im Bereich der Wohnnebenkosten <strong>ökologische</strong> Verhaltensweisen<br />
am ehesten realisieren, da sich der sparsame Umgang mit Energie wie Wasser,<br />
Heizung, Strom nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell positiv auswirkt. Das<br />
gleiche gilt für Mülltrennung. Die Motivation für solche Verhaltensweisen ist aber<br />
dort begrenzt, wo der (finanzielle) Nutzen nicht direkt spürbar ist. Dies ist im sozialen<br />
Wohnungsbau der Fall, wenn keine individuelle Müllentsorgung <strong>und</strong> Verbrauchsabrechnung<br />
vorgenommen wird oder Einsparungen im Verbrauch nur dazu<br />
führen, daß das Sozialamt geringere Energiekosten übernehmen muß <strong>und</strong> der sich<br />
ökologisch sinnvoll verhaltende Sparer nicht davon profitiert. Neben dem finanziellen<br />
Nutzen orientiert sich die eigene Bereitschaft zu <strong>ökologische</strong>m Verhalten an der<br />
Bereitschaft der anderen (vgl. Poferl/Schilling/Brand 1997, S. 121), ist also stark vom<br />
sozialen Umfeld abhängig.<br />
Nicht zuletzt kompliziert <strong>und</strong> behindert die Struktur staatlicher Leistungen wie<br />
Wohngeld <strong>und</strong> Sozialhilfe alternative Wohnformen wie z. B. Wohngemeinschaften.<br />
Diese unter <strong>ökologische</strong>n Gesichtspunkten sinnvolle kollektive Wohnform (sparsa-<br />
- 16 -