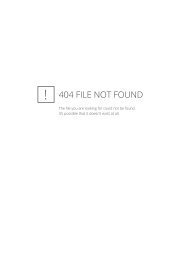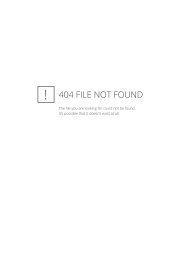Neue Armut und ökologische Verhaltensmöglichkeiten. - WZB
Neue Armut und ökologische Verhaltensmöglichkeiten. - WZB
Neue Armut und ökologische Verhaltensmöglichkeiten. - WZB
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zusammenfassung<br />
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die einhergehen mit sinkenden Arbeitnehmereinkommen,<br />
Massenarbeitslosigkeit sowie einer wachsenden Anzahl von Alleinerziehenden,<br />
führen dazu, daß ein erheblicher Anteil der Bevölkerung dauerhaft oder<br />
zeitweise von <strong>Armut</strong> betroffen ist. Von <strong>Armut</strong> betroffene Menschen sind in ihrer<br />
materiellen Lebenssituation <strong>und</strong> ihrem Zugang zu Konsum, ihren Handlungsspielräumen<br />
sowie ihren sozialen <strong>und</strong> kulturellen Möglichkeiten erheblich eingeschränkt.<br />
Parallel zu diesen gesellschaftlichen Veränderungen sind wir mit der fortschreitenden<br />
Zerstörung unserer Umwelt konfrontiert, die eine Veränderung der Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Lebensweise notwendig macht. So wird seit dem Umweltgipfel in Rio 1992 das Konzept<br />
der „nachhaltigen Entwicklung“ debattiert. Das in diesem Rahmen entwickelte<br />
Leitbild, das sich an die Konsumenten richtet, beruht auf Selbstbegrenzung, Konsumverzicht<br />
<strong>und</strong> Steigerung des immateriellen Wohlstands, was in dem Slogan „Gut<br />
leben statt viel haben“ zum Ausdruck gebracht wird.<br />
<strong>Armut</strong> begünstigt Selbstbegrenzung <strong>und</strong> Konsumverzicht notwendigerweise aufgr<strong>und</strong><br />
materieller Knappheit. Dies könnte aus umweltpolitischer Sicht den Schluß<br />
nahelegen, daß zunehmende <strong>Armut</strong> sich positiv auf die <strong>ökologische</strong> Entwicklung<br />
auswirkt.<br />
Diese Schlußfolgerung ist jedoch nicht zutreffend. Anhand von diversen praktischen<br />
Beispielen aus den einzelnen Lebensbereichen läßt sich belegen, daß <strong>Armut</strong>sbedingungen<br />
überwiegend hinderlich <strong>und</strong> nicht förderlich für <strong>ökologische</strong>s Verhalten sind.<br />
„Nachhaltige Entwicklung“ setzt eine ausreichende existenzielle Absicherung voraus,<br />
auch wenn sich in Ansätzen durch materielle Knappheit <strong>und</strong> erwerbsarbeitsfreie Zeit<br />
alternative nachhaltige Lebensstile entwickeln.<br />
Die unterschiedlichen Perspektiven führen auch auf gesellschaftspolitischer Ebene zu<br />
zahlreichen Konfliktlinien zwischen der sozialpolitischen Forderung nach mehr materieller<br />
Absicherung <strong>und</strong> Wohlstandssteigerung für arme Menschen <strong>und</strong> dem <strong>ökologische</strong>n<br />
Postulat des „weniger ist mehr“. Dennoch zeigen sich bei näherer Betrachtung<br />
durchaus Berührungspunkte.<br />
Summary<br />
Social changes that are marked by decreasing wages, increasing unemployment as well<br />
as a growing number of single parents, have resulted in an ever rising percentage of<br />
the population living in temporary or permanent poverty. Poor people are experiencing<br />
significant restrictions in their material situation and their scope of action along<br />
with limited social and cultural possibilities.<br />
At the same time there has been a debate on the concept of sustainability since the<br />
Environmental Summit in Rio in 1992. Within this discourse the emerging model is<br />
directed towards the consumer and relies on self containment and abstention, which<br />
is signified in the slogan: „Live good rather than own much“.