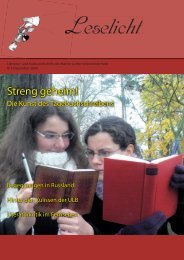2. Ausgabe Leselicht
2. Ausgabe Leselicht
2. Ausgabe Leselicht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?“<br />
Das literarische Tagebuch am Beispiel von Max<br />
Frisch<br />
Was soll das sein, ein ‚literarisches Tagebuch’? Was unterscheidet<br />
es von den unzähligen privaten Tagebüchern, die nicht dieses<br />
Prädikat bekommen? Manfred Jurgensen meint in seiner Studie<br />
„Das fiktionale Ich“, die literarische Aussage „beginnt, wo sich das<br />
Individuum in reflektiver Absicht selbstdarstellerisch gegenübertritt“.<br />
Also ein Dialog mit sich selbst, der nicht nur wahrnimmt,<br />
sondern reflektiert, und darin sich selbst ganz bewusst gestaltet<br />
und präsentiert. Demnach ist ein fremder Rezipient schon mitgedacht,<br />
aus dem Tagebuch-Ich wird eine literarische Figur, ein Es.<br />
Man könnte sagen, es handelt sich um eine Mischform; die der<br />
Verarbeitung täglicher Ereignisse dienenden Notizen werden auf<br />
ein Publikum hin variiert. Die Inhalte können vielfältig sein: Gide<br />
etwa hielt das ihn umgebende Geistesleben fest, Kierkegaard<br />
übte sich in religiöser Erziehung seiner selbst und seiner Leser,<br />
Graf von Platen reflektierte über seine Dichtung und für Kafka<br />
war sein Tagebuch ein Halt, an dem er intensive Selbstexegese<br />
betrieb.<br />
Auch der 1991 verstorbene Schweizer Max Frisch schrieb und<br />
veröffentlichte Tagebücher, jeweils zusammenhängend für die<br />
Ein Fragebogen, aus dem auch der Titel dieses Artikels stammt,<br />
bildet den Auftakt des Tagebuchs. Hier tritt Frisch unmittelbar in<br />
den Dialog mit seinem Leser. Die Fragen beziehen sich auf unser<br />
Sozialverhalten; es geht um Glück und Hoffnung, die Ehe,<br />
Freundschaft, Humor oder das persönliche Verhältnis zu Geld.<br />
Nicht an jeder Frage bleibt man hängen, manche scheitern<br />
daran, dass Frisch ausschließlich an männliche Leser denkt, andere<br />
an bereits implizierten Antworten. Aber an einigen hat man<br />
zu knabbern, auch wenn man das Buch wieder aus der Hand<br />
legt.Ein sich durchziehendes Motiv ist die fiktive „Vereinigung<br />
Freitod“. In den fünf Jahren des Tagebuchs verfolgt sie Frisch<br />
von ihrer Gründung bis zur Fertigstellung eines „Handbuchs<br />
für Mitglieder“. Die Vereinigung hat sich dem Kampf gegen die<br />
Überalterung der Gesellschaft verschrieben; Mitgliedern, die Senilitätserscheinungen<br />
aufweisen, soll durch die Vereinigung die<br />
Empfehlung zum baldigen Freitod ausgesprochen werden. Doch<br />
was für den einzelnen gilt, macht auch vor der Gruppe nicht halt:<br />
Wenn sie wirklich da sind, will man die Zeichen des Verfalls nicht<br />
mehr wahrhaben. Einzig der Verfasser des Handbuchs bleibt der<br />
ursprünglichen Linie halbwegs treu. Im Handbuch führt er dezidiert<br />
Alterserscheinungen der „Gezeichneten“ und auch schon<br />
der „Vor-Gezeichneten“, also der Herren im sogenannten ‚besten<br />
Alter’, auf. Für beide Gruppen sind diese Aufzeichnungen wenig<br />
schmeichelhaft, doch für den Leser – gehöre er nun zu einer der<br />
beiden Gruppen oder (noch) nicht – umso amüsanter.<br />
Erinnerungen an Brecht<br />
Nicht jedes Tagebuch wird für die Schublade geschrieben<br />
Zeiträume 1946-49 und 1966-71. Im jüngeren reflektiert er über<br />
die Ambivalenz zwischen der privaten Form und der öffentlichen<br />
Präsentation: Verletzt er damit Persönlichkeitsrechte, wenn er<br />
über Personen seines privaten Umfelds spricht? Aber wenn er es<br />
nicht tut, verlagern sich unweigerlich Schwerpunkte: Die eigene<br />
Person wird omnipräsent, das Öffentliche überlagert das Private.<br />
Dennoch hat er sich für diesen Weg entschieden.<br />
Foto: Christian Weicholdt<br />
Vieles ist lesenswert an diesem Tagebuch: Die sehr persönlichen<br />
Erinnerungen an die Arbeit mit Brecht. Die Collagen, welche<br />
die Zeitungsberichterstattungen zu zeitpolitischen Themen mit<br />
Frischs Eindrücken kontrastieren und ad absurdum führen. Die<br />
Überlegungen, wie die Dramaturgie der Peripetie unsere Vorstellung<br />
von Lebenswirklichkeit prägt.<br />
All dies ist typisch Max Frisch und geht doch über seine sonstigen<br />
Werke hinaus. Es gelingt ihm, sich zumindest teilweise von seinem<br />
Lebensthema – dem Kampf gegen die Idee von Schicksalhaftigkeit<br />
und die Starre der Persönlichkeit – zu lösen und über<br />
seine Gegenwart zu reflektieren. Frischs Tagebuch ist Zeitdokument,<br />
Einblick in die Persönlichkeit eines Autors, Denkanstoß und<br />
literarisches Werk zugleich – eben ein ‚literarisches Tagebuch‘.<br />
Jana König<br />
Ein Fragebogen als Auftakt<br />
Frischs Tagebuch 1966-71 ist ein buntes Sammelsurium: Fragebögen<br />
und Verhöre finden sich neben literarischen Skizzen<br />
und theoretischen Überlegungen; Gedanken zu Ereignissen wie<br />
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und den 68er Studentenrevolten<br />
neben Eindrücken einer Reise durch Russland.<br />
Durchgängig vermerkt ist nur die Jahreseinteilung, genaue Datumsangaben<br />
sind hingegen selten. Die Vielfalt der Ebenen wurde<br />
in verschiedene Schrifttypen übersetzt.<br />
9