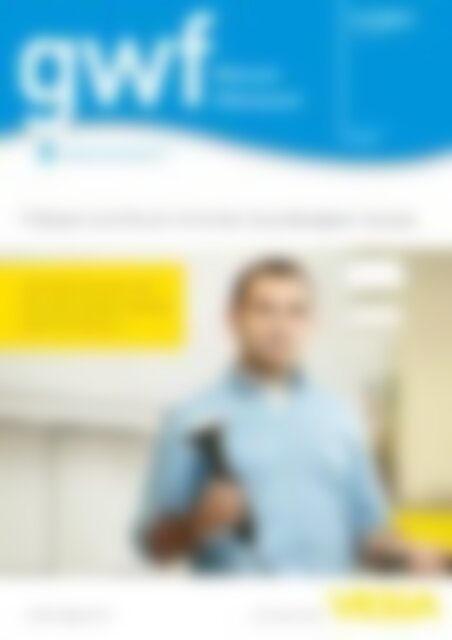gwf Wasser/Abwasser Energieeffizienz rechnet sich! (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
11/2011<br />
Jahrgang 152<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Füllstand und Druck mit hoher Zuverlässigkeit messen.<br />
„Mit VEGA-Sensoren sind<br />
Sie immer auf dem neuesten<br />
Stand der Technik.“<br />
www.vega.com
ð Digitales Manometer mit Speicherfunktion<br />
ð Hohe Messgenauigkeit und Aufl ösung<br />
ð Anzeige des aktuellen Druckes und des<br />
Record-Status im Display<br />
ð Aufzeichnung des Druckes und der<br />
Temperatur<br />
ð Einfache Konfi gurations- und Auslese-<br />
Software für PC oder PDA<br />
ð Messrate und Druckeinheiten<br />
einstellbar<br />
ð Speicher: ca. 57’000 Messwerte<br />
ð Bereiche: 30 mbar…1000 bar<br />
ð Gesamtfehlerband: ±0,1 %FS<br />
ð Auch Ex-geschützte Versionen<br />
ð in unserem E-Shop erhältlich<br />
www.keller-druck.com
Standpunkt<br />
Die Lebenszykluskosten-Betrachtung zeigt’s:<br />
<strong>Energieeffizienz</strong> <strong>rechnet</strong> <strong>sich</strong>!<br />
Obwohl die deutsche Industrie bereits umfangreiche<br />
<strong>Energieeffizienz</strong>-Maßnahmen eingeleitet<br />
hat, sind weiterhin noch große Energieeinsparpotenziale<br />
zu realisieren – zum Beispiel durch Automatisierungstechnik.<br />
Die Frage des Controllers lautet jedoch:<br />
Das ist lediglich gut für die Umwelt, oder vielleicht auch<br />
für den Geldbeutel des Unternehmens?<br />
Um diese Frage korrekt beantworten zu können, ist<br />
ein gewisser Weitblick notwendig. Nicht nur, weil die<br />
Energiepreise voraus<strong>sich</strong>tlich immer weiter steigen werden.<br />
Sondern auch, weil der Grad der <strong>Energieeffizienz</strong><br />
von Geräten und Anlagen durch Entscheidungen in der<br />
Investitionsphase bestimmt wird. Sinnvoll ist daher eine<br />
mittel- bzw. längerfristige Sicht, wie die Lebenszyklus-<br />
Betrachtung. Ein an schauliches Beispiel liefert die <strong>Wasser</strong>aufbereitung.<br />
Zwar spricht u. a. die öffentliche Vergabeverordnung<br />
davon, Lebenszykluskosten bei der<br />
Auswahl zu berück<strong>sich</strong>tigen. Die Realität sieht aber oft<br />
anders aus: Viele öffentliche und private Akteure nutzen<br />
bei der Beurteilung von Investitionsentscheidungen<br />
lediglich den Anschaffungspreis oder die Amortisationszeit<br />
(Pay-off), nicht aber ein Rentabilitätsmaß (z. B.<br />
Barwert) wie in der Lebenszykluskosten-Betrachtung.<br />
Der ZVEI bietet ein mit Deloitte entwickeltes<br />
betriebswirtschaftliches Lebenszykluskosten-Berechnungstool<br />
Lifecycle Cost Evaluation (LCE) an. Es ist<br />
kostenfrei unter www.zvei.org/Lebenszykluskosten<br />
nutzbar und wurde von neun ZVEI-Mitgliedsunternehmen<br />
finanziert. Transparenz bezüglich betriebswirtschaftlicher<br />
Auswirkungen von verschiedenen Effizienzmaßnahmen<br />
steht dabei im Vordergrund: Das Tool<br />
zeigt, welche Option zu den geringeren Gesamtkosten<br />
führt, und quantifiziert die Unterschiede belastbar. Als<br />
Optionen können einzelne Komponenten, aber auch<br />
Komponentenstränge (z. B. drehzahlgeregelte Pumpen,<br />
energieeffiziente Motoren, Sensoren zur Prozessoptimierung)<br />
miteinander verglichen werden. Da es<br />
<strong>sich</strong> um ein rein betriebswirtschaftliches Tool handelt,<br />
ist es nicht auf bestimmte Anwendungen und Technologien<br />
beschränkt, sondern vielfältig in Industrie<br />
und Infrastruktur einsetzbar.<br />
Am konkreten Anwendungsfall der Kläranlage Bachwis<br />
(Schweiz) soll das Berechnungstool veranschaulicht<br />
werden: Zur Auswahl standen die standardmäßige<br />
Modernisierung, bei der der Sauerstoffeintrag im Belebungsbecken<br />
auf Basis einer Zeitsteuerung erfolgt. Die<br />
Alternative war eine energieeffiziente Modernisierung,<br />
bei der der Sauerstoffeintrag auf Grundlage einer kontinuierlichen<br />
Messung des Sauerstoffgehalts mit Hilfe<br />
von Sensoren gesteuert wird. So lässt er <strong>sich</strong> gezielt und<br />
mit weniger Energieeinsatz vornehmen. Letzteres ist die<br />
auf den ersten Blick teurere Variante mit einem um über<br />
50 Prozent höheren Anschaffungspreis. Auch die jährlichen<br />
Wartungskosten sind hier höher. Dafür lässt <strong>sich</strong><br />
jedoch eine erhebliche Menge Energie einsparen. Die<br />
Berechnung über einen betrachteten Anlagenlebenszyklus<br />
von 15 Jahren ergaben insgesamt um 28 Prozent<br />
geringere Energie- und um 21 Prozent geringere<br />
Gesamtkosten. Über den gesamten Lebenszyklus lassen<br />
<strong>sich</strong> etwa 300 000 Euro Kosten sparen. Die vermeintlich<br />
teurere Variante ist also in Wirklichkeit die wesentlich<br />
preiswertere!<br />
Dies ist nur eines von vielen Beispielen, das zeigt:<br />
Energie- und Kosteneffizienz stellen keinen Widerspruch<br />
dar. Konsequente <strong>Energieeffizienz</strong>maßnahmen<br />
sind vielfach die betriebswirtschaftlich bessere Entscheidung.<br />
Die Lebenszykluskosten-Betrachtung zeigt‘s.<br />
Michael Ziesemer<br />
COO Endress+Hauser Consult AG<br />
Vizepräsident des ZVEI und Vorsitzender des<br />
Fachbereichs Messtechnik und Prozessautomatisierung<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 989
INhalt<br />
Arsen, Nickel und Uran erreichen gelegentlich im Rohwasser, das zur Trinkwassergewinnung<br />
genutzt wird, Konzentrationen, die eine Entfernung dieser<br />
Stoffe erforderlich machen. Ab Seite 1070<br />
Zur Abschätzung der Eliminationseffektivität der oberflächennahen tertiären<br />
Sandschichten an einem Brunnenstandort im Lechtal im Sinne des WHO<br />
Water-Safety-Plans wurden Modellversuche mit verschiedenen Mikroorganismen<br />
durchgeführt. Ab Seite 1058<br />
Fachberichte<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
1058 Ch. Treskatis, M. Exner, Ch. Koch und J. Gebel<br />
Bewertung des Rückhaltevermögens<br />
von tertiären Sandschichten<br />
gegenüber mikrobiologischen<br />
Einträgen in Filterrohrsträngen<br />
eines Horizontalfilterbrunnens<br />
Evaluation of the Retention-Potential of tertiary<br />
Sands Towards Microbiological Contaminations<br />
into the Filter Drains of a Horizontal Filter Well –<br />
Model Experiment with Columns Filled with<br />
in-situ-Material<br />
1070 M. Jekel, C. Bahr, V. Schlitt und D. Stetter<br />
Entfernung von Arsen, Nickel und<br />
Uran bei der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
Removal of Arsenic, Nickel and Uranium in<br />
Water Treatment<br />
1080 G. Schneider<br />
Ermittlung der horizontalen und<br />
vertikalen Durchlässigkeitsbeiwerte<br />
aus Pumpversuchen<br />
Determination of the Coefficient of Horizontal<br />
and Vertical Permeability<br />
Tagungsbericht<br />
1090 C. Scholz<br />
Treffpunkt für das <strong>Wasser</strong>fach –<br />
4. Kolloquium der Trinkwasserspeicherung<br />
Meeting Poit fort the Water Supply<br />
Interview<br />
994 DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>:<br />
Praxisforschung für das <strong>Wasser</strong>fach –<br />
<strong>gwf</strong> im Gespräch mit Geschäftsführer<br />
des TZW, Dr. Josef Klinger<br />
Fokus<br />
Messen • Steuern • Regeln<br />
998 SPS/IPC/DRIVES 2011 – Elektrische Automatisierung<br />
– Systeme und Komponenten<br />
999 Moderne Fernwatungstechnik in Kläranlagen<br />
– GO Serie ermöglicht flexiblen<br />
Einsatz<br />
1000 Fernwirken via SCADA – SCADA-System<br />
unterstützt die Integration von Fernwirkanwendungen<br />
1004 Ableitstromproblematiken in der modernen<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
November 2011<br />
990 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Inhalt<br />
Im Interview: Dr. Josef Klinger, Geschäftsführer des DVGW-<br />
Technologie-Zentrums <strong>Wasser</strong>, über die Aufgabenstellung<br />
des TZW für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft. Ab Seite 994<br />
Im Fokus: Automatisierung in der <strong>Wasser</strong>branche.<br />
Ab Seite 998<br />
1006 Horlemann gewährleistet Betriebs<strong>sich</strong>erheit<br />
– Austausch abgekündigter Automatisierungssysteme<br />
ohne Anlagenstillstand<br />
1008 Klären mit moderner Netzwerktechnik<br />
1012 Ein neues Verfahren zur optischen<br />
Erfassung und Bewertung von Flockungseigenschaften<br />
in Klärprozessen (Prozessund<br />
Laboranwendung)<br />
1016 Mobilfunk-basierte Kommunikation in<br />
einer Kläranlage<br />
1019 Industrieabwasser – vermeiden,<br />
überwachen, behandeln<br />
1022 Sonoxide Ultraschallwasserbehandlungssystem<br />
von Ashland<br />
1024 JUMO mTRON T – Your System –<br />
Sichere Messwerterfassung, Regelung<br />
und Automatisierung<br />
1025 Industrielle Breitbandanbindung mit<br />
INSYS icom-Geräten<br />
1026 Online-Messtechnik für schwierigste<br />
<strong>Abwasser</strong>applikationen<br />
1026 Kleinkläranlagensteuerungen mit und<br />
ohne Stromspar-Ventilblock<br />
1027 C3 Compact-Conditon-Controller<br />
Netzwerk Wissen<br />
Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
1036 Studienort Aachen im Porträt<br />
1037 „Mehr als nur gute Karrierechancen“ –<br />
RWTH Aachen startet neuen Studiengang<br />
Umweltingenieurwissenschaften<br />
1038 Umwelt- und Gewässerschutz im Fokus –<br />
Das ISA der RWTH Aachen stellt <strong>sich</strong> vor<br />
1040 Vier Projekte, die etwas bewegen –<br />
Forschungsschwerpunkte des Instituts<br />
für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH<br />
Aachen<br />
1044 Die Führungskraft-Schmiede Deutschlands<br />
– Jedes 5. Vorstandsmitglied kommt von<br />
der RWTH Aachen<br />
1045 RWTH ist Spitzenreiter bei Stipendien<br />
1046 Wo der Quell des Lebens sprudelt – Als<br />
„Stadt des <strong>Wasser</strong>s“ blickt Aachen auf eine<br />
geschichtsträchtige Vergangenheit zurück<br />
1048 Sächsische Forscher arbeiten an <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Brasilias<br />
1049 Netzwerk gegen Umweltprobleme im<br />
Mittelmeerraum – Drohender Klimawandel<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 991
INhalt<br />
Netzwerk Wissen: Der Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Siedlungsabfallwirtschaft<br />
und das Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH<br />
Aachen im Porträt. Ab Seite 1035<br />
Erster Russian-German Water Partnership<br />
Day in Moskau. Seite 1028<br />
1050 Der Bachflohkrebs als Assistent – Eine neue<br />
Studie zeigt, wie Ozonierung <strong>Abwasser</strong><br />
reinigt<br />
Nachrichten<br />
Branche<br />
1028 Sauberes <strong>Wasser</strong> durch deutsch-russische<br />
Kooperation – Erster Russian-German Water<br />
Partnership Day in Moskau<br />
1029 Uferschutz und Ökologie – Internetportal<br />
informiert über technisch-biologische<br />
Ufer<strong>sich</strong>erungen an Binnenwasserstraßen<br />
1030 acqua alta in Hamburg als bedeutendes<br />
internationales Forum für Klimafolgen und<br />
Hochwasserschutz bestätigt<br />
1032 Jubiläum: 10. Goldener Kanaldeckel des IKT<br />
1033 Grün gekauft und Geld gespart – <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
beziehen mehrheitlich Strom aus<br />
erneuerbaren Quellen<br />
1034 Deutliche Nachbesserungen beim Pflanzenschutzgesetz<br />
erforderlich<br />
Veranstaltungen<br />
1051 318. <strong>Wasser</strong>rechtliches Kolloquium<br />
Vereine, Verbände und Organisationen<br />
1052 Technisches Sicherheitsmanagement in<br />
China – Eine euro-asiatische Erfolgsstory<br />
Recht und Regelwerk<br />
1055 DVGW-Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
1056 Ankündigung zur Fortschreibung der<br />
DVGW-Regelwerke gemäß GW 100<br />
1057 DWA-Merkblätter erschienen<br />
Praxis<br />
1094 Ohne Experten wird es teuer – Qualitäts<strong>sich</strong>erung<br />
beginnt bei der Auswahl des<br />
Planers<br />
1096 Grabenlose Bauweise in schwierigem<br />
Gelände –Anspruchsvolles Verfahren<br />
schont Natur und Zeitbudget<br />
1100 Duktile Guss-Rohrsysteme: Nachhaltig<br />
überlegen<br />
Produkte und Verfahren<br />
1104 Neue, hochdynamische Rückschlagarmatur<br />
für optimalen Schutz wichtiger Anlagen-<br />
Komponenten und höhere Effizienz<br />
1108 Bürkert entwickelt neue Serie von Magnetventilen<br />
für Flüssigkeiten und Gase<br />
November 2011<br />
992 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Inhalt<br />
Tief und aktiv<br />
Die Instandhaltung von Entwässerungsanlagen trägt neben der Sicherstellung<br />
der wasserwirtschaftlichen Ge<strong>sich</strong>tspunkte zur Erhaltung der vorhandenen<br />
Vermögenswerte bei. Ab Seite 1094<br />
Information<br />
1089 Buchbesprechungen<br />
1109 Impressum<br />
1110 Termine<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong> im Dezember 2011<br />
u.a. mit diesen Fachbeiträgen zu<br />
40 Jahre Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren<br />
Zusammenwachsen West und Ost der ATT<br />
Gründung der ATT und ihre Entwicklung<br />
Integrale Talsperrenbewirtschaftung – ein ganzheitlicher<br />
Ansatz<br />
Modernisierung/Neubau der SEBES Trinkwasseraufbereitungsanlage<br />
Esch/Sauer<br />
Der Weg zum Talsperren-Benchmarking<br />
Organische Spurenstoffe in Gewässern – Vorkommen<br />
und Bewertung<br />
Erscheinungstermin: 15.12.2011<br />
Anzeigenschluss: 24.11.2011<br />
Direkter Erdeinbau von<br />
<strong>Wasser</strong>zählern?<br />
Jetzt möglich mit dem<br />
WATERFLUX von KROHNE.<br />
WATERFLUX – der neue magnetischinduktive<br />
<strong>Wasser</strong>zähler – vereinfacht<br />
den Einbau von Messtechnik in<br />
Trinkwassernetzen enorm. Dank des<br />
dauerhaft wartungsfreien Betriebes,<br />
einer Lebensdauer von 25 Jahren<br />
und der Erdeinbau-Lackierung<br />
kann der WATERFLUX bei nicht<br />
eichpflichtigen Anwendungen direkt<br />
in die Erde eingebaut werden – und<br />
das ohne Messschacht.<br />
Die präzise erfassten Messwerte<br />
und der Zählerstand können oberirdisch<br />
auf dem batteriebetriebenen<br />
Messumformer bequem abgelesen<br />
werden. Optional werden die Daten<br />
zyklisch über beliebige GSM-<br />
Mobilfunknetze an ein Leitsystem<br />
übermittelt – auch aus weit<br />
entlegenen Gebieten.<br />
Richten auch Sie mit minimalem<br />
Aufwand eine unterirdisch installierte,<br />
autarke und voll fernüberwachte<br />
Messstelle ein – eben tief und aktiv!<br />
KROHNE – <strong>Wasser</strong> ist unsere Welt.<br />
Weitere Informationen finden Sie auf<br />
unserer Website.
Interview<br />
DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong>:<br />
Praxisforschung für das <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>Wasser</strong>forschung hat in Karlsruhe Tradition. Bereits ab Mitte des letzten Jahrhunderts beschäftigte <strong>sich</strong> eine<br />
Fachabteilung des Engler-Bunte-Instituts an der Universität Karlsruhe mit wissenschaftlichen Untersuchungen<br />
des Trinkwassers. Später, in den 70er-Jahren, wurde hier als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis<br />
eine DVGW-Forschungsstelle eingerichtet. Anfang der 90er-Jahre beschloss der Vorstand des DVGW (Deutscher<br />
Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e.V.), den stark angewachsenen technischen Dienst <strong>Wasser</strong> aus der<br />
Forschungsstelle auszugliedern und das DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), zu gründen. Im kurz darauf<br />
errichteten TZW-Gebäude in Karlsruhe-Hagsfeld, in der Prüfstelle im Durlacher Wald und im Heinrich-<br />
Sontheimer-Laboratorium (HSL) sowie in den beiden Außenstellen in Hamburg und Dresden befassen <strong>sich</strong> die<br />
Mitarbeiter seither mit technisch-wissenschaftlichen Fragestellungen rund um die Trinkwasserversorgung. An<br />
den verschiedenen Standorten werden zahlreiche Forschungsprojekte bearbeitet – zu den Themen Stoffbewertung,<br />
Aufbereitung und Mikrobiologie, Korrosion, Materialprüfung und Verteilungssysteme bis hin zu Fragen<br />
des Ressourcenschutzes. Über die Aufgabenstellung des TZW für die <strong>Wasser</strong>wirtschaft und die Bedeutung<br />
umfassender Forschungsarbeit für die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser sprach<br />
Dr. Josef Klinger, Geschäftsführer des TZW, mit Christine Ziegler von <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>.<br />
Dr. Josef Klinger, Geschäftsführer<br />
des TZW: DVGW-Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong>. © Christine Ziegler<br />
<strong>gwf</strong>: Das DVGW-Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong>, kurz TZW, wurde vor<br />
rund zwanzig Jahren auf DVGW-<br />
Beschluss gegründet – allerdings gab<br />
es bereits eine traditionsreiche Vorgeschichte<br />
…?<br />
Dr. Klinger: Genau betrachtet<br />
beginnt unsere Historie vor gut<br />
einem Jahrhundert, als im Jahr 1907<br />
auf Empfehlung des Deutschen<br />
Vereins des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches<br />
(DVGW) eine Lehr- und Versuchsanstalt<br />
für Gas an der Universität Karlsruhe<br />
etabliert wurde. Im Jahr 1949<br />
entstand dann eine weitere Abteilung<br />
mit dem Aufgabenbereich<br />
<strong>Wasser</strong>forschung. Im Jahr 1971 entstand<br />
dann das heutige Engler-<br />
Bunte-Institut, benannt nach den<br />
beiden Wissenschaftlern Carl Engler<br />
und Hans Bunte, wegweisende Pioniere<br />
auf dem Gebiet der Brennstoffund<br />
Feuerungstechnik. Mit den<br />
Fachbereichen chemische Energieträger/Brenn<br />
stofftechnologie, Verbrennungstechnik<br />
und <strong>Wasser</strong>chemie<br />
wurde 1977 die DVGW-Forschungsstelle<br />
ins Engler-Bunte-Institut<br />
integriert.<br />
Die <strong>Wasser</strong>seite dieser Forschungsstelle<br />
umfasste den technischen<br />
Dienst, der <strong>Wasser</strong>versorger<br />
bei ihren Problemen beriet. Denn<br />
Unser Anspruch ist es, mit unserer Forschungsarbeit<br />
den gesamten <strong>Wasser</strong>kreislauf im Sinne der<br />
Trinkwasserversorgung abzudecken – praktisch<br />
vom Ressourcenschutz bis zur Entnahmearmatur.<br />
der Fokus bestand schon zu Zeiten<br />
nicht allein auf Forschung und<br />
Lehre sondern auch auf der praktischen<br />
Anwendung. Da diese Einheit<br />
immer aktiver und somit immer<br />
umfangreicher wurde, führten letztendlich<br />
Platzprobleme in der Universität<br />
Karlsruhe dazu, dass der<br />
DVGW-Vorstand im Jahr 1991<br />
beschloss, das DVGW-Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong> zu gründen und<br />
dafür ein neues Gebäude in Karlsruhe-Hagsfeld<br />
errichten zu lassen,<br />
welches wir schließlich im Jahr 1995<br />
beziehen konnten. Nahezu zeitgleich,<br />
kurz nach der Maueröffnung,<br />
mündete die bereits bestehende<br />
Kooperation mit der Forschungsstelle<br />
Dresden in deren Eingliederung<br />
ins TZW, später kam die enge<br />
Verbindung zur Universität Hamburg-Harburg<br />
hinzu. Dementsprechend<br />
lässt <strong>sich</strong> die Frage nach dem<br />
tatsächlichen Gründungsjahr nicht<br />
wirklich an einem einzigen Datum<br />
festmachen.<br />
<strong>gwf</strong>: Zum Technologiezentrum <strong>Wasser</strong><br />
zählt ja auch das Heinrich-Sontheimer-Laboratorium<br />
(HSL) …?<br />
Dr. Klinger: Bei Heinrich Sontheimer<br />
haben nicht nur Generationen<br />
von <strong>Wasser</strong>fachleuten ihre wissenschaftlichen<br />
Meriten erworben, er<br />
war gewissermaßen der Initiator<br />
unseres heutigen technischen Bera-<br />
November 2011<br />
994 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Interview<br />
tungsangebotes für die <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
Er hat diesen Bereich am<br />
Engler-Bunte-Institut aufgebaut,<br />
indem er die Fragen und Probleme<br />
der <strong>Wasser</strong>werkspraxis in zahlreichen<br />
Projekten wissenschaftlich<br />
untersuchte. Das HSL entstand<br />
dann aus der „Forschungsgruppe<br />
Sontheimer“ im Laboratorium des<br />
<strong>Wasser</strong>werks Durlacher Wald, wo er<br />
seine wissenschaftlichen Aktivitäten<br />
nach seiner Emeritierung als<br />
Professor für <strong>Wasser</strong>chemie ab 1987<br />
fortsetzte. Auf dieser von Prof. Sontheimer<br />
erarbeiteten Basis erfolgte<br />
wenige Jahre später der erste Spatenstich<br />
für das DVGW-Technologiezentrum<br />
<strong>Wasser</strong> durch Peter Scherer,<br />
seinerzeit Vizepräsident <strong>Wasser</strong> des<br />
DVGW und Prof. Jürgen Ulmer,<br />
damals Geschäftsführer der Stadtwerke<br />
Karlsruhe. Nicht zu vergessen<br />
sind natürlich die Herren Prof. Dr.<br />
Gerhard Naber, Prof. Dr. Wolfgang<br />
Merkel und natürlich unser Prof.<br />
Wolfgang Kühn, der dann als Ge -<br />
schäftsführer berufen wurde, sowie<br />
die vielen Unterstützer aus der <strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
die die Realisierung<br />
des Baus erst ermöglicht haben.<br />
<strong>gwf</strong>: Wie hat <strong>sich</strong> das TZW seither<br />
entwickelt, wie viele Mitarbeiter<br />
beschäftigen Sie heute?<br />
Dr. Klinger: Mittlerweile arbeiten<br />
rund 180 Mitarbeiter am TZW, der<br />
größte Teil davon in Vollzeit. Hier am<br />
Hauptstandort in Karlsruhe-Hagsfeld<br />
haben wir etwa 120 Beschäftigte,<br />
25 bis 30 Leute sind im <strong>Wasser</strong>werk<br />
der Stadtwerke Karlsruhe<br />
im Durlacher Wald eingesetzt, etwa<br />
ebenso viele sind in Dresden tätig<br />
und in Hamburg-Harburg sind es<br />
etwa fünf Mitarbeiter. Das sind insgesamt<br />
rund dreimal so viele Mitarbeiter<br />
wie zu Beginn. Denn seither<br />
hat <strong>sich</strong> unser Tätigkeitsfeld enorm<br />
entwickelt. Das seinerzeit auf<br />
Zuwachs geplante Hauptgebäude<br />
hier in Karlsruhe beginnt bereits<br />
langsam eng zu werden.<br />
<strong>gwf</strong>: Am TZW laufen etliche Forschungsvorhaben.<br />
Welches sind die<br />
Themen, mit denen <strong>sich</strong> Ihre Mitarbeiter<br />
dabei hauptsächlich beschäftigen?<br />
Dr. Klinger: Unser Anspruch ist es,<br />
mit unserer Forschungsarbeit den<br />
gesamten <strong>Wasser</strong>kreislauf im Sinne<br />
der Trinkwasserversorgung abzudecken<br />
– praktisch vom Ressourcenschutz<br />
bis zur Entnahmearmatur.<br />
Darin liegt auch die Vielfalt<br />
unserer Forschungsgebiete sowie<br />
der Umfang unserer Aufgaben be -<br />
gründet. Derzeit bearbeiten wir<br />
rund 50 Forschungsprojekte, dabei<br />
beginnen wir bereits im Vorfeld der<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung, also bei Fragen<br />
der Umweltbiotechnologie und der<br />
Altlastenproblematik: Wie lassen<br />
<strong>sich</strong> kontaminierte Flächen sanieren,<br />
Schadstoffe abbauen oder Problemgebiete<br />
behandeln? Wir untersuchen,<br />
welchen Einfluss alte Industrieaktivitäten<br />
auf Boden und<br />
Grundwasser haben oder wie <strong>sich</strong><br />
Die <strong>Wasser</strong>wirtschaft braucht hier tragfähige<br />
Informationen, denn es geht schließlich um recht<br />
langfristige Investitionen, um die zu erwartenden<br />
Szenarien in den Griff zu bekommen.<br />
Agrarnutzung oder große Bauvorhaben<br />
auf deren Beschaffenheit<br />
auswirken – Stichwort <strong>Wasser</strong>schutzgebiete.<br />
Ein weiterer Bereich<br />
befasst <strong>sich</strong> mit der Analytik und<br />
insbesondere Bewertung von <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffen,<br />
speziell auch von<br />
Spurenstoffen, deren Verhalten und<br />
Eliminierbarkeit in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung.<br />
In einer anderen Abteilung<br />
wird die <strong>Wasser</strong>versorgung einer<br />
technologischen und wirtschaftlichen,<br />
aber auch einer strukturellen<br />
Betrachtung unterzogen. Wir forschen<br />
auch über Verkeimungspotentiale<br />
in Trinkwassersystemen<br />
und Technologien zu deren Beseitigung.<br />
Zudem werden die Themen<br />
Verteilungssysteme – dazu gehören<br />
natürlich auch die Hausinstallationen<br />
–, Korrosion und Materialprüfung<br />
intensiv bearbeitet.<br />
Eine wesentliche Schnittstelle<br />
zwischen Forschung und Praxis ist<br />
die Prüfstelle <strong>Wasser</strong> am TZW, die im<br />
Sinne der Satzung des DVGW arbeitet.<br />
Hier prüfen wir nahezu 90 Prozent<br />
der zur <strong>Wasser</strong>verteilung oder<br />
<strong>Wasser</strong>verwendung eingesetzten<br />
Produkte – in vollem Umfang oder<br />
auch in Teilbereichen – bevor sie<br />
von den Kollegen der DVGW Cert<br />
GmbH in Bonn zertifiziert werden.<br />
Zu diesen Produkten zählen die<br />
großvolumigen Versorgungsleitungen<br />
ebenso wie die Entnahmearmaturen<br />
in einer normalen Küche.<br />
<strong>gwf</strong>: Für diese Bandbreite an Aufgaben<br />
ist <strong>sich</strong>er eine umfangreiche<br />
Ausstattung notwendig...?<br />
Dr. Klinger: An den Karlsruher<br />
Standorten in der Hagsfelder Straße<br />
und im Durlacher Wald beträgt die<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 995
Interview<br />
Nutzfläche insgesamt über 4000<br />
Quadratmeter, dazu kommen noch<br />
die Flächen in Dresden und Hamburg.<br />
Etwa die Hälfte dieser Flächen<br />
ist mit technischen Räumen oder<br />
Laboren belegt. Die Ausstattung<br />
mit Geräten oder Prüfständen be -<br />
dingt eine hohe jährliche Investitionssumme.<br />
Sämtliche Geräte aus<br />
älterem Bestand tauschen wir nach<br />
und nach aus, sodass wir hier auf<br />
dem neuesten Stand sind. Selbst bei<br />
Analysegeräten, die im Nanogrammbereich<br />
arbeiten und entsprechend<br />
viel kosten, sind wir mit<br />
der aktuellen Generation ausgestattet.<br />
Ich denke, das spricht dafür,<br />
dass wir sehr aktiv, sehr erfolgreich,<br />
aber auch sehr innovativ sind.<br />
Unsere Prüfstände und Versuchsanlagen<br />
bauen wir übrigens<br />
selbst, das hat <strong>sich</strong> inzwischen<br />
bewährt. Der Arbeitsaufwand ist<br />
zwar entsprechend hoch, aber von<br />
Vorteil ist, dass unsere Mitarbeiter<br />
mit den eigenen Anlagen umzugehen<br />
wissen und diese bei Bedarf<br />
auch weiter modifizieren können.<br />
So waren wir die ersten, die einen<br />
Prüfstand zur Untersuchung neuer<br />
Metallwerkstoffe entwickelt und<br />
gebaut haben, mittlerweile wurde<br />
der in die deutsche und europäische<br />
Normung aufgenommen.<br />
Heute gibt es deutschlandweit über<br />
ein Dutzend solcher Prüfstände und<br />
auch aus dem Ausland erhalten wir<br />
regelmäßig Anfragen.<br />
<strong>gwf</strong>: Werden die Forschungsansätze<br />
im Haus entwickelt oder kommen die<br />
Anstöße zu neuen Projekten eher von<br />
außen?<br />
Dr. Klinger: Anlass für unsere Arbeit<br />
sind natürlich aktuelle Fragen aus<br />
der Praxis. Strategisch arbeiten wir<br />
an den Themen, mit denen <strong>sich</strong> die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft bereits beschäftigt<br />
oder über kurz oder lang<br />
beschäftigen muss – sei es im<br />
Zusammenhang mit technischen,<br />
gesellschaftlichen oder klimatischen<br />
Veränderungen. Beispiel<br />
Eine Thematisierung in den Medien, etwa<br />
von Spurenstoffen im Trinkwasser, betrifft<br />
natürlich auch unsere Arbeit. Unser Bestreben ist<br />
jedoch, bereits im Vorfeld fundierte Daten zu generieren,<br />
bevor <strong>sich</strong> die Gemüter öffentlich erhitzen.<br />
Versorgungsnetze: Zu untersuchen<br />
ist, welche Auswirkungen <strong>sich</strong><br />
ändernde Parameter wie Demografie,<br />
Klima oder Sicherheitsbedürfnisse<br />
auf die Infrastruktur haben<br />
werden. Wie werden <strong>sich</strong> die prognostizierten<br />
Änderungen auf die<br />
Regionen auswirken, auf örtliche<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcen, Verteilungssysteme<br />
oder Aufbereitungsmechanismen,<br />
wenn <strong>sich</strong> beispielsweise die<br />
Rohwasserqualitäten ändern? Die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft braucht hier tragfähige<br />
Informationen, denn es geht<br />
schließlich um recht langfristige<br />
Investitionen, um die zu erwartenden<br />
Szenarien in den Griff zu<br />
bekommen.<br />
<strong>gwf</strong>: Kommt es vor, dass Forschungsvorhaben<br />
auch durch öffentliche Diskussionen<br />
angeregt werden, beispielsweise<br />
durch die Debatte über<br />
Uran im Trinkwasser?<br />
Dr. Klinger: Eine Thematisierung in<br />
den Medien, etwa von Spurenstoffen<br />
im Trinkwasser, betrifft natürlich<br />
auch unsere Arbeit. Unser Bestreben<br />
ist jedoch, bereits im Vorfeld<br />
fundierte Daten zu generieren,<br />
bevor <strong>sich</strong> die Gemüter öffentlich<br />
erhitzen. Schließlich ist unser<br />
Anspruch, Themen für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
von morgen bereits<br />
heute zu bearbeiten.<br />
<strong>gwf</strong>: Als da wären...?<br />
Dr. Klinger: Ein wichtiges Thema ist<br />
im Augenblick der mögliche Interessenskonflikt<br />
zwischen Energiewende<br />
und Gewässerschutz. Im Verbund<br />
mit den Kollegen von der Gasseite<br />
bearbeiten wir in diesem<br />
Zusammenhang eine Reihe ge -<br />
meinsamer Projekte. Ebenso be -<br />
schäftigt uns die Energiegewinnung<br />
mittels Geothermie hin<strong>sich</strong>tlich der<br />
möglichen Auswirkungen auf das<br />
Grundwasser und das Stichwort Fracking<br />
ist derzeit ja in aller Munde.<br />
Weiterhin spannend bleibt das<br />
Thema anthropogener, in die<br />
Umwelt freigesetzter Spurenstoffe<br />
und deren Abbau- und Transformationsprodukte.<br />
Es gilt herauszufinden,<br />
wie <strong>sich</strong> diese in der Umwelt<br />
verhalten, um sie hin<strong>sich</strong>tlich einer<br />
einwandfreien <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
bewerten und daraus dann Konsequenzen<br />
ziehen zu können. Ein<br />
wichtiger Punkt dabei ist, neben der<br />
wissenschaftlichen Betrachtung<br />
auch den Dialog mit der Gesellschaft<br />
zu suchen.<br />
Außerdem wird uns die Globalisierung<br />
vor immer neue Herausforderungen<br />
stellen. Ich will nur<br />
ein Beispiel anführen: Aktivkohle<br />
kommt in ganz unterschiedlichen<br />
Qualitäten auf den internationalen<br />
Markt. Für die <strong>Wasser</strong>versorgung ist<br />
es jedoch notwendig, hier ein hinreichendes<br />
Qualitätslevel zu etablieren.<br />
Daran müssen wir arbeiten.<br />
Schließlich beschäftigen wir uns<br />
auch laufend mit Fragen der Sicherheit.<br />
Einmal, um den Betrieb und<br />
die Prozessabläufe in der <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>sich</strong>erzustellen, zum anderen<br />
aber auch, um mögliche Szenarien<br />
krimineller oder terroristischer<br />
Aktivitäten zu bewerten – ein<br />
Thema, das inbesondere aus dem<br />
internationalen Kontext stammt.<br />
<strong>gwf</strong>: Sehen Sie <strong>sich</strong> auch bei politischen<br />
Fragen als Ansprechpartner?<br />
Dr. Klinger: Aus der direkten Politik<br />
halten wir uns möglichst raus.<br />
November 2011<br />
996 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Interview<br />
Natürlich liefern wir, wissenschaftlich<br />
fundierte Zahlen und Fakten,<br />
die politischen Entscheidungsträgern<br />
dazu dienen, Sachverhalte der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung richtig zu bewerten.<br />
Aber Sie wissen ja, zwischen<br />
belegbaren objektiven Fakten und<br />
politischen Diskussionen klafft oftmals<br />
eine große Lücke.<br />
<strong>gwf</strong>: Wie wird die Arbeit des TZW<br />
finanziert?<br />
Dr. Klinger: Im Wesentlichen verfügen<br />
wir über zwei Standbeine. Zum<br />
einen führen wir technisch-wissenschaftliche<br />
Beratungen und Prüfungen<br />
direkt für <strong>Wasser</strong>versorger,<br />
Unternehmen oder Kommunen<br />
durch. Zum anderen bewerben wir<br />
uns um Fördermittel zur Finanzierung<br />
unserer Forschungsprojekte<br />
vom DVGW, vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung<br />
oder vom Bundeswirtschaftsministerium,<br />
aber auch aus Innovationsfonds<br />
größerer <strong>Wasser</strong>versorger<br />
oder von Industrieverbänden. Geldgeber<br />
für <strong>Wasser</strong>forschung finden<br />
<strong>sich</strong> aber nicht nur hierzulande sondern<br />
auch im europäischen Raum<br />
und darüber hinaus.<br />
<strong>gwf</strong>: Sehen Sie die Aufgaben des TZW<br />
eher im nationalen oder auch im<br />
internationalen Bereich?<br />
Dr. Klinger: Unser Hauptklientel<br />
sind natürlich die <strong>Wasser</strong>versorger<br />
und Unternehmen in Deutschland.<br />
<strong>Wasser</strong>technologische Beratung<br />
<strong>Wasser</strong> ist ja nicht nur eine Ware,<br />
<strong>Wasser</strong> ist ein Wert – ein gesellschaftliches<br />
Gut. Dieses gilt es zu schützen<br />
und zu bewahren.<br />
soll te meines Erachtens nicht von<br />
internationalen Finanzinteressen<br />
ge trieben sein, um Vertrauen zu<br />
wahren und glaubwürdig zu bleiben.<br />
Natürlich kooperieren wir, mit<br />
internationalen Partnern, um Ressourcen<br />
zu bündeln und Synergien<br />
zu schaffen. So sind wir gewissermaßen<br />
wissenschaftliches Bindeglied<br />
der Arbeitsgemeinschaften<br />
der <strong>Wasser</strong>werke an den internationalen<br />
Gewässern, insbesondere am<br />
Rhein und Bodensee (IAWR, ARW,<br />
AWBR), aber auch an der Donau<br />
(IAWD) und an der Elbe (AWE). Seit<br />
jeher besteht in diesem Rahmen ein<br />
intensiver Kontakt mit <strong>Wasser</strong>versorgern<br />
der angrenzenden Staaten<br />
Schweiz, Österreich, Frankreich,<br />
Holland, aber auch mit Versorgern<br />
in östlichen Ländern. Außerdem<br />
pflegen wir enge Beziehungen zu<br />
verwandten Forschungseinrichtungen<br />
im Ausland. Das TZW ist beispielsweise<br />
Mitglied in der internationalen<br />
Vereinigung für <strong>Wasser</strong>forschung<br />
(GWRC – Global Water<br />
Research Coalition) und wir sind<br />
Gründungsmitglied des Europäischen<br />
EUREKA-Clusters ACQUEAU,<br />
der die Europäische <strong>Wasser</strong>forschung<br />
bündelt.<br />
<strong>gwf</strong>: Welche Ziele verbinden Sie persönlich<br />
mit Ihrer Arbeit im <strong>Wasser</strong>fach?<br />
Dr. Klinger: <strong>Wasser</strong> ist ja nicht nur<br />
eine Ware, <strong>Wasser</strong> ist ein Wert – ein<br />
gesellschaftliches Gut. Dieses gilt es<br />
zu schützen und zu bewahren. Das<br />
sehe ich als meine, als unsere Aufgabe<br />
hier am TZW. Wichtig ist aber,<br />
diese Wertediskussion auch öffentlich<br />
zu führen. Denn ohne Werte<br />
funktioniert eine Gesellschaft nicht.<br />
Die Versorgung mit hochwertigem<br />
Trinkwasser ist hierzulande etwas so<br />
Selbstverständliches geworden,<br />
dass <strong>sich</strong> kaum jemand näher damit<br />
beschäftigt, welche Leistung bei der<br />
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung<br />
betrieben werden muss.<br />
Trotz immer wieder aufflammender<br />
Diskussionen über <strong>Wasser</strong>preise ist<br />
<strong>Wasser</strong> hierzulande so kostengünstig,<br />
dass sein Wert und insbesondere<br />
die in Deutschland bestehende<br />
hohe Qualität nicht mehr richtig<br />
geschätzt wird. Deshalb ist es ganz<br />
wichtig, den Bürgern die Zusammenhänge<br />
nahezubringen – am<br />
besten sollten wir damit bereits<br />
ganz früh in den Kindergärten und<br />
Schulen beginnen.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 997
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
SPS/IPC/DRIVES 2011<br />
Elektrische Automatisierung –<br />
Systeme und Komponenten<br />
22. bis 24. November 2011 in Nürnberg<br />
Die Fachmesse zur elektrischen<br />
Automatisierung, die SPS/IPC/<br />
DRIVES präsentiert <strong>sich</strong> 2011 größer<br />
und internationaler als je zuvor.<br />
Erstmals werden zwölf Messehallen<br />
und mehr als 100 000 m 2 Ausstellungsfläche<br />
belegt sein. Nahezu<br />
1400 Aussteller aus dem In- und<br />
Ausland werden erwartet. Alle Keyplayer<br />
der Branche sind wieder vertreten.<br />
Die SPS/IPC/DRIVES 2011<br />
bietet somit ein noch umfangreicheres<br />
Angebot an Produkten und<br />
Lösungen zur elektrischen Automatisierung.<br />
Hohe Beteiligung<br />
internationaler Aussteller<br />
und Besucher<br />
Aussteller aus fast 40 Ländern nehmen<br />
an der Messe teil. Das entspricht<br />
einer Steigerung von 20 %.<br />
Mit derzeit 76 Unternehmen ist Italien<br />
auch in diesem Jahr die stärkste<br />
ausstellende Nation aus dem Ausland,<br />
gefolgt von der Schweiz (36),<br />
China (35) und Österreich (27).<br />
www.wassertermine.de<br />
Nach dem Besucherrekord in<br />
2010 ist auch für 2011 mit deutlich<br />
über 50 000 Fachbesuchern zu rechnen.<br />
Rund 20 % der Besucher werden<br />
aus dem Ausland erwartet;<br />
der Anteil der internationalen Fachbesucher<br />
wächst kontinuierlich.<br />
Die neu hinzugenommene Halle 3<br />
mit 10 000 m 2 Ausstellungsfläche<br />
beinhaltet die Thematik Antriebs-<br />
und Steuerungstechnik. Halle 8<br />
bekommt neben der Steuerungstechnik<br />
den neuen Themenschwerpunkt<br />
Bedienen und Beobachten.<br />
Umfassendes<br />
Rahmenprogramm<br />
Die Gemeinschaftsstände „wireless<br />
in automation“, „AMA Zentrum für<br />
Sensorik, Mess- und Prüftechnik“<br />
sowie „open source meets industry“<br />
liefern den Besuchern einen gezielten<br />
Überblick zum jeweiligen<br />
Thema. Auf den beiden Messeforen<br />
der Verbände VDMA und ZVEI<br />
finden hochwertige Vorträge und<br />
Podiumsdiskussionen statt, die die<br />
Branche aktuell bewegen.<br />
Kongress erstmals mit<br />
Anwendersessions<br />
Neu im diesjährigen Kongressprogramm<br />
sind vier spezielle Anwendersessions.<br />
Anwender stellen darin<br />
vor, wie spezifische Applikationen<br />
innovativ und erfolgreich realisiert<br />
wurden. Sie laden zum intensiven<br />
Dialog zwischen Kongressbesuchern<br />
und Anwendern ein und versprechen<br />
interessante Erfahrungsberichte<br />
direkt vom anwendenden<br />
Unternehmen. Das Gesamtprogramm<br />
des SPS/IPC/DRIVES Kongresses<br />
2011 umfasst 69 Vorträge<br />
zu Themen der elektrischen Automatisierung,<br />
eine Trendsession<br />
sowie drei Tutorials.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.mesago.de/sps<br />
November 2011<br />
998 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Moderne Fernwartungstechnik in Kläranlagen<br />
GO Serie ermöglicht flexiblen Einsatz<br />
Die Aufgabenstellungen in Kläranlagen ähneln <strong>sich</strong> sehr häufig. Gefragt sind flexible und kostengünstige<br />
Fernwartungslösungen, da die Kassen vielerorts leer sind. Die Stadtwerke von heute haben nicht mehr das<br />
Geld für teuren Vor-Ort-Support und große Investitionen.<br />
Meist sind die Kläranlagen mit<br />
mehreren schaltenden Sensoren<br />
ausgestattet. Die Daten sollen<br />
mit Hilfe von Fernwartungs- und<br />
Fernwirktechnik in einer Datenbank<br />
abgelegt werden, wobei im Fall kritischer<br />
Messwerte oder Störmeldungen<br />
(z. B. Ausfall wichtiger Pumpen)<br />
eine Alarmmeldung an die<br />
zuständigen Mitarbeiter des <strong>Abwasser</strong>zweckverbands<br />
gesandt werden<br />
soll. Zusätzlich möchte das Wartungspersonal<br />
den gesamten<br />
Datenbestand über ein Internetportal<br />
verfolgen.<br />
Das Unternehmen wireless netcontrol<br />
hat <strong>sich</strong> auf den Bereich der<br />
Fernwartung spezialisiert und bietet<br />
mit der Go Serie eine flexible<br />
Lösungsmöglichkeit, um alle Messsignale<br />
zu erfassen und Schaltaufgaben<br />
auszuführen. Die Module<br />
können digitale oder analoge Einbzw.<br />
Ausgänge besitzen und der<br />
Anwender kann bis zu 15 Module<br />
anschließen.<br />
Ziel aller Daten ist eine Datenbank,<br />
die mittels GPRS über eine<br />
direkte IP- Verbindung erreicht wird.<br />
Die Datenbank ist der Datenlogger<br />
für das Gesamtsystem. Die zusätzliche<br />
Speicherung auf der SD-Karte<br />
Kläranlage.<br />
der GO-Zentrale ist möglich. Die<br />
Daten werden in Tabellenform<br />
angezeigt, können aber auch graphisch<br />
dargestellt und im Anlagenschema<br />
eingeblendet werden. Der<br />
Anwender kann über einen ge<strong>sich</strong>erten<br />
Zugang von beliebigen<br />
Standorten aus den Zustand der<br />
Anlage über eine Internetverbindung<br />
einsehen und Schaltvorgänge<br />
in der Anlage auslösen.<br />
Kontakt:<br />
WIRELESS-NETCONTROL GmbH,<br />
Berliner Straße. 4a,<br />
D-16540 Hohen Neuendorf,<br />
Marco Riedel,<br />
Marketing & Vertrieb,<br />
Tel. (03303) 409-692,<br />
Fax (03303) 409-691,<br />
E-Mail: mr@wireless-netcontrol.de,<br />
www.wireless-netcontrol.com<br />
INFO<br />
Die wireless netcontrol GmbH ist ein IT- und Datenkommunikationsunternehmen<br />
in den Bereichen Industrie, Energie- und Umweltwirtschaft.<br />
Die Kunden profitieren von innovativen Lösungen zur<br />
Fernüberwachung und Fernsteuerung von Sensoren, Zählern und<br />
Anlagen. Anwendungsbereiche sind z. B. Smart Metering, Energie<br />
Controlling, Gebäudetechnik, <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>systeme,<br />
EEG-Erzeuger, Straßenbeleuchtung und das Verkehrsmanagement.<br />
GO Zentrale mit Modul.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 999
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fernwirken via SCADA<br />
Führendes SCADA-System unterstützt die Integration von Fernwirkanwendungen<br />
Automatisieren und Fernwirken in einem – das geht ab sofort mit Europas führendem SCADA-System. Ein<br />
Optionspaket ermöglicht die einfache Integration entfernter Anlagenteile in ein zentrales, vereinheitlichtes<br />
Steuerungs-, Visualisierungs- und Archivierungskonzept. Hardware-Basis sind bewährte Standard-Steuerungen<br />
und ‐Kommunikationsbaugruppen, für „Weltoffenheit“ stehen international genormte Fernwirk-Treiberprotokolle,<br />
die auch im Mix genutzt werden können.<br />
In weitläufig verteilten Automatisierungssystemen<br />
stellt <strong>sich</strong> häufig<br />
die Frage, wie man die entfernten<br />
Anlagenteile effizient und wirtschaftlich<br />
anbindet, wie die<br />
Prozesse steuert, überwacht und<br />
wichtige Informationen zentral verfügbar<br />
macht (WAN). Insbesondere<br />
dann, wenn die Entfernung für eine<br />
Anbindung an ein lokales Netzwerk<br />
(LAN/WLAN) zu groß oder aber der<br />
Aufwand dafür zu hoch ist. Weil<br />
entweder die Zahl der verteilten<br />
Außenstationen groß ist und/oder<br />
der Steuerungsanteil und die Performance,<br />
die Zahl der Baugruppen<br />
und Ein-/Ausgabesignale aber eher<br />
gering sind. Das ist häufig bei<br />
Außenanlagen in der <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>technik der Fall, wie z. B.<br />
Pumpwerken, Regenüberlaufbecken,<br />
Messstationen (Bild 1 und<br />
2), ebenso bei Anwendungen im<br />
Bereich der Fernwärme, dem Bergbau<br />
und der Verkehrstechnik und<br />
vor allem auch bei der Öl- und Gaswirtschaft<br />
(beispielsweise bei Ventil-<br />
oder Druckerhöhungsstationen<br />
in langen Pipelines).<br />
Fernwirken integriert –<br />
effizient und wirtschaftlich<br />
Ein bewährter Weg aus der Zwickmühle<br />
zwischen Kosten (Aufwand)<br />
und Nutzen ist in diesen Fällen Fernwirktechnik.<br />
Darunter versteht man<br />
die Anbindung der externen<br />
Anlagenteile über ihre Steuerungen,<br />
dann üblicherweise als Remote<br />
Terminal Units (RTUs) 1 bezeichet, in<br />
einem Telekommunikations-/Weitbereichsnetzwerk<br />
(Wide Area Network,<br />
WAN) an eine Fernwirkzentrale.<br />
Dazu werden verschiedene<br />
Übertragungsmedien genutzt, von<br />
Standleitungen über Wählverbindungen<br />
(analog, ISDN) bis zu Funksystemen<br />
(GSM, privat). In jüngerer<br />
Zeit gewinnen vor allem TCP/IPbasierte<br />
Lösungen (DSL, GPRS,<br />
UMTS) zunehmend an Bedeutung.<br />
1<br />
Remote Terminal Units sind praktisch<br />
Steuerungen an einer räumlich entfernten<br />
Stelle, die über verschiedene Kommunikationswege<br />
(Funk, GPRS, …) in<br />
das zentrale SCADA System eingebunden<br />
sein können.<br />
Bild 1. Typische Anwendungsgebiete für Fernwirkanwendungen<br />
finden <strong>sich</strong> im Bereich <strong>Wasser</strong>/Ab -<br />
wasser, z. B. bei Regenüberlaufbecken oder wie hier<br />
dargestellt, bei einem Trinkwasser-Reservoir. Anwendungen<br />
für WinCC/Telecontrol sind relativ einfach<br />
aufgebaut und es müssen nur wenige Daten ereignisgesteuert<br />
zu einer Fernwirkzentrale übertragen werden.<br />
Bild 2. Prozessablauf bei der <strong>Wasser</strong>aufbereitung. Im Bereich der Trinkwasserversorgung<br />
sind die Pumpstationen häufig weit voneinander<br />
entfernt und werden deshalb nicht selten unbemannt betrieben. Mit<br />
einer WinCC Fernwirklösung ist es möglich, stets alle relevanten Informationen<br />
im Blick zu haben: Pumpenleistung, aktuelle Fördermenge,<br />
Qualitäts- und Energiedaten etc., unabhängig davon, wie weit sie voneinander<br />
entfernt liegen.<br />
November 2011<br />
1000 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Bild 4. Die Integration von Automatisierungs- und Fernwirkanwendungen<br />
in einem Simatic WinCC-System vereinheitlicht die Bedienung<br />
und spart Aufwand bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung.<br />
Bild 3. Typische Konfiguration. Mit WinCC/TeleControl lassen <strong>sich</strong><br />
aber auch komplexere Fernwirkanwendungen integrieren, beispielsweise<br />
über ein TCP/IP-basiertes WAN mit Kabel- und GPRS-Netz via IEC<br />
60870-5 104.<br />
Alle diese Wege nutzt nun auch<br />
das SCADA-System 2 Simatic WinCC<br />
(Version 7.0 mit Service Pack 2) von<br />
Siemens, um zusätzlich zu den üblichen<br />
Automatisierungs- auch Fernwirkaufgaben<br />
zu erfüllen. Mit dem<br />
neuen Optionspaket WinCC/Tele-<br />
Control (vgl. Bild 3) können fortan<br />
sowohl lokale als auch entfernte<br />
Gewerke zu einem durchgängigen<br />
Gesamtsystem integriert werden<br />
(Bild 4). Mit einheitlichem Look &<br />
Feel beim Bedienen sämtlicher<br />
Anlagenteile, was den Schulungsaufwand<br />
minimiert, die Über<strong>sich</strong>tlichkeit<br />
und somit wiederum die<br />
Bedien<strong>sich</strong>erheit fördert. Ein<br />
gemeinsames SCADA-System für<br />
Automatisierungs- und Fernwirkanwendungen<br />
reduziert zudem den<br />
Aufwand für Installation, Inbetriebnahme<br />
und Wartung und damit<br />
Kosten (Bild 5).<br />
2<br />
Supervisory Control and Data Acquisition.<br />
Alles für rationelles<br />
Fernwirken<br />
Das Optionspaket fügt <strong>sich</strong> nahtlos<br />
in das Basissystem ein und berück<strong>sich</strong>tigt<br />
die spezifischen Anforderungen<br />
und Besonderheiten beim<br />
Fernwirken. Denn im Gegensatz zur<br />
üblichen Kommunikation in einem<br />
lokalen Automatisierungsnetzwerk<br />
(LAN) erfordert der Datenaustausch<br />
in einem WAN an erster Stelle Möglichkeiten<br />
zur zyklischen oder ereignisgesteuerten,<br />
also nicht ständigen<br />
Übertragung. Vorrangig werden<br />
kleinere Datenmengen zu einer<br />
Zentrale zu übertragen. Es werden<br />
auch Steuerbefehle von der Zentrale<br />
an die entfernte Station gesendet,<br />
allerdings ist der Steuerungsanteil<br />
im Vergleich zur Datenübertragung<br />
in die Gegenrichtung dann<br />
häufig gering. Mit ereignisgesteuerter<br />
oder zyklischer (stündlich, täglich,<br />
wöchentlich, …) Kommunikation<br />
lässt <strong>sich</strong> der Datenverkehr<br />
über Wählverbindungen minimieren,<br />
so dass auch Kommunikationsmedien<br />
mit niedrigerer Bandbreite<br />
kosteneffizient nutzbar sind. Gefordert<br />
ist außerdem die Pufferung von<br />
Daten in den Außenanlagen, um<br />
Datenverluste nach Ausfällen von<br />
Teilen des Steuerungssystems oder<br />
Unterbrechungen der Kommunikation<br />
<strong>sich</strong>er zu vermeiden. Ein weite-<br />
<br />
Bild 5. WinCC Visualisierung in einer Telecontrol<br />
Anwendung. Das SCADA-System Simatic WinCC<br />
V7.0 von Siemens integriert über das Optionspaket<br />
WinCC/TeleControl neben Automatisierungs- nun<br />
auch Fernwirkanwendungen unter einem Dach.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1001
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Insert<br />
rer Unterschied besteht darin, dass<br />
die dezentralen Fernwirkstationen<br />
nach dem Anlauf oder Wiederanlauf<br />
üblicherweise selbstständig alle<br />
anstehenden Daten an die zentrale<br />
Leitstelle senden.<br />
Zu den Kernaufgaben von<br />
WinCC/TeleControl gehört es außerdem,<br />
eine korrekte Zeitstempelung<br />
für alle Alarme, Meldungen und<br />
archivierungsrelevante Messwerte<br />
in den RTUs zu gewährleisten, eine<br />
zeitverzögerte Übertragung sowie<br />
die Zeitsynchronisation aller beteiligten<br />
RTUs zu ermöglichen. Das<br />
sind die Grundvoraussetzungen für<br />
eine chronologisch korrekte Datenarchivierung<br />
und in der Folge für ein<br />
funktionierendes Berichts- und Meldewesen,<br />
wie es u. a. in der <strong>Wasser</strong>und<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft gefordert<br />
ist. Mit WinCC Telecontrol Automatisierungslösungen<br />
ist die Überwachung<br />
aller Fernwirkstationen möglich,<br />
damit die Zentrale (der Bediener)<br />
bei Ausfall einer Station oder<br />
Tabelle 1. Mit den verschiedenen Fernwirkprotokollen nutzbare RTUs und<br />
Kommunikationsbaugruppen/‐möglichkeiten (TIM = Hardwarebaugruppe mit Modem<br />
und Pufferung der Daten / IEConS7 = Paket mit Hardware-Baugruppe inkl.<br />
Kommunikationsbaustein-Bibliotheken). 1<br />
Protokoll ET 200S S7 300 S7 400 Fremd-RTUs<br />
Sinaut seriell – TIM 3V‐IE TIM 4R‐IE –<br />
Sinaut TCP – TIM 3V‐IE TIM 4R‐IE –<br />
IEC 60870-5-101 seriell IEConS7 2 IEConS7 + CP341 3 IEConS7 + CP441 4<br />
IEC 60870-5-104 TCP IEConS7 5 IEConS7 + CP343 6,7 IEConS7 + CP443 8,9<br />
DNP3 seriell – TIM 3V-IE DNP3 TIM 4R-IE DNP3<br />
DNP3 TCP – TIM 3V-IE DNP3 TIM 4R-IE DNP3<br />
1 https://www.automation.siemens.com/mcms/topics/de/siplus/ric-telecontrol/Seiten/home.aspx<br />
2 Bundle bestehend aus IEC-Kommunikationsbausteinen und Simatic-Hardware<br />
3 Bundle bestehend aus IEC-Kommunikationsbausteinen und Simatic-Hardware<br />
4 Bundle bestehend aus IEC-Kommunikationsbausteinen und Simatic-Hardware<br />
5 Bundle bestehend aus IEC-Kommunikationsbausteinen und Simatic-Hardware<br />
6 Bundle bestehend aus IEC-Kommunikationsbausteinen und Simatic-Hardware<br />
7 auch als PROFINET Variante erhältlich<br />
8 Bundle bestehend aus IEC-Kommunikationsbausteinen und Simatic-Hardware<br />
9 auch als PROFINET Variante erhältlich<br />
Remote Terminal Units (RTUs)<br />
Simatic ET200S<br />
Simatic S7-300<br />
Simatic S7-400<br />
Fremd-RTUs<br />
Telecontrol Interface Modules (TIMs)<br />
TIM 3V‐IE / TIM 3V-IE DNP3 für Simatic S7-300<br />
TIM 4R‐IE / TIM 4R-IE DNP3 für Simatic S7-400<br />
Kommunikationsprozessoren CPs<br />
CP341 (seriell) bzw. CP343 (TCP/IP, parallel) für Simatic S7-300<br />
CP441 (seriell) bzw. CP443 (TCP/IP, parallel) für Simatic S7-400<br />
Modems und Router (MDs)<br />
Standleitungsmodem MD2<br />
Telefonmodem MD3<br />
GSM/GPRS-Modem MD720-3<br />
EGPRS-Router MD741-1<br />
einer Verbindung automatisch informiert<br />
wird. Es ermöglicht darüber<br />
hinaus die Programmierung/Parametrierung<br />
und Diagnose von RTU<br />
(Simatic-Steuerungen), unabhängig<br />
vom genutzten Übertragungsmedium<br />
der Fernwirkverbindung.<br />
Soft- und Hardware/<br />
Alles aus einer Hand<br />
Die Fernwirkoption für Simatic<br />
WinCC zielt ab auf einfache Integration<br />
externer Anlagenteile mit<br />
geringem bis mittlerem Steuerungsanteil<br />
und stellt dazu alle<br />
Funktionalitäten bereit:<br />
""<br />
ein Basic Engineering System<br />
zur Konfiguration von Kommunikationsverbindungen,<br />
Gateways,<br />
Remote Terminal Units (RTUs)<br />
und von WinCC-Tags als TeleControl-Tags,<br />
""<br />
ein Operator System für ska lierbare,<br />
dadurch immer kostenoptimierte<br />
Installationen vom<br />
Einzelplatzsystem bis zu Client-<br />
Server-Installationen auch in<br />
redundanter Ausführung, sowie<br />
""<br />
international genormte<br />
Fernwirk-Protokolltreiber.<br />
Fernwirkprotokolle für den<br />
weltweiten Einsatz<br />
WinCC/TeleControl unterstützt mit<br />
IEC 60870‐5 101/104, DNP3 (Distributed<br />
Network Protocol) sowie dem<br />
von Siemens entwickelten Sinaut<br />
ST7 drei der wichtigsten, weit<br />
verbreiteten seriellen oder parallen<br />
Fernwirkprotokolle. Auch eine<br />
gemischte Nutzung dieser Protokolle<br />
ist möglich, so dass <strong>sich</strong> auch<br />
„gewachsene“ Installationen zu<br />
homogenen Lösungen mit vereinheitlichter<br />
Bedienoberfläche integrieren<br />
lassen. Auch unterschiedliche<br />
Übertragungswege in redundanten<br />
Systemen sind somit einfach realisierbar.<br />
Mit diesen Protokollen ist<br />
das Optionspaket prädestiniert für<br />
den weltweiten Einsatz.<br />
Skalierbare Hardware<br />
für alle Aufgaben<br />
Das Produktspektrum von Siemens<br />
bietet auch die Hardware für die<br />
November 2011<br />
1002 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Kommunikation und die unterlagerten<br />
RTUs in verschiedenen, in<br />
der Leistung skalierbaren Ausprägungen.<br />
So können als fernwirkende Einheiten<br />
(RTU) die Standard-Steuerung<br />
Simatic ET200S für einfachere<br />
Anwendungen, Simatic S7-300 und<br />
Simatic S7-400 für höhere An -<br />
sprüche, aber auch Fremdsteuerungen<br />
eingesetzt werden. Damit sind<br />
Hardware-seitig exakt den jeweiligen<br />
Aufgaben und Anforderungen<br />
angepasste Installationen möglich,<br />
von kleinen Messstationen über Re -<br />
genüberlaufbecken mittlerer Größe<br />
bis hin zu komplexeren Anlagen.<br />
Auch für die physikalische Anbindung<br />
der RTUs an ein WAN stehen<br />
verschiedene Möglichkeiten zur<br />
Auswahl. Für die Kommunikation<br />
bietet das Siemens-Portfolio verschiedene<br />
Modems (MDs) und Telecontrol<br />
Interface Modules (TIMs) aus<br />
der Sinaut-Reihe, dazu Kommunikationsprozessoren<br />
(CPs) aus dem<br />
Simatic Net-Programm (Tabelle 1).<br />
Auch hierfür sind diverse Komponenten<br />
von Drittanbietern nutzbar.<br />
Die industrieerprobten Geräte von<br />
Siemens sind grundsätzlich für raue<br />
Umgebungsbedingungen konzipiert.<br />
Darüber hinaus sind spezielle<br />
Siplus-Ausführungen für den Einsatz<br />
in einem erweiterten Temperaturbereich<br />
von –25 bis +70 °C verfügbar.<br />
Individuelle<br />
Netzwerktopologien<br />
WinCC/TeleControl unterstützt alle<br />
gängigen Netzwerktopologien wie<br />
Peer-to-Peer-, Multidrop-, Stern- und<br />
Ringstrukturen, in unterschiedlichsten<br />
Varianten und Kombinationen<br />
(Bild 6), so dass in der Regel alle vorhandenen<br />
Installationen ohne große<br />
Umbauarbeiten in ein WinCC-System<br />
eingebunden werden können.<br />
Wobei Server-Runtime-Lizenzen<br />
für 6, 12, 256 oder „unbegrenzter<br />
Anzahl“ Remote Terminal Units<br />
auch in punkto Kosten eine gute<br />
Skalierbarkeit für unterschiedlichste<br />
Ausbaugrade ermöglichen.<br />
Autoren:<br />
Markus Tannert,<br />
Produkt Manager,<br />
Dipl.-Inf. (FH) Carsten Schmidt,<br />
Marketing Management HMI,<br />
Siemens AG,<br />
Industry Sector,<br />
Industry Automation Division,<br />
Industrial Automation Systems,<br />
Gleiwitzer Strße 555,<br />
D-90475 Nürnberg,<br />
www.siemens.de/wincc<br />
Bild 6.<br />
Unterstützte<br />
Netzwerktopologien.<br />
WinCC/Tele-<br />
Control<br />
unterstützt alle<br />
gängigen<br />
Protokolle und<br />
Netzwerktopologien.<br />
Grundformen<br />
genauso wie<br />
Kombinationen<br />
dieser<br />
Grundformen<br />
sind<br />
realisierbar.<br />
HYDRUS<br />
Ultraschall-<strong>Wasser</strong>zähler<br />
www.hydrometer.de<br />
Smart Metering kommt – HYDRUS ist jetzt schon bereit. Bauen Sie Ihre Infrastuktur zur automatisierten<br />
Fernauslesung beliebig aus; an den Zählern sind keine zusätzlichen Parametrierungen<br />
notwendig, denn HYDRUS liefert smarte Daten von Anfang an. Machen Sie den <strong>Wasser</strong>verbrauch<br />
transparent und profitieren Sie von den kommenden Chancen der Energiebranche.<br />
HYDRUS_Smart Metering_GWF.indd 1 12.10.2011 15:01:10
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Ableitstromproblematiken in der modernen<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>technik<br />
Nahezu alle modernen Pumpund<br />
Förderanlagen enthalten<br />
elektronische Steuereinheiten, die<br />
es ermöglichen, die Anlagen optimal<br />
auf die jeweiligen Bedürfnisse<br />
einzustellen. Pumpen werden elektronisch<br />
mit Frequenzumrichtern<br />
geregelt, um effektiv zu arbeiten.<br />
Das wirft jedoch ein großes Problem<br />
auf: Ableitströme.<br />
Was sind Ableitströme, wo<br />
entstehen sie und was kann<br />
man dagegen tun?<br />
Ableitströme kann man generell<br />
in zwei Kategorien unterteilen.<br />
Erstens, betriebsbedingte Ableitströme.<br />
Dies sind Ableitströme, die<br />
durch ein funktionierendes Gerät im<br />
Betrieb erzeugt werden. Zweitens,<br />
nicht betriebsbedingte Ableitströme<br />
auch Fehlerströme genannt.<br />
Diese werden durch ein Bauteil<br />
erzeugt, das nicht regelrecht funktioniert<br />
und bei dem es über parasitäre<br />
Wege zu einem Stromfluss<br />
kommt. Dies kann auch durch<br />
Feuchtigkeit und Verschmutzung<br />
der Fall sein.<br />
Betriebsbedingte Ableitströme<br />
können verschiedene Ursachen<br />
haben.<br />
Statische Ableitströme<br />
Statische Ableitströme fließen während<br />
des Betriebs eines Verbrauchers<br />
ohne Vorliegen eines Isolationsfehlers<br />
über den Schutzleiter oder<br />
andere leitfähige Teile gegen Erde<br />
ab. Verursacht werden diese häufig<br />
durch EMV-Maßnahmen (Entstörkondensatoren,<br />
Schirmungen, Leitungskapazitäten,<br />
Filterschaltungen,<br />
etc.). Einen wesentlichen Einfluss<br />
auf Frequenz und Amplitude der<br />
betriebsbedingten Ableitströme<br />
haben die Taktfrequenzen (z.B. bei<br />
Servo- oder Frequenzumrichtern)<br />
und die Tatsache, ob die Geräte<br />
einen einphasigen oder dreiphasigen<br />
Netzanschluss besitzen.<br />
Bild 1. Schema Ableitstrommessung mit dem EPA LEAKWATCH<br />
Messwandler.<br />
Dynamische Ableitströme<br />
Dynamische Ableitströme treten<br />
nur kurzzeitig auf. Insbesondere bei<br />
Schaltvorgängen (Ein-/Ausschalten)<br />
von Geräten mit einer Filterbeschaltung<br />
können hier kurzzeitig Stromspitzen<br />
von einigen mA bis A auftreten.<br />
Während des Schaltvorgangs<br />
ergeben <strong>sich</strong> durch ungleichmäßige<br />
Kontaktgabe unsymmetrische Verhältnisse<br />
(Sternpunktverschiebung<br />
der Kapazitäten), welche meist nur<br />
wenige ms andauern. Diese reichen<br />
häufig aus, um FI-Schutzschalter<br />
(engl. RCD = Residual Current protective<br />
Device) zum Auslösen zu<br />
bringen.<br />
Um Fehlerströme, die einen<br />
Menschen gefährden können, zu<br />
ver meiden, werden im Allgemeinen<br />
Bild 2. EPA RCCB,<br />
Allstromsensitiver RCD Typ B.<br />
handelsübliche RCDs vom Typ A<br />
eingesetzt. Diese lösen bei einem<br />
50 Hz Fehlerstrom innerhalb der<br />
Personen- (≤ 30 mA) und Brandschutzgrenze<br />
(≤ 300 mA) zuverlässig<br />
aus. Mit einem Frequenzumrichter<br />
(kurz FU) können aber nicht<br />
nur 50 Hz Ableitströme entstehen.<br />
Sollte im Zwischenkreis des Frequenzumrichters<br />
ein Fehler auftreten,<br />
wird ein glatter Gleichfehlerstrom<br />
fließen. Am Ausgang des FUs<br />
oder an der Motorleitung können<br />
Ableitströme, bedingt durch die<br />
Taktfrequenz, auch im Frequenzbereich<br />
bis zu 16 kHz und höher<br />
auftreten. Diese Fehlerströme können<br />
von einem RCD Typ A nicht<br />
<strong>sich</strong>er erfasst werden bzw. kann es<br />
durch einen Gleichfehlerstrom so -<br />
gar zu einer Sättigung des RCD-<br />
Wandlerkerns kommen. Dies führt<br />
zu einer un<strong>sich</strong>eren oder im<br />
schlechtesten Fall gar keiner Auslösung,<br />
auch bei gleichzeitig auftretenden<br />
50 Hz Fehlerströmen. Daher<br />
gilt nach:<br />
""<br />
VdS 3501 2008-10 (02) Teil 4.2:<br />
„Können im Fehlerfall glatte<br />
Gleichfehlerströme auftreten,<br />
müssen nach DIN EN 61800-5-1<br />
VDE 0160-105-1, DIN EN 50178<br />
VDE 0160 und DIN VDE 0100 530<br />
allstromsensitive Fehlerstrom-<br />
Schutzeinrichtungen (RCD) vom<br />
November 2011<br />
1004 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Typ B eingesetzt werden (siehe<br />
Abschnitt 4.4 letzter Absatz). Glatte<br />
Gleichfehlerströme können in Stromkreisen<br />
mit elektronischen Verbrauchsmitteln<br />
z. B. Frequenzumrichtern entstehen.<br />
Sie werden in der Regel durch<br />
eine pulsstromsensitive RCD Typ A<br />
nicht erfasst und können sogar deren<br />
Funktion derart störend beeinflussen,<br />
dass die geforderte Schutzwirkung<br />
hinter der RCD vom Typ A nicht mehr<br />
<strong>sich</strong>er gestellt wird.“<br />
Die Fehlerstromschutzschalter der Reihe<br />
EPA RCCB erfassen alle Fehlerstromarten<br />
entsprechend der Auslösecharakteristik<br />
der Publikation IEC 60755; d.h. glatte<br />
Gleichfehlerströme werden zuverlässig<br />
erfasst. Alle Schalter des Typs EPA RCCB<br />
sprechen auch bei Wechselfehlerströmen<br />
mit allen Frequenzen und Mischfrequenzen<br />
bis 100 kHz an.<br />
Frequenzumrichter an RCD<br />
Ein weit verbreitetes Problem sind ungewollte<br />
Auslösungen des RCD durch<br />
betriebsbedingte Ableitströme von Frequenzumrichtern.<br />
Um die Ursachen verstehen<br />
zu können, muss man das komplette<br />
Umfeld des FUs betrachten. Vor<br />
allem die im Rahmen der Elektromagnetischen<br />
Verträglichkeit (EMV) geforderten<br />
Emissionsgrenzen zwingen die Hersteller<br />
und Betreiber zu Maßnahmen,<br />
die <strong>sich</strong> negativ auf Ableitströme auswirken<br />
können. So werden zum Beispiel<br />
EMV-Filter in Frequenzumrichtern verbaut,<br />
die Störungen über Kondensatoren<br />
in den PE ableiten. Diese Störungen<br />
entstehen z.B. im Eingangsgleichrichter<br />
des FUs (Sechspuls-Brücke) oder durch<br />
Takt- und Motorfrequenzen. Ähnlich<br />
verhält es <strong>sich</strong> bei langen, abgeschirmten<br />
Motorleitungen, die eine kapazitive<br />
Ableitung erzeugen. Ein RCD kann<br />
betriebs bedingte Ableitströme und Fehlerströme<br />
nicht voneinander unterscheiden.<br />
Es kommt zu ungewollten Auslösungen,<br />
obwohl kein Defekt am Gerät<br />
vorliegt.<br />
Lösungsansätze für die Ableitstromreduzierung<br />
Um Ableitströme effektiv zu reduzieren<br />
ist es wichtig zu wissen, in welchem Frequenzbereich<br />
die Ab leitungen liegen.<br />
Dies erreicht man mit einer Differenzstromanalyse<br />
im Bereich von 50 Hz bis<br />
100 kHz. Mit einer Fourieranalyse kann<br />
man die Amplituden der Störungen im<br />
Frequenzspektrum erfassen. Eine einfache<br />
und komfortable Möglichkeit dazu<br />
bietet das von EPA entwickelte Messund<br />
Analysesystem LEAKWATCH. Mit<br />
diesem System kann man <strong>sich</strong> zusätzlich<br />
die Auslastung des RCDs anzeigen lassen,<br />
sowie Trigger- und Langzeitaufzeichnungen<br />
durchführen. Wurde nun<br />
der entsprechende Frequenzbereich er -<br />
mittelt, kann man wirksame Maßnahmen<br />
ergreifen. Dabei ist immer zu<br />
beachten, dass die gültigen EMV-Vorschriften<br />
eingehalten werden. Ein erster<br />
Weg gegen Ableitungen der Sechspuls-<br />
Brücke ist das eingebaute EMV-Filter im<br />
FU zu deaktivieren und ein externes<br />
ableitstromarmes (low leakage) Filter<br />
zum Einsatz zu bringen. Eine gute Alternative<br />
sind auch so genannte 4-Leiter<br />
oder 3+N Filter. Dabei werden Großteile<br />
der Störungen über den Neutralleiter<br />
abge leitet und stellen damit keine Auslösegefährdung<br />
dar. Für besonders hartnäckige<br />
Fälle hat EPA das Ableitstromkompensationsgerät<br />
LEAKCOMP entwickelt,<br />
welches die Ableitungen bei 150<br />
Hz, 450 Hz, 750 Hz (B6 Brücke) wirksam<br />
reduziert. Bei Ableitungen im Bereich<br />
der Taktfrequenzen (> 1 kHz) bietet EPA<br />
das spezielle Filter DAR an. Grundsätzlich<br />
sollte bei einer Ver änderung der Filtermaßnahmen<br />
immer die Einhaltung<br />
der EMV-Emissionsgrenzwerte durch<br />
eine EMV-Messung überprüft werden.<br />
Was bietet EPA?<br />
Die EP Antriebstechnik GmbH bietet<br />
Lösungen für alle Belange der modernen<br />
Antriebstechnik. Das Unternehmen führt<br />
Frequenzumrichter, DS-Motore, Servo-<br />
Motore, Zubehör und Komplettsysteme;<br />
ist Ansprechpartner im Bereich EMV und<br />
Ableitstrom; Hersteller von EMV-Filtern<br />
und führt EMV-Prüfungen im hauseigenen<br />
Prüflabor oder vor Ort durch.<br />
Kontakt:<br />
EP Antriebstechnik GmbH,<br />
Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel,<br />
Tel. (06181) 9704-0, Fax (06181) 9704-99,<br />
E-Mail: info@epa-antriebe.de,<br />
www.epa-antriebe.de, www.epa-filter.de
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Horlemann gewährleistet Betriebs<strong>sich</strong>erheit<br />
Austausch abgekündigter Automatisierungssysteme ohne Anlagenstillstand<br />
Zur Störung kommt es häufig<br />
gerade dann, wenn der Defekt nicht<br />
problemlos behoben werden kann<br />
– etwa an Feiertagen oder nachts.<br />
Um dem vorzubeugen und die<br />
Betriebs<strong>sich</strong>erheit zu garantieren,<br />
hat das Unternehmen ein Konzept<br />
für die gezielte Umstellung des Systems<br />
entwickelt. Hier arbeiten die<br />
Experten aus den Bereichen Automatisierung<br />
und Informationstechnik<br />
Hand in Hand – und können so<br />
den Austausch der Automatisierung,<br />
des Bussystems oder des Leitsystems<br />
ganzheitlich in Angriff nehmen,<br />
ohne längere Betriebsstillstände<br />
und daraus resultierenden<br />
Produktionsausfall. So bieten die<br />
Spezialisten von Horlemann ein<br />
Gesamtpaket zur Umstellung der<br />
Steuerung an, damit es erst gar<br />
nicht zum Ausfall kommt und der<br />
Übergang so nahtlos wie möglich<br />
verläuft – von der Beratung und<br />
Erstellung des Konzeptes für die<br />
Anlage über die Programmierung<br />
bis hin zum Umbau vor Ort.<br />
Die Horlemann-Fachleute verfügen<br />
über langjährige Erfahrungen<br />
in der <strong>Wasser</strong>aufbereitungs- und<br />
Automatisierungsbranche, beherrschen<br />
die Programmierung der<br />
Hochsprachen und der unterschiedlichen<br />
Automatisierungs- und Visualisierungssysteme.<br />
Zum Beispiel<br />
können sie auf erfolgreiche Projekte<br />
bei der System-Migration von Siemens<br />
und AEG oder Emerson DeltaV-System<br />
zurückblicken. So können<br />
die Programmierer <strong>sich</strong> auch<br />
schnell und flexibel auf das umzustellende<br />
System einstellen und die<br />
Software jeweils spezifisch an die<br />
Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen.<br />
Zudem besteht die Möglichkeit, bei<br />
modernen Automatisierungssystemen<br />
die Daten zu archivieren,<br />
bestehende Systeme zu erweitern<br />
und mit anderen Netzwerken zu<br />
verknüpfen – beispielsweise mit<br />
dem Finanzwesen oder dem Quali-<br />
Automatisierungssystem<br />
im <strong>Wasser</strong>werk<br />
in der Gegenüberstellung<br />
alt und neu.<br />
Veraltete Technik kann im <strong>Wasser</strong>werk<br />
folgenschwere Störungen<br />
hervorrufen. Mit ihrem Gesamtpaket<br />
zum Austausch von Automatisierungssystemen<br />
beugt die<br />
Unternehmensgruppe Horlemann<br />
dem Totalausfall im <strong>Wasser</strong>werk vor:<br />
Das niederrheinische Unternehmen<br />
bietet für diese Umstellung ein Konzept<br />
aus einer Hand an. Von der IT<br />
über die Automatisierungstechnik<br />
bis hin zur Elektrotechnik – alles<br />
kommt hier von einem Anbieter. So<br />
kann die Systemumstellung so nahtlos<br />
wie möglich erfolgen, eine einheitliche<br />
Datenbank für das gesamte<br />
Unternehmen eingeführt werden –<br />
und die Betriebs<strong>sich</strong>erheit ist in<br />
Zukunft wieder voll gewährleistet.<br />
Denn der Worst Case für <strong>Wasser</strong>werke<br />
und andere Betriebe, die auf<br />
automatisierte Anlagen setzen, ist<br />
der Komplettausfall der Anlage. Er<br />
ist stets mit erheblichen Produktionsausfällen<br />
und damit auch wirtschaftlichen<br />
Verlusten verbunden.<br />
Gerade bei Anlagen, in denen noch<br />
veraltete Technik verbaut ist, ist<br />
dieses Risiko hoch: Die einzelnen<br />
Systemkomponenten sind allein<br />
schon aufgrund ihrer Laufzeit anfälliger<br />
für Fehler. Die Reparatur kann<br />
dabei zum schwierigen Unterfangen<br />
werden: Viele Einzelteile der<br />
veralteten Anlagen werden heute<br />
nicht mehr produziert, vorrätige<br />
Ersatzteile weisen oft ebenfalls<br />
Altersschwächen auf.<br />
November 2011<br />
1006 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
tätsmanagement. Die Folge: Es entsteht<br />
ein durchgängiges System mit<br />
einer einheitlichen Datenbank, und<br />
die Daten können – ganz nach<br />
Wunsch und Bedarf, ohne zweites<br />
Netz – im gesamten Unternehmen<br />
genutzt werden.<br />
Kontakt:<br />
Horlemann Gesellschaft für<br />
Elektroanlagen mbH,<br />
Horlemann Unternehmensgruppe,<br />
Daniel Sengpiel,<br />
Weezer Straße 16, D-47589 Uedem,<br />
Tel. (02825) 89-303,<br />
Fax (02825) 89-9303,<br />
E-Mail: Sengpiel.daniel@horlemann.de,<br />
www.horlemann.de<br />
Digitale Visualisierung eines <strong>Wasser</strong>werkes.<br />
Pumpen verbrauchen 10 Prozent des weltweiten Stroms!<br />
Durch den Einsatz von energieeffizienten Pumpen und Motoren<br />
kann ein erheblicher Beitrag zur Energieeinsparung geleistet werden.<br />
Meet the<br />
energy challenge<br />
N W<br />
Wir bieten Ihnen die energieeffiziente Motorentechnologie: Grundfos Blueflux®<br />
Bei Grundfos Blueflux® handelt es <strong>sich</strong> um eine Motorentechnologie auf hohem Energieniveau speziell für den<br />
Antrieb von Pumpen. Halten Sie Ausschau nach dem Grundfos Blueflux® Label, um den Energieverbrauch Ihrer<br />
Pumpen um bis zu 60% zu senken. Bestellen Sie die Grundfos Blueflux Broschüre unter: www.grundfos.com/energy
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Klären mit moderner Netzwerktechnik<br />
In Villach reinigt eine der größten kommunalen Kläranlagen Österreichs mit einer Schmutzfracht von 200 000<br />
Einwohnerwerten die Abwässer des Großraumes Villach. Das Wiener Unternehmen IAS hat die Anlage mit<br />
Steuerungs-, Netzwerk- und Visualisierungstechnik von Rockwell Automation rundum modernisiert.<br />
Es ist viel Unrat und Abfall im<br />
Spiel, mit dem die IAS GmbH und<br />
Albert Steinwender ihr Geld verdient.<br />
Doch daran ist durchaus<br />
nichts Unehrenhaftes. Im Gegenteil,<br />
trägt der Unternehmer und Vollbluttechniker<br />
doch seit mehr als<br />
30 Jahren dazu bei, dass Umwelt<br />
und Gewässer sauber bleiben.<br />
Seine Firma IAS (Internationale<br />
Automationssysteme) hat <strong>sich</strong> als<br />
kompetenter Partner in Sachen Um -<br />
welttechnik weltweit einen hervorragenden<br />
Ruf erarbeitet.<br />
Eine der größten kommunalen Kläranlagen Österreichs<br />
steht in Villach und reinigt täglich etwa<br />
20 000 Einwohnerwerte an Schmutzfracht.<br />
Anspruchsvolle Technologie agiert im Hintergrund,<br />
damit aus schmutzigem <strong>Wasser</strong> wieder sauberes<br />
<strong>Wasser</strong> wird.<br />
Spezialität der Wiener sind Planung<br />
und Engineering elektrotechnischer<br />
Einrichtungen für Kläranlagen,<br />
Trinkwasseraufbereitungsanlagen<br />
und Deponien. „Unser Angebot<br />
reicht von der Auswahl mess- und<br />
regeltechnischer Komponenten bis<br />
hin zu kompletten Automatisierungssystemen“,<br />
sagt Steinwender.<br />
„Auch die Software wird komplett<br />
bei uns im Haus geschrieben. Nur so<br />
können wir garantieren, dass die<br />
Anlage später genau das tut, was sie<br />
soll.“<br />
Mit Rockwell Automation verbindet<br />
Steinwender seit vielen Jahren<br />
eine enge Partnerschaft. Deren<br />
Vorzüge kamen auch bei einem großen<br />
Projekt zur Geltung, das IAS<br />
GmbH für die Stadt Villach umgesetzt<br />
hat. Der Auftrag umfasste die<br />
komplette automationstechnische<br />
Modernisierung der städtischen<br />
Kläranlage, sowie der An- und Einbindung<br />
von 35 umliegenden<br />
Pumpstationen.<br />
Neben dem Austausch zahlreicher<br />
Komponenten und Steuerungen<br />
wurde auch ein neues übergreifendes<br />
Leitsystem implementiert<br />
und ein dreischichtiges Netzwerk<br />
aufgebaut.<br />
Eine besondere Herausforderung<br />
war es, dass die Erneuerung<br />
der Anlage im laufenden Betrieb<br />
erfolgen musste. Die einfache und<br />
effiziente Programmierbarkeit der<br />
Allen-Bradley-Komponenten erwies<br />
<strong>sich</strong> hierbei als ein beschleunigender<br />
Faktor. Dank der Durchgängigkeit<br />
der Software konnte das um -<br />
fangreiche Projekt in nur 18 Monaten<br />
abgeschlossen werden. Die<br />
Skalierbarkeit der Rockwell-Produkte<br />
erlaubt es zudem, künftige<br />
Erweiterungen oder Änderungen<br />
an der Kläranlage problemlos<br />
durchzuführen.<br />
Hochkomplexes Verfahren<br />
„Viele Leute meinen, in einer Kläranlage<br />
fließt vorne schmutziges <strong>Wasser</strong><br />
rein und hinten sauberes <strong>Wasser</strong><br />
raus“, schmunzelt Steinwender.<br />
Grob vereinfacht ist das zwar richtig.<br />
Doch nur der Profi sieht die<br />
anspruchsvollen Technologien, die<br />
hinter den Kulissen für einen reibungslosen<br />
Ablauf sorgen. „Eine<br />
Kläranlage muss auf unterschiedliche<br />
Situationen reagieren und<br />
trotzdem immer gleich bleibende<br />
<strong>Wasser</strong>qualität liefern können.“ So<br />
gibt es Tagesspitzen mit großen<br />
<strong>Abwasser</strong>mengen, saisonale<br />
Schwankungen und typische Belastungshochs<br />
an Feiertagen. Auch<br />
Regenwasser passiert die Anlage.<br />
Chemischer und biologischer Verschmutzungsgrad<br />
des angelieferten<br />
<strong>Wasser</strong>s wird permanent durch<br />
Onlinemessungen und Probenehmer<br />
kontrolliert, die Prozessparameter<br />
dementsprechend vollautomatisch<br />
eingestellt – 24 Stunden<br />
am Tag, 365 Tage im Jahr. Ausfälle<br />
darf es nicht geben, denn strenge<br />
wasserrechtliche Vorgaben lassen<br />
keine Abstriche zu. „Nur wenige<br />
Industrieprozesse erfordern so viel<br />
Online-Kontrolle wie die <strong>Abwasser</strong>reinigung“,<br />
weiß Steinwender. Das<br />
hochkomplexe Verfahren umfasst<br />
mehrere mechanische Vorreinigungen<br />
durch Rechen und Absetzbecken.<br />
In der nachfolgenden Belebungsstufe<br />
werden Kohlenstoff-,<br />
Stickstoff- und Phosphorverbindungen<br />
durch Bakterien und andere<br />
Mikroorganismen abgebaut bzw.<br />
gebunden. Der dabei entstehende<br />
Klärschlamm kann – so geschieht<br />
das auch in Villach – zur Erzeugung<br />
von Klärgas genutzt werden. Dieses<br />
lässt <strong>sich</strong> anschließend in Blockheizkraftwerken<br />
in Strom und Wärme<br />
umwandeln.<br />
November 2011<br />
1008 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Anzeige ED Allg_Layout 1 26.10.11 07:53 Seite 1<br />
Aufgrund der Komplexität von<br />
Kläranlagen ist eine komplette<br />
Modernisierung kaum weniger aufwendig<br />
als die Erstinstallation.<br />
Gründliche Planung und Termintreue<br />
sind deshalb unverzichtbar.<br />
Minimale Belastung<br />
für Pumpen<br />
Im Villacher Projekt brachte IAS in<br />
einem ersten Schritt mehr als<br />
30 Pump- und Hebestationen, die<br />
Abwässer vom Umland zur Kläranlage<br />
pumpen, auf einen einheitlichen<br />
Automatisierungsstandard.<br />
Jede Station wurde mit einem Allen-<br />
Bradley ® PanelView Plus 400-Display<br />
ausgestattet, das Betriebszustände<br />
leicht lesbar sowohl in vollgrafischen<br />
Verfahrensbildern wie<br />
auch in Klartext anzeigt.<br />
Diese Informationen sind parallel<br />
gleichzeitig in der Leitstelle einsehbar.<br />
Die drahtlose Kommunikation<br />
dorthin erfolgt über Funk- und<br />
GSM-Modems. Bei jenen Stationen,<br />
welche über Funk angebunden<br />
sind, wird in einem Zeitraster von<br />
etwa 20 Sekunden der aktuelle<br />
Betriebszustand abgefragt. Stationen<br />
mit GSM-Anbindung werden<br />
zweimal täglich von der Leitstelle<br />
abgefragt und melden Störungen<br />
unverzüglich in der Leitzentrale und<br />
übertragen die relevanten Daten.<br />
Zusätzlich werden im 15-Minuten-<br />
Takt Stromverbrauch-Betriebsdaten<br />
(Energieverbrauch, Pumpenlaufzeiten,<br />
er<strong>rechnet</strong>e gepumpte <strong>Abwasser</strong>menge,<br />
usw.) zur späteren Auswertung<br />
gesendet.<br />
Alle Pumpen erhielten eine<br />
Motorstromüberwachung, die verhindert,<br />
dass die Aggregate in Überoder<br />
Unterlast laufen. Sobald eine<br />
Pumpe ihr definiertes Kennfeld verlässt,<br />
erhält die Leitstelle einen im<br />
Klartext definierten Alarmtext (SMS<br />
an den diensthabenden Klärwärter<br />
und am PLS). Zudem tauschten die<br />
IAS-Techniker die alten Stern-Dreieck-Anläufer<br />
der Pumpaggregate<br />
gegen Allen-Bradley-Softstarter aus.<br />
Das reduziert die Belastung der<br />
Pumpen beim Hochfahren auf ein<br />
Minimum, was deren Lebensdauer<br />
erhöht und damit langfristig die<br />
Betriebskosten senkt. Als Steuerung<br />
kommt in jeder Pumpstation eine<br />
MicroLogix 1400 zum Einsatz,<br />
auch alle Schütze und Bedienelemente<br />
für den manuellen Betrieb<br />
wurden durch Allen Bradley-Komponenten<br />
ersetzt. Dieses Design hat<br />
den Kunden <strong>sich</strong>tlich überzeugt:<br />
„Jede zusätzliche Pumpstation, die<br />
in Zukunft neu dazukommt, muss<br />
nach diesem Standard gebaut werden“,<br />
sagt Steinwender stolz.<br />
Umfassendes Netzwerk-<br />
Konzept<br />
Als Nächstes nahm <strong>sich</strong> das IAS-<br />
Team die Leittechnik vor. Die alten<br />
PLC5-Steuerungen durften zwar im<br />
System als I/O Ebene verbleiben,<br />
fungieren jetzt aber nur mehr als<br />
Schnittstellen zu den neuen Allen-<br />
Bradley ControlLogix ® -Geräten.<br />
Diese erledigen die eigentlichen<br />
Steuer- und Regelabläufe. „Das<br />
Schöne an den ControlLogix ist,<br />
dass man dafür seine eigenen<br />
Makros (Funktionsblöcke) schreiben<br />
kann“, sagt Steinwender. „Wenn<br />
neue Komponenten ins System<br />
dazu kommen, kann ich diese Makros<br />
einfach wieder verwenden wie<br />
Legobausteine.“ Dadurch verkürzt<br />
<strong>sich</strong> der Aufwand für das Engineering,<br />
wie auch für das Testen.<br />
Die Prozessvisualisierung erfolgt<br />
über die Visualisierungssoftware<br />
FactoryTalk View ® SE von Rockwell<br />
Automation. Auf der Kläranlage<br />
sind 12 Bedienstationen installiert<br />
von denen fünf mit Industrie-PC<br />
und Touchpanel ausgerüstet sind.<br />
Die restlichen Anbindungen zum<br />
PLS werden über die Büro PCs, welche<br />
von der hausinternen IT-Abteilung<br />
zur Verfügung gestellt werden,<br />
realisiert. Das erleichtert das Handling<br />
in dem immerhin sechs Hektar<br />
großen Areal. Zwei weitere mobile<br />
Stationen erlauben es den Angestellten,<br />
die im Bereitschaftsdienst<br />
sind, die Kläranlage von Zuhause<br />
aus zu überwachen und im Falle<br />
eines Störfalles einzugreifen. Das<br />
neu geschaffene Netzwerk umfasst<br />
drei Ebenen. Auf der Steuerungs-<br />
<br />
Mit Edelstahl<br />
perfekt<br />
ausgerüstet...<br />
... für <strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung und<br />
Biogaserzeugung<br />
Wir liefern höchstwertige Produkte<br />
aus Edelstahl für die verschiedensten<br />
Anwendungsbereiche.<br />
Unsere Produkte sind:<br />
➤ korrosions<strong>sich</strong>er<br />
➤ dauerhaft<br />
➤ wirtschaftlich<br />
➤ <strong>sich</strong>er für Mensch und Umwelt<br />
info@huber.de<br />
www.huber.de<br />
WASTE WATER Solutions<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1009
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Alle Pumpenund<br />
Hebestationen<br />
erhielten<br />
einen einheitlichen<br />
Automatisierungsstandard<br />
mit<br />
einem Allen-<br />
Bradley Panel-<br />
View Plus<br />
400-Display.<br />
Neben der komplett automationstechnischen Modernisierung<br />
der städtischen Anlage in Villach, wurden<br />
auch 35 umliegende Pumpstationen an- und eingebunden.<br />
ebene sind alle ControlLogix-Steuerungen<br />
über einen Glasfaserring<br />
miteinander verbunden. Der Ring<br />
endet bei zwei baugleichen Servern,<br />
was für Redundanz sorgt, falls<br />
ein Server ausfallen sollte. Die<br />
zweite Ebene besteht aus den einzelnen<br />
Bedien- und Beobachtungsstationen.<br />
Eine dritte Ebene leitet<br />
Betriebsbilanzdaten und diverse<br />
Auswertungen an den SQL-Datenserver<br />
der Stadt Villach. Von diesem<br />
können Trend- und Protokolldaten<br />
jederzeit über eine hierfür entwickelte<br />
Software an die PC-Arbeitsplätze<br />
der Kläranlage abgerufen<br />
werden. Zusätzlich gibt es einige<br />
Anlagenteile, etwa für Qualitätsmessungen<br />
oder die unabhängige<br />
Stromversorgung, die über eine<br />
ProfiBus DB-Karte mit dem System<br />
verbunden sind. Die Haustechnik<br />
hängt außerdem via Point-I/Os via<br />
EtherNet am System. „Es gibt fast<br />
keine Kommunikationsart, die wir<br />
bei dem Projekt nicht umgesetzt<br />
haben“, stellt Steinwender fest.<br />
Fernwartung als effizienter<br />
Service<br />
Eine große Herausforderung des<br />
Projektes war der hohe Zeitdruck.<br />
Parallel zur Modernisierung der<br />
Kläranlage realisierte die Stadt Villach<br />
nämlich eine Nahwärmeversorgung,<br />
die mit vertraglich vereinbartem<br />
Stichtag betriebsbereit sein<br />
musste. Ein wesentlicher Teil der<br />
dafür benötigten Wärme kommt<br />
aus einem Blockheizkraftwerk, das<br />
mit Klärgas betrieben wird, welches<br />
wiederum in den Faultürmen aus<br />
dem anfallenden Klärschlamm der<br />
Kläranlage erzeugt wird. Dennoch<br />
konnte das neue System 18 Monate<br />
nach Projektstart erfolgreich in<br />
Betrieb genommen werden. Wie bei<br />
fast jedem Projekt nutzt IAS auch in<br />
Villach die in den ControlLogix-<br />
Steuerungen standardmäßig integrierte<br />
Möglichkeit zur Ferndiagnose.<br />
Über ein virtuelles privates Netz<br />
(Virtual Private Network – VPN)<br />
haben die Wiener Techniker von<br />
jedem Ort der Welt aus Zugriff auf<br />
das Leitsystem in Villach. Dieser<br />
Zugang ist durch eine Firewall der<br />
hauseigenen IT-Abteilung ge<strong>sich</strong>ert.<br />
In Verbindung mit einer<br />
Modemkarte kann sogar bis auf einzelne<br />
Steuerungen zugegriffen werden.<br />
Im Fall einer Störung kann das<br />
lokale Bedienpersonal somit effizient<br />
bei der Fehlersuche unterstützt<br />
werden. Im Zuge der Modernisierung<br />
in Villach hat IAS erstmals die<br />
Schaltschränke für die Pumpstationen<br />
selber gebaut. „Früher haben<br />
wir das an Drittfirmen vergeben,<br />
aber ich war zu oft nicht mit der<br />
Qualität der Ausführung zufrieden.<br />
Deshalb machen wir das jetzt selber<br />
bei uns im Haus“, sagt Steinwender.<br />
Mit der Eigenfertigung ist der<br />
Bedarf des Unternehmens an Allen-<br />
Bradley-Hardware Komponenten<br />
zusätzlich angestiegen. „Unsere<br />
gute Beziehung zu Rockwell Automation<br />
hat <strong>sich</strong> damit weiter vertieft.“<br />
Side Bar<br />
Die Lösung<br />
""<br />
Komplette Modernisierung der<br />
elektrotechnischen Einrichtung<br />
in der Kläranlage Villach<br />
""<br />
Integrierte Steuerungs- und<br />
Visualisierungslösung von Rockwell<br />
Automation, bestehend aus<br />
– Allen-Bradley MicroLogix<br />
– Allen-Bradley CompactLogix<br />
– Allen-Bradley ControlLogix<br />
– Allen-Bradley Softstarter<br />
– Visualisierung mit FactoryTalk<br />
View SE<br />
– Allen-Bradley PanelView Plus<br />
400 Displays<br />
""<br />
Durchgängige Netzwerkarchitektur<br />
mit drei Ebenen<br />
Das Ergebnis<br />
""<br />
Projektumsetzung in nur 18<br />
Monaten während des laufenden<br />
Betriebes<br />
""<br />
Einfache Programmierung der<br />
Allen-Bradley-Komponenten<br />
beschleunigte die Implementierung<br />
""<br />
Einfacher Service durch IAS via<br />
Remote Zugriff auf die Anlage<br />
""<br />
Einheitlicher Standard in allen<br />
Pump- und Hebestationen<br />
""<br />
Skalierbare Steuerungen vereinfachen<br />
künftig eine Veränderung<br />
oder Ausweitung des Systems<br />
""<br />
Softstarter reduzieren die Belastung<br />
der Pumpen beim Hochfahren,<br />
was deren Lebensdauer<br />
erhöht und langfristig die<br />
Betriebskosten senkt<br />
""<br />
12 Bedienstationen ermöglichen<br />
effizienten Zugriff auf das Leitsystem<br />
von mehreren Orten in<br />
der Anlage<br />
Kontakt:<br />
Rockwell Automation GmbH,<br />
Düsselberger Straße 15,<br />
D-42781 Haan,<br />
Tel. (02104) 960-0,<br />
Fax (02194) 960-121,<br />
www.rockwellautomation.de<br />
November 2011<br />
1010 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
SPS | iQ Platform | HMI | Frequenzumrichter | Servo / Motion | Roboter | Schütze/Schalter<br />
kaiserberg.com<br />
Funktionen.<br />
Im Überfluss.<br />
Beste <strong>Wasser</strong>qualität hat oft eine gemeinsame Quelle: leistungsstarke Klärund<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitungsanlagen. Für diese hat Mitsubishi Electric spezielle<br />
Lösungen mit vielen Vorteilen entwickelt. Mit an Bord: die extrem zuverlässigen<br />
Frequenzumrichter. Durch automatische Motordatenerkennung, sensorlose<br />
Vektorenregelung und Online-Autotuning bieten sie Bestwerte bei Drehmoment<br />
und Drehzahlkonstanz. Selbstverständlich kommen einfache Installation und<br />
Bedienung sowie die vorhandenen EMSR-Konzepte hinzu. Und mittels der<br />
modularen iQ Platform greifen alle Abläufe synchron ineinander. Glasklares Ergebnis<br />
dieser mit allen <strong>Wasser</strong>n gewaschenen Technologie: bis zu 60 % weniger<br />
Be triebskosten und glückliche Anlagenbetreiber im Überfluss.<br />
Detaillierte Infos: www.mitsubishi-automation.de | Tel. 02102 486-2525
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Ein neues Verfahren zur optischen Erfassung<br />
und Bewertung von Flockungseigenschaften<br />
in Klärprozessen (Prozess- und Laboranwendung)<br />
Bild 1. Beispiel Flockenbildung.<br />
Bild 2. Schema des Sensors.<br />
Die Flocke im Klärprozess<br />
Die Prozesse zur Klärung von<br />
Abwässern werden kontinuierlich<br />
optimiert, eine Aufgabe für den<br />
verantwortlichen Klärwerksleiter<br />
und seine Mannschaft.<br />
Neue Mess- und Regelungstechniken<br />
und eine kontinuierlich ge -<br />
wachsene Prozesserfahrung haben<br />
zur Klärprozessverbesserung beigetragen.<br />
Die Ausgangssituation<br />
Ein System zur Online-Bewertung<br />
von geflockten Partikelsystemen<br />
(Flocken) stand in der hier vorgestellten<br />
Technologie und Messschärfe<br />
bislang nicht zur Verfügung.<br />
Eine Überwachung und Steuerung<br />
zur Optimierung von Entwässerungsprozessen<br />
war daher nicht<br />
bzw. nur schwer realisierbar. Andererseits<br />
kann aber die Entwässerbarkeit<br />
eines geflockten Systems qualitativ<br />
nur anhand des Flockenbildes<br />
bewertet werden.<br />
Zur Beurteilung der Flockengüte<br />
sind hauptsächlich interessant:<br />
""<br />
Die Flockengrößenverteilung<br />
und deren zeitliche Änderung<br />
""<br />
Die Scherstabilität der Flocken<br />
Die Flockengüte (Flockenausprägung)<br />
wirkt auf:<br />
""<br />
Die Effektivität (Menge und<br />
Qualität) von Flockungshilfsmitteln<br />
(Einfluss auf die<br />
Flockenbildung)<br />
""<br />
Die Entwässerbarkeit der konditionierten<br />
Schlämme (Erhöhung<br />
der Trockensubstanz TS und der<br />
Entwässerungsgeschwindigkeit)<br />
""<br />
Die Trennqualität der nachgeschalteten<br />
Entwässerungsstufe<br />
(zur Minimierung der Restschwebstoffe<br />
im Trennwasser)<br />
Ergebnis: Mit Kenntnis der<br />
Flocken güte im Prozess ist eine<br />
höhere Entwässerungsleistung bei<br />
reduziertem Polymereinsatz <strong>sich</strong>er<br />
möglich.<br />
Der Entwässerungsprozess<br />
In der <strong>Abwasser</strong>behandlung sind<br />
polymer-initiierte Eindick- und Entwässerungsprozesse<br />
seit langer Zeit<br />
ein zentraler Bestandteil der Verfahrensführung.<br />
In jüngerer Zeit<br />
werden Flockungsprozesse auch<br />
zunehmend in anderen Bereichen<br />
genutzt, um aus einem Medium<br />
bestimmte Inhaltsstoffe abtrennen<br />
zu können, so z. B. in der Papierindustrie.<br />
Geschichtlich bedingt lag<br />
das bisherige Augenmerk primär<br />
auf den Separationsmaschinen<br />
selbst. Im Regelfall wenig Beachtung<br />
fand jedoch die Erzeugung der<br />
optimalen Flocke für den Separationsprozess.<br />
Mit dem neuen<br />
Augenmerk auf eine Optimierung<br />
der Trennstufe als letzten Prozessschritt<br />
hat <strong>sich</strong> das nun gravierend<br />
geändert. Damit rückt die Flockenbildung<br />
als ein zentraler Prozessbestandteil<br />
in das Blickfeld (Bild 1).<br />
Eine optimale und reproduzierbare<br />
Flockenstruktur ist aber ohne messtechnische<br />
Erfassung nur sehr<br />
schwer realisierbar.<br />
Der Flockungssensor<br />
Der photooptische Flockungssensor<br />
ist ein Online-Messgerät, das<br />
zur Größen- und Strukturcharakterisierung<br />
von dispergierten und<br />
nicht dispergierten Feststoffsystemen<br />
dient (Bild 2). Der Sensor<br />
arbeitet in situ, er kann sowohl<br />
direkt in eine bestehende Förderleitung<br />
bzw. Förderung eingebaut als<br />
auch im Bypass betrieben werden.<br />
Der Flockungssensor arbeitet<br />
als Reflexionsmessgerät, wobei die<br />
Messfläche durch ein Auflichtverfahren<br />
beleuchtet wird. Das zu<br />
untersuchende Gut wird durch ein<br />
Sichtfenster aufgenommen und<br />
analysiert. Eine CCD-Zeilenkamera<br />
misst aufrecht und quer zur Strömungsrichtung<br />
das Partikelsystem<br />
(Bild 3).<br />
Der Messbereich erstreckt <strong>sich</strong><br />
von 50 μm bis 2,9 cm. Die Auswertung<br />
ist eindimensional und seh-<br />
November 2011<br />
1012 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Bild 3. CCD-Optik und Leuchten (Gerät offen).<br />
Bild 4. Ausgabe Messergebnis.<br />
nenlängenorientiert, daher robust<br />
und wenig störanfällig. Die Berechnung<br />
von spezifischen Merkmalen<br />
basiert auf Sehnenlängenanzahldichte<br />
und -summenverteilungen.<br />
Diese werden durch das Messsystem<br />
sehr schnell in hoher Zahl<br />
be<strong>rechnet</strong>, so dass außerordentlich<br />
zeitnah statistisch abge<strong>sich</strong>erte<br />
Partikel- bzw. Strukturmerkmale<br />
vorliegen.<br />
Bild 4 zeigt die Ausgabe eines<br />
Messergebnisses, abgeleitet aus der<br />
optischen Begutachtung der Flocken.<br />
Aus den Rohdaten des Sensors<br />
werden in einer nachgeschalteten<br />
Recheneinheit die relevanten<br />
Prozessgrößen be<strong>rechnet</strong> und<br />
optisch dargestellt. Normierte<br />
Werte können an Steuerungs- und<br />
Regelungssysteme übergeben werden.<br />
Bild 5 von typ.Flockenhaufen<br />
zeigt ein Beispiel aus der täglichen<br />
Klärwerkspraxis.<br />
Die linke Grafik zeigt die hohe<br />
Anzahl von Kleinstflocken und<br />
Schwebstoffen (Peak bei sehr kleinen<br />
Flockenlängen), die rechte eine<br />
gut erkennbar „grobe“ Pelettierung<br />
der Flocken, Voraussetzung für<br />
leicht entwässerbaren Klärschlamm.<br />
Das Bild spiegelt <strong>sich</strong> in den Messkurven<br />
(rot und blau) wider. Links<br />
ein hoher Anteil (Peak) von Kleinstflocken,<br />
rechts fehlt dieser Anteil<br />
vollständig. Die Kleinstflockenanzahl<br />
kann (als ein Beispiel von mehreren<br />
wählbaren Ausgabeparametern)<br />
als Messgröße zur Steuerung<br />
<br />
Schlecht entwässerbare Flockung:<br />
hohe Anzahl an Kleinstflocken<br />
Restwasser trüb<br />
Gut entwässerbare Flockung:<br />
Gute Flockenpellettierung<br />
Restwasser klar<br />
FlocSens Abbildung Optik<br />
FlocSens Abbildung Optik<br />
(Zeilen-CCD, aneinander gesetzte Abtastungen)<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1013<br />
Bild 5.<br />
typ. Flockenhaufen.
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Bild 7.<br />
Mechanik<br />
Prozessanwendung.<br />
Bild 8.<br />
Laboranwendung.<br />
eines Polymermixers genutzt<br />
werden.<br />
Die Software der Bildauswertung<br />
ist modular und skalierbar<br />
aufgebaut, so dass die Auswertungsroutinen<br />
an verschiedenste<br />
Stoffsysteme angepasst werden<br />
können. Die er<strong>rechnet</strong>en Werte sind<br />
prozessspezifisch und können für<br />
den speziellen Anwendungsfall kalibriert<br />
werden.<br />
Neben einer Messwerterfassung,<br />
z. B. zur Qualitätskontrolle der Flockung,<br />
ist eine Prozessregelung<br />
durch den Flockungssensor möglich<br />
(Bild 6). Durch den Sensor werden<br />
verschiedene spezifische Flockenmerkmale<br />
wie Flockengröße<br />
und Strukturmerkmale getrennt<br />
erfasst. Eine Regelung von einzelnen<br />
Aktoren eines struktur- bzw.<br />
formgebenden Systems kann somit<br />
realisiert werden. Anhand von Installationen<br />
konnte nachgewiesen<br />
werden, dass der Flockungssensor<br />
die Güte der Konditionierung hin<strong>sich</strong>tlich<br />
der Entwässerungsfähigkeit<br />
des behandelten Schlamms<br />
ermitteln kann. Die Korrelation der<br />
Sensorberechnungen zu den tatsächlich<br />
erreichten Entwässerungskennwerten<br />
liegt bei > 0,95, eine<br />
hohe Vorhersagekraft.<br />
Das Messsystem ist sowohl für<br />
die stationäre Anwendung im Prozess<br />
wie auch als Laborapplikation<br />
verfügbar.<br />
Bild 6.<br />
Flockungssensor.<br />
Der mechanische Aufbau<br />
(Prozessanwendung) – Bild 7<br />
Im stationären Einbau arbeitet der<br />
Sensor in situ, er kann sowohl direkt<br />
in eine bestehende Förderleitung<br />
bzw. Förderung eingebaut als auch<br />
im Bypass betrieben werden. Für<br />
diesen Einsatzfall sind Betriebsdrücke<br />
bis max. 65 bar zulässig. In<br />
der Laboranwendung können z. B.<br />
die Flockengrößenverteilungen<br />
oder die Scherstabilität in Abhängigkeit<br />
von den eingesetzten Flockungshilfsmitteln<br />
analysiert werden.<br />
Somit kann ein reproduzierbares<br />
Polymerscreening durchgeführt<br />
werden. Die Ergebnisse sind sehr<br />
gut auf den großtechnischen Einsatz<br />
übertragbar.<br />
Laboranwendung (Beispiel)<br />
– Bild 8<br />
Als Beispiel für eine typische Laboranwendung<br />
wird das Flockungsverhalten<br />
von zwei unterschiedlichen<br />
Polymertypen A und B in einem<br />
Klärschlamm durch Flockengröße<br />
und Flockenstabilität charakterisiert.<br />
Hierzu analysiert der Flockensensor<br />
den Inhalt eines gerührten<br />
Becherglases. Zu Anfang wird der<br />
noch unbehandelte Klärschlamm<br />
gerührt. Dann erfolgt die erste<br />
Zugabe einer bestimmten Polymermenge<br />
(Zeit-Markierung 1 im Diagramm,<br />
links – Bild 9). Die Partikelgrößenverteilungen<br />
ändern <strong>sich</strong><br />
nach der Zugabe. Im Diagramm mit<br />
Polymer A sinkt die Anzahl kleiner<br />
Strukturen (rote Graphen) sofort<br />
signifikant ab.<br />
Im Diagramm mit Polymer B<br />
(Bild 10) fällt die Anzahl der kleinen<br />
Bild 9 und 10.<br />
Polymermenge.<br />
November 2011<br />
1014 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Strukturen erst nach weiterer Polymerzugabe<br />
(Markierungen 2–4)<br />
deutlich ab. Reziprok steigen die<br />
Fraktionsgrößen der großen Strukturen<br />
(blau) an. Unter weiterem<br />
Rühren werden noch weitere (Markierungen<br />
5–7) Polymerdosierungen<br />
vorgenommen. Am horizontalen<br />
Verlauf der Graphen kann die<br />
Stabilität der erzeugten Flocken<br />
abgeschätzt werden. Zum Zeitpunkt<br />
der Markierungen 8 und 9<br />
wird die Drehzahl des Rührers definiert<br />
gesteigert und somit die eingebrachten<br />
Scherkräfte erhöht. Das<br />
Verhalten der Flocken unter den<br />
erhöhten Scherkraftbedingungen<br />
lässt Rückschlüsse auf die Langzeitstabilität<br />
der gebildeten Flocken zu.<br />
Das Ergebnis des Polymervergleiches<br />
ist, dass Polymer A aufgrund<br />
der schnell entstehenden<br />
großen Flocken gut für eine primäre<br />
Filtration geeignet ist. Polymer B ist<br />
aufgrund seiner relativ kleinen und<br />
stabilen Flocken für eine Entwässerung<br />
im Zentrifugalfeld geeignet.<br />
Weitere Anwendungen sind<br />
überall dort denkbar, wo geflockt<br />
wird. Beispielhaft sei hier aufgeführt,<br />
ohne den Anspruch auf Vollständigkeit:<br />
""<br />
Papierindustrie,<br />
""<br />
Fruchtsaftherstellung,<br />
""<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlungen,<br />
""<br />
Schlammaufbereitungen<br />
(z. B. Bohrschlämme) und<br />
""<br />
Eindickungen.<br />
Kontakt:<br />
aquen aqua-engineering GmbH,<br />
Postfach 11 28,<br />
D-38685 Langelsheim,<br />
Tel. (05326) 92977-0,<br />
Fax (05326) 92977-10,<br />
E-Mail: info@aquen.de,<br />
www.aquen.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1015
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Mobilfunk-basierte Kommunikation<br />
in einer Kläranlage<br />
Alle Daten stets <strong>sich</strong>er im Blick<br />
Frank Horstmann B.Sc., Mitarbeiter im Global Industry Management <strong>Wasser</strong>/<strong>Abwasser</strong>,<br />
Phoenix Contact Electronics GmbH, Bad Pyrmont<br />
Für die Betreiber wird eine aussagekräftige<br />
Diagnose und Überwachung<br />
sämtlicher Bauwerke der<br />
zentralen Regenwasserbehandlung<br />
immer wichtiger. Deshalb beauftragte<br />
die Gemeinde Ehningen den<br />
Steuerungs- und Anlagenbauer SAB<br />
GmbH mit der Automatisierung<br />
ihrer Regenüberlaufbecken (RÜB)<br />
sowie deren Integration in das vorhandene<br />
Leitsystem. Da sensible<br />
Daten via Internet übertragen werden,<br />
hat die Sicherheit und Verfügbarkeit<br />
der Lösung oberste Priorität.<br />
Beim Aufdrehen des <strong>Wasser</strong>hahns<br />
ist kaum jemandem bewusst,<br />
wie komplex die Bereitstellung von<br />
Trinkwasser sowie die Entsorgung<br />
des <strong>Abwasser</strong>s ist. Die kontinuierliche<br />
Automatisierung entsprechender<br />
Bauwerke sowie deren Einbindung<br />
in das Leitsystem eröffnen<br />
neue Möglichkeiten zur Diagnose<br />
und Kontrolle der gesamten Lösung.<br />
Eine schnelle Analyse der angefallenen<br />
Daten sowie die gezielte Steuerung<br />
der Prozesse aus der Zentrale<br />
sorgen für einen korrekten Ablauf<br />
und damit für hohe Sicherheit.<br />
Als Teil des Regierungsbezirks<br />
Stuttgart und des Landkreises Böblingen<br />
liegt die Gemeinde Ehningen<br />
im Korngäu, einer Landschaft zwischen<br />
Schwarzwald und Schwäbischer<br />
Alb. Die in der Nachbargemeinde<br />
Nufringen ansässige SAB<br />
GmbH wurde 2010 mit der Automatisierung<br />
der acht Regenüberlaufbecken<br />
(RÜB) sowie deren Integration<br />
in das bestehende Leitsystem<br />
betraut. SAB beschäftigt 49 Mitarbeiter,<br />
die komplette elektrotechnische<br />
Ausrüstungen mit dem<br />
Schwerpunkt Schaltanlagenbau,<br />
Projektierung und Montage umsetzen,<br />
so auch im Projekt der Kläranlage<br />
Ehningen (Bild 1). Zur Automatisierung<br />
der Bauwerke ist hier<br />
ein innovatives Kommunikationskonzept<br />
auf Basis eines effizienten<br />
Protokolls erforderlich, um die einzelnen<br />
Regenüberlaufbecken an<br />
das Leitsystem anzukoppeln. Aufgrund<br />
der Nutzung des Mobilfunknetzes<br />
kommt sowohl der <strong>sich</strong>eren<br />
Datenübertragung als auch der<br />
Verfügbarkeit der Zentrale eine<br />
große Bedeutung zu. Der Betreiber<br />
möchte das Gesamtsystem darüber<br />
hinaus aus der Ferne warten.<br />
Bild 1.<br />
Kläranlage<br />
der Gemeinde<br />
Ehningen<br />
im Landkreis<br />
Böblingen.<br />
Sicherer Datenaustausch<br />
über das Mobilfunknetz<br />
Weil das Kanalsystem nur eine<br />
begrenzte Leistungsfähigkeit hat,<br />
speichern bei einem Regenereignis<br />
in der Gemeinde Ehningen acht<br />
Regenüberlaufbecken das Misch-<br />
November 2011<br />
1016 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
wasser temporär. Nach dem Ende<br />
des Regenereignisses wird es dann<br />
an die Kläranlage weitergeleitet.<br />
Wegen der fehlenden drahtgebundenen<br />
Kommunikations-Infrastruktur<br />
erfolgt die Übertragung der an -<br />
fallenden Daten durchgängig per<br />
GPRS/EDGE über das Mobilfunknetz.<br />
In punkto Datenaustausch<br />
setzt der Betreiber auf die Fernwirklösung<br />
Resy+ von Phoenix Contact,<br />
die per ODP-Protokoll (Open Data<br />
Port) an das Leitsystem angebunden<br />
wird. Dazu stellt der AX ODP<br />
Server dem Leitsystem die Daten<br />
als OPC-Variablen zur Verfügung<br />
(Bild 2). Historische Informationen<br />
liegen im CSV-Format (Character<br />
Separated Value) vor und werden<br />
direkt vom Archivierungssystem<br />
importiert.<br />
Bei der Auswahl der Hardware<br />
hat <strong>sich</strong> der Betreiber ebenfalls<br />
für Komponenten und Systeme<br />
von Phoenix Contact entschieden<br />
(Bild 3). So bauen acht Modems<br />
vom Typ PSI-Modem-GSM/ETH per<br />
VPN-Tunnel (Virtual Private Network)<br />
die Netzwerk-Verbindungen<br />
auf. Die hoch performanten Geräte<br />
unterstützen industrielle Ethernet-<br />
Netzwerke, über die <strong>sich</strong> sensible<br />
Daten <strong>sich</strong>er via GSM-Netz weiterleiten<br />
lassen.<br />
Wirksamer Schutz vor<br />
unbefugten Zugriffen<br />
Werden Ethernet-basierte Produktionssysteme<br />
direkt an das Unternehmensnetzwerk<br />
angekoppelt,<br />
müssen sie vor unberechtigten<br />
Zugriffen und Schadprogrammen<br />
geschützt werden. Deshalb setzt<br />
die Kläranlage Ehningen Security<br />
Appliances FL MGuard RS VPN aus<br />
der Produktlinie Factoryline von<br />
Phoenix Contact ein. Die hutschienenmontable<br />
Sicherheitslösung<br />
trennt die Büronetzwerke von den<br />
industriellen Netzen. Auch alle<br />
Regenüberlaufbecken werden über<br />
<strong>sich</strong>ere VPN-Tunnel aus dem Mobilfunknetz<br />
angebunden und die<br />
Daten per Routing an das industrielle<br />
Netzwerk weitergeleitet<br />
(Bild 4a). Insgesamt verwaltet der<br />
FL MGuard RS VPN vier Subnetze.<br />
Neben dem Büronetzwerk mit<br />
<strong>sich</strong>erem Internet-Zugang sind die<br />
ortsgebundenen Automatisierungskomponenten,<br />
die Leittechnik<br />
und die Außenstationen in jeweils<br />
einem Subnetz abgebildet.<br />
Bild 4a und 4b.<br />
Hutschienenmontable Security<br />
Appliance FL MGuard RS VPN<br />
(links) und portabler Router FL<br />
MGuard smart (rechts).<br />
Bild 2. Neue AX-ODP-Server-Lösung mit Hardware-<br />
Dongle. Die Anbindung entfernter Gewerke per<br />
Standleitung, Funkverbindung oder Mobilfunk<br />
an die Leitzentrale erfolgt in wenigen Schritten<br />
Bild 3. Blick in den Schaltschrank einer<br />
RÜB-Station.<br />
Hohe Verfügbarkeit<br />
durch innovatives<br />
Redundanzkonzept<br />
Die Außenstationen liegen räumlich<br />
weit voneinander entfernt,<br />
sodass die An- und Abfahrt im Service-Fall<br />
einen längeren Zeitaufwand<br />
bedeutet. Axel Kruse, Projektleiter<br />
bei SAB, ist es daher besonders<br />
wichtig, einen zentralen<br />
Zugriffspunkt zu haben (Bild 5). Auf<br />
diese Weise bleiben die Engineering-Kosten<br />
während der Inbetriebnahme<br />
und der späteren Wartung<br />
überschau- und kalkulierbar. Bei<br />
Software-unabhängigen Fernwartungs-Szenarien<br />
bietet <strong>sich</strong> der FL<br />
MGuard smart als portabler VPN-<br />
Client sowie temporäre VPN-Anbindung<br />
für die <strong>sich</strong>ere Fernwartung<br />
über IPsec-verschlüsselte VPN-Tunnel<br />
an (Bild 4b). Durch das robuste<br />
Gehäuse und die Stromversorgung<br />
über einen beliebigen USB-Port ist<br />
der FL MGuard smart sofort an<br />
jedem internetfähigen PC einsatzbereit<br />
und baut eine VPN-Verbindung<br />
zur gewünschten Anlage auf.<br />
Wenn es um die Verfügbarkeit<br />
der Daten geht, favorisiert der<br />
Betreiber ebenfalls ein Konzept von<br />
Phoenix Contact. Sowohl das Leitsystem<br />
als auch der AX ODP Server<br />
sind in der Zentrale redundant auf<br />
<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1017
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
getrennten Rechnersystemen in -<br />
stalliert. Bei Ausfall eines ODP Servers<br />
wird sofort auf das zweite<br />
System umgeschaltet. Die Außenstationen<br />
registrieren automatisch<br />
den neuen Zustand und senden die<br />
Bild 5. Projektleiter Axel Kruse (links) und Servicetechniker<br />
Heiko Supper von der SAB GmbH zeigen<br />
<strong>sich</strong> mit dem neuen Automatisierungskonzept<br />
zufrieden.<br />
anfallenden Prozessdaten an das<br />
neue aktive System.<br />
Flexible Anpassung<br />
an die jeweiligen Applikationsanforderungen<br />
Als Steuerungstechnik verwendet<br />
die Kläranlage Ehningen Inline Controller<br />
vom Typ ILC 170 ETH 2TX<br />
(Bild 6). Die Kleinsteuerung der<br />
100er-Leistungsklasse kann je nach<br />
Bedarf flexibel um digitale und analoge<br />
Ein- und Ausgänge ergänzt<br />
werden, die ebenso Bestandteil<br />
des Installationssystems Inline in<br />
Schutzart IP20 sind. Das ermöglicht<br />
eine optimale I/O-Konfiguration<br />
jeder einzelnen Überwachungsund<br />
Steuereinheit eines Regenüberlaufbeckens.<br />
Der ILC 170 ETH 2TX<br />
verfügt über einen großen Datenspeicher,<br />
einen zweiten Ethernet-<br />
Port und eine SD-Karte, die ein Speichervolumen<br />
von 256 MB hat.<br />
Switches aus der Produktlinie<br />
Factoryline wie der FL Switch SFN<br />
5TX erlauben eine kostengünstige<br />
Erweiterung des Ethernet-Netzwerks,<br />
damit Steuerung, dezentrale<br />
I/O-Komponenten und Modem<br />
optimal zusammenarbeiten können.<br />
Als Schutz gegen eine unautorisierte<br />
Nutzung kann der Anwender<br />
unbelegte Switch-Ports einfach<br />
mechanisch verriegeln.<br />
Fazit<br />
Nachdem die Regenüberlaufbecken<br />
auf Basis einer industriegerechten<br />
Steuerungs- und Fernwirktechnik<br />
automatisiert worden sind, kann<br />
der Klärwerksmeister zentral auf<br />
sämtliche Regenüberlaufbecken<br />
zugreifen (Bild 7). Alle sensiblen<br />
Daten werden in der Leitwarte visualisiert<br />
und protokolliert. Sowohl<br />
bei der Daten<strong>sich</strong>erheit als auch der<br />
Verfügbarkeit der Systeme hat der<br />
Betreiber hohe Standards und innovative<br />
Konzepte umgesetzt, die mit<br />
Sicherheit immer die richtigen<br />
Daten liefern. Darüber hinaus<br />
gestattet die IPSec-verschlüsselte<br />
Verbindung für die Fernwartung ein<br />
hohes Maß an Flexibilität hin<strong>sich</strong>tlich<br />
der Wartung und Erweiterung<br />
des Systems.<br />
Kontakt:<br />
Phoenix Contact Electronics GmbH,<br />
Frank Horstmann B.Sc.,<br />
Dringenauer Straße 30,<br />
D-31812 Bad Pyrmont,<br />
Tel. (05281) 946-0,Fax (05281) 946-2299,<br />
E-Mail: fhorstmann@phoenixcontact.com<br />
www. phoenixcontact.com<br />
Fernwirklösung Rey+ – vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten<br />
Bild 6. Der Schaltschrank umfasst unter anderem<br />
eine Kleinsteuerung ILC 170 ETH 2TX mit<br />
angereihten Inline-Modulen sowie ein GPRS-Modem<br />
und einen 5-Port-Switch.<br />
Bild 7. Die historischen und aktuellen Online-Werte<br />
werden in der Leitwarte visualisiert.<br />
Die Software-Lösung Resy+ von Phoenix Contact ermöglicht ein<br />
durchgängiges Fernwirken, wobei die Daten sowohl über Ethernet als<br />
auch via Standleitung, Wählverbindung, SMS, GSM, GPRS oder<br />
Funk übertragen werden können. Als Basis der Fernwirklösung fungieren<br />
hochmodulare Inline-Steuerungen in verschiedenen Leistungsklassen,<br />
die <strong>sich</strong> flexibel um die jeweils erforderlichen Standard-<br />
und Funktionsklemmen erweitern lassen. Anschließbar sind<br />
maximal 8192 lokale I/O-Punkte.<br />
Wie alle Steuerungen von Phoenix Contact werden die Inline Controller<br />
mit der Software PC Worx gemäß IEC 61131-3 programmiert.<br />
Wichtiger Bestandteil des Tools ist eine Funktionsbaustein-Bibliothek<br />
für die Konfiguration der Fernwirkverbindung. Zur Parametrierung<br />
der Fernwirktechnik und Programmierung der Steuerungsfunktion<br />
benötigt der Anwender somit nur eine Software. Diese unterstützt<br />
eine Vielzahl von Protokollen wie die Fernwirkstandards IEC<br />
60870-5-101 und 60870-5-104, Modbus TCP/RTU und ODP (Open<br />
Data Protocol), sodass die Steuerung mit fast allen modernen Leitsystemen<br />
kommunizieren kann.<br />
November 2011<br />
1018 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Industrieabwasser – vermeiden, überwachen,<br />
behandeln<br />
Tim Schrodt, Branchenmanager Lebensmittel, Endress+Hauser, Weil am Rhein<br />
Zur Behandlung von industriellen Abwässern existieren in Deutschland etwa 3000 Klär- und Aufbereitungsanlagen.<br />
Mit 22 Prozent Anteil sind die meisten davon in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Einsatz.<br />
Dabei sind nicht nur die <strong>Abwasser</strong>gebühren, sondern auch der Unterhalt dieser Anlagen ein wichtiger<br />
betriebswirtschaftlicher Kostenblock. Neben der <strong>Abwasser</strong>vermeidung und -überwachung ist eine dem Bedarf<br />
entsprechend ausgelegte und gewartete Anlage der Schlüssel zur Erschließung von Einsparpotenzialen.<br />
Von etwa 675 Anlagen bereiten<br />
70 % das <strong>Abwasser</strong> für die indirekte<br />
Einleitung auf. Die restlichen<br />
30 % klären es so gut, dass es direkt<br />
in einen Fluss, Bach oder See als<br />
Vorfluter eingeleitet werden kann.<br />
Was für eine Anlage betrieben wird,<br />
hängt neben der Betriebsgröße von<br />
der Zusammensetzung des <strong>Abwasser</strong>s<br />
und dem Betriebsstandort ab.<br />
Werden die <strong>Abwasser</strong>gebühren<br />
pauschal nur über den Frischwasserverbrauch<br />
ermittelt, zeigt die<br />
Erfahrung, dass die tatsächlich<br />
anfallende <strong>Abwasser</strong>menge niedriger<br />
ist. Viele thermische Prozessschritte<br />
reduzieren durch Verdampfen<br />
oder Verdunstung die eingesetzte<br />
Frischwassermenge. Zudem<br />
können mechanische <strong>Wasser</strong>uhren<br />
Messungenauigkeiten von bis zu<br />
± 8 % aufweisen.<br />
Bild 1. OUSAF11 mit<br />
Memograph CVM40: optische<br />
Detektion von Phasenwechsel<br />
beim Produktausschieben.<br />
Lösungen zur Reduzierung<br />
des <strong>Abwasser</strong>aufkommens<br />
Bereits im Prozess lässt <strong>sich</strong> mit Hilfe<br />
von Messtechnik beim Ausschieben<br />
von Produkt mit <strong>Wasser</strong> durch eine<br />
exakte Feststellung des Phasenübergangs<br />
das <strong>Abwasser</strong>aufkommen<br />
reduzieren. Manchmal wird<br />
dieser vom Anlagenbediener an<br />
einem Schauglas in der Rohrleitung<br />
oder durch eine fest vorgegebene<br />
Zeitkonstante in der Steuerung<br />
ermittelt. Mit einer Leitfähigkeitsmessung<br />
(z. B. Smartec S) lässt <strong>sich</strong><br />
in vielen Anwendungen dieser<br />
Schritt automatisieren. Ist eine Phasentrennung<br />
auf Grund zu ähn -<br />
licher Leitfähigkeitswerte schlecht<br />
möglich, so bieten die Messsysteme<br />
Liquiphant M Dichte mit dem Dichterechner<br />
FML621 oder der glasfreie<br />
und CIP-/SIP-fähige Trübungssensor<br />
OUSAF11 mit dem Memograph<br />
CVM40 weitere Möglichkeiten. Das<br />
letzt genannte Trübungsmesssystem<br />
zeigt auch Milchproduktverluste<br />
im <strong>Abwasser</strong>zulauf an, wie sie<br />
durch zu früh begonnene Reinigungsschritte<br />
am Tankwagen in<br />
der Milchannahme oder an anderen<br />
Produktionsbehältern auftreten<br />
können.<br />
Lösungen zur Überwachung<br />
des <strong>Abwasser</strong>s<br />
An erster Stelle steht die genaue<br />
Mengenerfassung des anfallenden<br />
<strong>Abwasser</strong>s. Das magnetisch-induktive<br />
Durchflussmessgerät Promag P<br />
eignet <strong>sich</strong> sowohl zur Erfassung<br />
der verbrauchten Frischwasser-<br />
<br />
Bild 2. Messstation CE4: Probenahme, Registrierung<br />
und Messung der wichtigsten Parameter<br />
pH, Temperatur, Leitfähigkeit, gelöster<br />
Sauerstoff, Trübung vor Ort.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1019
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Bild 3. Neutralisationsanlage einer Brauerei:<br />
vollautomatische Behandlung des <strong>Abwasser</strong>s<br />
gemäß Einleitungsvorschriften.<br />
menge als auch des <strong>Abwasser</strong>s. Soll<br />
das <strong>Abwasser</strong> im Labor untersucht<br />
werden, übernehmen Probenehmer<br />
die automatische Sammlung der<br />
<strong>Abwasser</strong>proben. Dieses kann zeitoder<br />
ereignisgesteuert geschehen.<br />
Wichtig ist die gekühlte Aufbewahrung<br />
bis zur Untersuchung. Vom<br />
portablen Gerät Liquiport 2010<br />
über stationäre Lösungen, wie die<br />
Liquistation CSF48, bis hin zur Messstation<br />
CE4, die zusätzlich zur Probenahme<br />
vor Ort auch gleich misst,<br />
können alle Anforderungen der<br />
Überwachung entsprechend abgedeckt<br />
werden. Die Vor-Ort-Messung<br />
durch eine Messstation oder Einzelmessstelle<br />
kann die Parameter pH,<br />
Temperatur, Leitfähigkeit, gelöster<br />
Sauerstoff, Trübung, Nitrat, SAK<br />
(spektraler Absorptionskoeffizient)<br />
und Chlorid erfassen. Zur Überwachung<br />
der Nährstoffe Ammonium,<br />
Bild 4. Automatisierungsschema der<br />
Neutralisationsanlage bei Vivil.<br />
Phosphat haben <strong>sich</strong> die Analysatoren<br />
Stamolys CA71 bewährt, die<br />
einer automatisch entnommenen<br />
und aufbereiteten Probe durch Reagenzienzugabe<br />
den betreffenden<br />
Nährstoffgehalt nach Farbreaktion<br />
photometrisch auswerten. Die Summenparameter<br />
CSB (Chemischer<br />
Sauerstoffbedarf), BSB (Biologischer<br />
Sauerstoffbedarf) und TOC (Total<br />
Organic Carbon) hingegen können<br />
reagenzeinfrei durch die UV/VIS-<br />
Spektrometer-Systeme STIP-scan<br />
erfasst werden. Somit kann eine<br />
Frachtermittlung lückenlos online<br />
erfolgen, bezahlt werden muss nur<br />
die wirklich eingeleitete Fracht.<br />
Lösungen zur<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Da in fast allen Bereichen der<br />
Lebensmittel- und Getränkeindustrie<br />
die Reinigung durch einen CIP-<br />
Prozess geschieht, fallen entsprechend<br />
saure oder alkalische Abwässer<br />
an, die vor der Einleitung neutralisiert<br />
werden müssen.<br />
Endress+Hauser bietet hierzu<br />
Lösungen an, die das Engineering<br />
(Pflichtenheft, Verfahren, Hard-/<br />
Software), den Anlagenbau (Behälter,<br />
Pumpen, Ventile), die Messtechnik,<br />
sowie den Schaltschrankbau<br />
mit Steuerung, Visualisierung und<br />
Registrierung beinhalten. Abgerundet<br />
werden diese Pakete durch<br />
Dienstleistungsangebote für Inbetriebnahme<br />
und Schulung des Be -<br />
dien personals. Solche <strong>Abwasser</strong>neutralisationsanlagen<br />
untergliedern<br />
<strong>sich</strong> typischerweise in drei<br />
Bereiche: Stapeltank, Neutralisationstank,<br />
Vorratstanks mit Säure und<br />
Lauge. Anfallende Abwässer werden<br />
in einem Stapelbehälter gesammelt,<br />
welcher mit einem Rührwerk,<br />
einer Füllstands- und pH-Messeinrichtung<br />
ausgestattet ist. Die Zuführung<br />
zum Neutralisationstank re -<br />
guliert eine frequenzgesteuerte<br />
Pumpe, die Förderleistung wird<br />
durch den Höhenstand und pH-<br />
Wert im Stapeltank bestimmt. Auch<br />
der Neutralisationstank ist mit<br />
<strong>Abwasser</strong>neutralisation bei Bonbonhersteller VIVIL<br />
Das Offenburger Unternehmen, das besonders für seine Pfefferminzbonbons<br />
bekannt ist, betraute Endress+Hauser im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme<br />
mit der Automatisierung seiner Durchlaufneutralisationsanlage.<br />
Als Indirekteinleiter muss VIVIL den pH-Wert des<br />
mit durchschnittlich 20 m 3 /h anfallenden <strong>Abwasser</strong>s von 2,8 bis 8<br />
auf pH 6,5 bis 10 anheben. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:<br />
Neutralisationsbecken mit Rührwerk<br />
pH- und Füllstandsmessung<br />
Dosierpumpe mit zwei Lauge-Vorratsbehältern<br />
Schaltschrank mit SPS und Bedienpanel<br />
Bildschirmschreiber<br />
Durchflussmessung im Auslauf<br />
Das saure <strong>Abwasser</strong> aus der Produktion wird in das Neutralisationsbecken<br />
geleitet. Gleichzeitig fließt bereits neutralisiertes <strong>Wasser</strong> über<br />
einen Überlauf aus dem Tank zum öffentlichen Kanalnetz. Die SPS<br />
durch eine pH-Messung, die Dosierung der zur Neutralisation erforderlichen<br />
Laugemenge. Das Rührwerk sorgt für die Durchmischung<br />
des zulaufenden <strong>Abwasser</strong>s. Im Ablauf wird die Menge, Temperatur<br />
und der pH des eingeleiteten <strong>Abwasser</strong>s über den Bildschirmschreiber<br />
Memograph M rückverfolgbar dokumentiert. Damit ist man bei<br />
VIVIL <strong>sich</strong>er, dass das <strong>Abwasser</strong> jederzeit den gesetzlichen Anforderungen<br />
entspricht.<br />
November 2011<br />
1020 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Einfach <strong>sich</strong>er!<br />
Bild 5. <strong>Abwasser</strong>mengenerfassung mit dem<br />
Promag 50P.<br />
einem Rührwerk, Füll-, Grenzstand- und pH-Messung<br />
ausgestattet. Die zur Neutralisierung entsprechend<br />
ermittelten Mengen an Säure oder Lauge werden über<br />
Dosierpumpen zugeführt. Die Steuerung berück<strong>sich</strong>tigt<br />
entsprechende Anlagen zustände wie Produktionsstillstand,<br />
Urlaubs- oder Wochenendzeiten.<br />
Will man die <strong>Abwasser</strong>kosten durch Fällung oder<br />
Reduzierung von Schadstoffen weiter senken, so sind<br />
diese Anlagen entsprechend erweiterungsfähig.<br />
Bestehende Anlagen<br />
richtig gewartet<br />
Hat man einmal mit einem durchdachten Konzept zur<br />
Transparenz der <strong>Abwasser</strong>mengen und -zusammensetzung<br />
die Kosten im Griff, empfiehlt es <strong>sich</strong>, regelmäßige<br />
Wartungen aller Messstellen durchzuführen.<br />
Endress+Hauser bietet hierzu die passenden Service-<br />
Dienstleistungen an. Von der pH-Messung über die<br />
Durchflussmessstelle bis hin zum Analysator, mit regelmäßigem<br />
Ersatz der Verbrauchsmaterialien, kann ein<br />
entsprechender Wartungsvertrag ab geschlossen werden.<br />
Somit sind auch die Instandhaltungskosten transparent<br />
und einfach budgetierbar zu gestalten.<br />
Fazit<br />
<strong>Abwasser</strong>kosten als fixen Kostenblock zu betrachten,<br />
heißt, den Blick für Einsparpotenziale zu verschließen.<br />
Schon die einfachste Lösung zur Erfassung der anfallenden<br />
<strong>Abwasser</strong>menge mittels Durchflussmessung, die<br />
mit Registrierung und Inbetriebnahme Investitionskosten<br />
von rund 6000,00 Euro verursachen, amortisiert <strong>sich</strong><br />
in vielen Fällen bereits nach einem Jahr. Für weitere<br />
Lösungen lässt <strong>sich</strong> diese Zeit relativ einfach berechnen.<br />
Kontakt:<br />
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG,<br />
Sabine Benecke, MarCom Manager,<br />
D-79576 Weil am Rhein,<br />
Tel. (07621) 975-410, Fax (07621) 975-20410,<br />
E-Mail: sabine.benecke@de.endress.com<br />
G450/G460 mit Funktionsprüfung<br />
Zur Freimessung in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen<br />
nur Gaswarngeräte eingesetzt werden, bei denen die messtechnische<br />
Funktionsfähigkeit für den Explosionsschutz<br />
nachgewiesen ist. Nur mit einem funktionsgeprüften Gerät,<br />
das nach den strengen Richtlinien der EG Baumusterprüfbescheinigung<br />
geprüft wurde, können Sie wirklich <strong>sich</strong>er sein.<br />
Das Mehrgas-Messgerät Microtector II G460 und G450<br />
erfüllt die Normen EN 60079-29-1 und EN 50104.<br />
Das bedeutet für Sie mehr Schutz - vor mehr als 7 Gasen<br />
gleichzeitig - und mehr Sicherheit. Zusammen mit praxiserprobten<br />
Funktionen und dem umfangreichen Systemzubehör<br />
wird das G460/G450 jedem Anforderungsprofil gerecht.<br />
Überzeugen Sie <strong>sich</strong> selbst.<br />
Jetzt mit neuer Ladetechnologie!<br />
www.gasmessung.de
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Sonoxide Ultraschallwasserbehandlungssystem<br />
von Ashland<br />
Das <strong>Wasser</strong>behandlungsprogramm von Ashland bietet verbesserte<br />
Mikrobenbekämpfung und Umweltverträglichkeit<br />
Olaf Pohlmann<br />
Ausgangssituation: Die Marienhütte in Graz, Österreich, ist mit einer Produktionskapazität von 380 000 Tonnen<br />
pro Jahr der einzige österreichische Hersteller von Betonstabstahl für die Verstärkung von Beton. Seit über zehn<br />
Jahren ist Ashland Austria der Partner von Marienhütte im Bereich <strong>Wasser</strong>behandlung und ist verantwortlich für<br />
die Chemikalienlieferung, Dosierung, Kontrolle und dem Service vor Ort.<br />
Kühlsystem Marienhütte. © 2011, Ashland<br />
Im Jahr 2008 installierte Marienhütte<br />
ein neues Tempcore-Verfahren,<br />
bei dem der gerippte Betonstahl<br />
nach der Warmwalzanlage<br />
durch eine spezielle <strong>Wasser</strong>kühlanlage<br />
geführt wird. Dieses innovative<br />
Kühlsystem führte dem System der<br />
Marienhütte weitere 500 m ³ <strong>Wasser</strong><br />
zu und erhöhte somit das gesamte<br />
Kühlwasservolumen auf 1 500 m ³ .<br />
Aufgrund dieser großen Kühlwassermenge<br />
wollte Marienhütte den<br />
Einsatz sowie die Kosten der <strong>Wasser</strong>aufbereitungschemikalien<br />
unter<br />
Berück<strong>sich</strong>tigung ihrer aktuellen<br />
behördlichen Genehmigungen neu<br />
bewerten. Marienhütte forderte<br />
Angebote von mehreren Dienstleistern<br />
in der <strong>Wasser</strong>aufbereitungsbranche<br />
an, darunter auch Ashland.<br />
Ashland schlug das Sonoxide<br />
Ultraschall-<strong>Wasser</strong>behandlungssystem<br />
zur Mikrobenbekämpfung in<br />
Verbindung mit einem Programm<br />
zur Ablagerungsverhinderung,<br />
einem Flockungsmittel zur Entfernung<br />
feiner Eisenpartikel aus dem<br />
Stahlherstellungsprozess und einem<br />
Überwachungsgerät zur Messung<br />
der Leistungskennzahlen vor.<br />
Die Lösung: Da das Sonoxide-<br />
System eine chemikalienfreie<br />
Methode ist, war Marienhütte der<br />
Meinung, dass das Angebot von<br />
Ashland die Erfolgskriterien am besten<br />
erfüllen würde.<br />
Ashland arbeitete mit den Ingenieuren<br />
der Marienhütte zusammen,<br />
um das Sonoxide-System in<br />
einem zweiphasigen Ansatz zu<br />
implementieren. Zuerst wurden<br />
zwei Prototypen der extra entwickelten<br />
Sonoxide B70-Einheiten installiert,<br />
um einen Seitenstrom des<br />
neuen Tempcore-Systems mit<br />
einem Volumen von 140 m ³ /h zu<br />
behandeln. Während dieser<br />
Anfangsphase liefen die Einheiten<br />
gemeinsam mit einer Chlorbehandlung,<br />
um die Behandlung des kompletten<br />
Systems <strong>sich</strong>erzustellen.<br />
Nach einigen Monaten mit<br />
guten Ergebnissen wurde die Chlorbehandlung<br />
abgebrochen und drei<br />
weitere Einheiten installiert, die<br />
Volumen von 210 m ³ /h behandelten.<br />
Durch die Anwendung von Sonoxide<br />
zur Behandlung des kompletten Systems<br />
sank im Laufe der nächsten<br />
Monate das Bakterienniveau deutlich<br />
und blieb anschließend auf einem<br />
konstant niedrigen Niveau.<br />
Die Vorteile: Das Kühlsystem der<br />
Marienhütte ist bereits seit fast zwei<br />
Jahren in Betrieb und zeigt gleich<br />
bleibend gute Ergebnisse durch den<br />
Einsatz der Sonoxide-Behandlung.<br />
Die Mikrobenbekämpfung wird<br />
regelmäßig von Ashland kontrolliert<br />
und zeigt ein Niveau von 10 3 , gelegentlich<br />
10 4 CFU/mL, was dem Industriestandard<br />
entspricht.<br />
Zu den wichtigsten Vorteilen, die<br />
Marienhütte durch dieses Programm<br />
erzielte, gehören:<br />
""<br />
Beständig niedrige Gesamtkeimzahlen<br />
und gute Legionellenbekämpfung<br />
""<br />
Zuverlässigeres <strong>Wasser</strong>aufbereitungsprogramm<br />
""<br />
Reduzierte Umweltbelastung<br />
aufgrund des Abbruchs der<br />
Chlorbehandlung<br />
""<br />
Verbesserte Arbeitsplatz- und<br />
Mitarbeiter<strong>sich</strong>erheit dank<br />
Abbruch der Chlorbehandlung<br />
""<br />
Keine Interaktion der Benutzer<br />
mit der Behandlung<br />
Heute behandelt Marienhütte alle<br />
offenen Kühlwassersysteme mit<br />
dem Sonoxide Ultraschall-<strong>Wasser</strong>behandlungssystem<br />
von Ashland.<br />
November 2011<br />
1022 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Total Plate Counts (CFU/ml)<br />
10 6 Chemical 2 Sonoxide units<br />
5 Sonoxide units<br />
10 5<br />
Orig. Cooling System<br />
New Tempcore System<br />
10 4<br />
CFU/ml<br />
10 3<br />
10 2<br />
START 2 SONOXIDE<br />
Tempcore<br />
3 SONOXIDE<br />
Original Cooling System<br />
10 1<br />
12. Feb.<br />
13. Mar.<br />
12. Apr.<br />
12. May.<br />
11. Jun.<br />
11. Jul.<br />
10. Aug.<br />
9. Sep.<br />
9. Oct.<br />
8. Nov.<br />
8. Dec.<br />
7. Jan.<br />
6. Feb.<br />
8. Mar.<br />
7. Apr.<br />
7. May.<br />
Date<br />
6. Jun.<br />
6. Jul.<br />
5. Aug.<br />
4. Sep.<br />
4. Oct.<br />
3. Nov.<br />
3. Dec.<br />
2. Jan.<br />
1. Feb.<br />
3. Mar.<br />
2. Apr.<br />
2. May.<br />
1. Jun.<br />
1. Jul.<br />
Anlage Marienhütte. © 2011, Ashland<br />
© 2011, Ashland<br />
Kundenaussage:<br />
„Der Einsatz der Sonoxide-Technik<br />
ist ein wichtiger Bestandteil in der<br />
Reduktion von umweltschädlichen<br />
Substanzen in unserem Unternehmen,<br />
wie zum Beispiel von Bioziden.<br />
Zusätzlich zu geschlossenen <strong>Wasser</strong>systemen<br />
aus Nachhaltigkeitsgründen<br />
ist Sonoxide die zweitbeste<br />
Methode, die uns bei der<br />
Erreichung unserer Ziele im Bereich<br />
Umweltschutz und <strong>Wasser</strong>management<br />
unterstützt. Wir möchten<br />
unsere Sonoxide-Behandlung nicht<br />
mehr missen.“<br />
DI. Fohringer, CTO, Marienhütte<br />
Kontakt:<br />
Olaf Pohlmann,<br />
SONOXIDE Commercial Lead EMEA,<br />
Ashland Hercules Water Technologies,<br />
Ashland Industries Nederland BV,<br />
Pesetastraat 5,<br />
NL-2991 XT Barendrecht,<br />
E-Mail: opohlmann@ashland.com<br />
7.-9.2.2012<br />
Essen /Germany<br />
GAS ALS TREIBER DER ENERGIEWENDE<br />
ANALYSIEREN SIE NEUESTE ENTWICKLUNGEN UND STRATEGIEN AUF<br />
DEM KONGRESS DER E-WORLD ENERGY & WATER<br />
Das goldene Zeitalter des Gas<br />
und die Perspektiven für den<br />
deutschen Markt<br />
Gaspreise, Ölpreise, Kohlepreise:<br />
Zusammenhang und Bedeutung<br />
der Preisentwicklungen<br />
Wärmemarkt und Stromerzeugung<br />
im Zeichen der<br />
„Energiewende“<br />
Shale Gas in Europa:<br />
Welche Potenziale<br />
bestehen wirklich?<br />
Gasvertrieb:<br />
Ein Geschäftsmodell für<br />
den Endkundenvertrieb<br />
Wie behaupten <strong>sich</strong> kleinere<br />
Stadtwerke im Gasmarkt?<br />
PROGRAMM UND ANMELDUNG FINDEN SIE UNTER<br />
www.e-world-2012.com/kongress
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
JUMO mTRON T – Your System<br />
Sichere Messwerterfassung, Regelung und Automatisierung<br />
JUMO mTRON T ist ein neues Mess-, Regel- und Automatisierungssystem aus dem Hause JUMO – mit durchgängig<br />
aufeinander abgestimmten Komponenten. Das modular aufgebaute System kann mit seinen universellen<br />
I/O Modulen, der flexiblen Anschlusstechnik und der umfangreichen Kommunikations-, Auswerte- und<br />
Automatisierungssoftware in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. Angefangen bei der<br />
Lebensmittelindustrie über den Ofenbau bis hin zum Maschinenbau. Die hohe Messgenauigkeit und Regelgüte<br />
sowie die robuste und servicefreundliche Mechanik des Systems runden das Angebot für den Anwender ab.<br />
Der Sicherheitsaspekt stand<br />
während des Engineeringprozesses<br />
im Vordergrund. Alle Eingänge<br />
des Mehrkanal-Reglermoduls<br />
sowie des Analogeingangmoduls<br />
4-Kanal sind galvanisch<br />
getrennt. Dies bedeutet für den<br />
Anwender eine <strong>sich</strong>ere und störungsresistente<br />
Erfassung seiner<br />
Messwerte.<br />
Die erfassten Messdaten können<br />
komfortabel mittels einer Software<br />
visualisiert und anschließend für<br />
weitere Zwecke manipulations<strong>sich</strong>er<br />
archiviert werden. Der Anwender<br />
hat von der Messdatenerfassung<br />
bis zur Archivierung keine<br />
Sicherheitslücken im Aufzeichnungs-<br />
und Automatisierungsprozess.<br />
Ein weiterer Sicherheitsaspekt,<br />
der berück<strong>sich</strong>tigt wurde, ist die<br />
bewährte und autarke Regelung.<br />
JUMO mTRONT T kann mit bis zu 30<br />
modularen Mehrkanal-Reglermodulen<br />
pro CPU 120 autarke Regelkreise<br />
gleichzeitig steuern. Das<br />
bedeutet, dass im Fall eines CPU-<br />
Stopps die Regelkreise weiterhin<br />
zuverlässig ihre Regelaufgabe erfüllen<br />
können.<br />
Bei Ausfall eines der Mehrkanal-<br />
Reglermodule kann dieses ohne<br />
großen Aufwand mittels Plug-and-<br />
Play ersetzt werden, sodass der Prozess<br />
keinen langen Stillstandszeiten<br />
ausgesetzt ist. Der Anwender erhält<br />
durch diese Funktionen ein Höchstmaß<br />
an Sicherheit und Zuverlässigkeit<br />
für seine Anlage. Der 100 000-<br />
fach bewährte JUMO-Regelalgorithmus<br />
rundet die Anforderungen an<br />
ein zuverlässiges System ab. Durch<br />
die Freischaltung der Soft-SPS<br />
CoDeSys V3 ist JUMO mTRON T in -<br />
dividuell erweiterbar zu einem vollständigen<br />
und leistungsfähigen<br />
Automatisierungssystem.<br />
JUMO mTRON T bietet dem<br />
Anwender durch seine komplett<br />
aufeinander abgestimmten Komponenten<br />
eine funktionsübergreifende<br />
Gesamtlösung aus einer<br />
Hand.<br />
Multifunktionspanel<br />
mit Modulanordnung<br />
auf<br />
Hutschiene.<br />
Kontakt:<br />
JUMO GmbH & Co. KG,<br />
Moritz-Juchheim-Straße 1,<br />
D-36039 Fulda,<br />
Thomas Diel, Product Manager,<br />
Tel. (0661) 6003-648,<br />
Fax (0661) 6003-508,<br />
E-Mail: thomas.diel@jumo.net<br />
November 2011<br />
1024 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
Industrielle Breitbandanbindung<br />
mit INSYS icom-Geräten<br />
Die industrielle Welt wird zunehmend<br />
dezentral, und immer<br />
häufiger entstehen virtuelle Unternehmen.<br />
Lokale Netzwerke müssen<br />
in solchen Fällen intelligent erweitert<br />
werden, entfernte Stationen<br />
und Anwendungen benötigen effiziente<br />
Anbindungen. Moderne<br />
Applikationen erfordern dabei leistungsfähige<br />
Netze – Breitbandanbindungen<br />
mit industrietauglichen<br />
Geräten werden daher zunehmend<br />
zum Erfolgsfaktor. Der Ausbau und<br />
die Modernisierung vorhandener<br />
Firmennetze z. B. über Glasfaserkabel<br />
sind allerdings teure Unterfangen.<br />
DSL – im Konsumentengeschäft<br />
längst als Standard etabliert<br />
– ist eine kostengünstige Alternative.<br />
Anwendungsgebiete sind beispielsweise<br />
<strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>systeme,<br />
Energieverteilung, Facility<br />
Management oder Videoüberwachung.<br />
SDSL-Lösungen verbinden<br />
lokale Netzwerke oder entfernte<br />
Ethernet-Geräte über konventionelle<br />
Telefondrähte, die oftmals<br />
bereits vorhanden sind. Über SDSL<br />
werden gleichzeitig sowohl Netzwerkdaten<br />
(IP) als auch serielle<br />
Daten (RS232) transportiert. Damit<br />
bieten SDSL-Router auch schnellen<br />
Ersatz für serielle Standleitungen<br />
und überbrücken dabei Distanzen<br />
von bis zu 7 km.<br />
Die neuen SDSL/SHDSL-Router<br />
von INSYS icom erreichen mittels<br />
zwei paralleler SDSL-Kanäle bis zu<br />
11,4 Mbit/s. Die hohe Datenrate<br />
wird in beiden Richtungen (Up- und<br />
Download) erreicht. Je nach Einsatzsituation<br />
können zwei Geräte im<br />
Das DSL-Portfolio von INSYS icom.<br />
paarweisen Einsatz eine Standleitung<br />
zur transparenten Netzwerkverbindung<br />
(Bridging, Ethernet-<br />
Extender) aufbauen oder zwei<br />
getrennte Netzsegmente als Router<br />
miteinander verbinden. ADSL-<br />
Lösun gen realisieren den schnellen<br />
Fernzugriff als Zugang zum Internet.<br />
Die neuen ADSL-Lösungen von<br />
INSYS icom ermöglichen auf Basis<br />
der aktuellen Standards ADSL/<br />
ADSL2/ADSL2+ Datenraten von bis<br />
zu 25 Mbit/s. Sind eine PC-basierte<br />
Steuerung oder ein Datenlogger<br />
bereits vorhanden, kann alternativ<br />
zu den Routern auf kostengünstige<br />
INSYS icom-Modems zurückgegriffen<br />
werden. INSYS icom-Lösungen<br />
sind als embedded-Module oder<br />
zur Montage auf DIN-Hutschienen<br />
erhältlich. Die reinen ADSL-Modems<br />
lassen <strong>sich</strong> einfach per Telnet oder<br />
Browser (lokal, remote) konfigurieren;<br />
die Konfiguration der Router<br />
erfolgt über eine Weboberfläche<br />
mit Schnellstartseite für die einfache<br />
Erstinbetriebnahme. Alle erweiterten<br />
Funktionen für Sicherheit<br />
(Firewall, VPN) und Adressverwaltung<br />
(NAT, DHCP) sind auf INSYS<br />
icom-Routern vorhanden. Dank<br />
einer so genannten Linux-Sandbox,<br />
die in den Routern integriert ist,<br />
können Anwender Skripte und Programme<br />
selbst programmieren und<br />
starten sowie Daten sammeln und<br />
verarbeiten, ohne dass der Router in<br />
seiner Funktionalität beeinträchtigt<br />
wird. Alternativ bietet INSYS icom<br />
für die schnelle Datenübertragung<br />
über das Stromnetz den zur Montage<br />
auf DIN-Hutschienen geeigneten<br />
INSYS Powerline-Adapter an.<br />
Kontakt:<br />
INSYS MICROELECTRONICS GmbH,<br />
Waffnergasse 8,<br />
D-93047 Regensburg,<br />
Tel. (0941) 5 86 92 – 0,<br />
Fax (0941) 5 86 92 – 45,<br />
E-Mail: info@insys-icom.de,<br />
www.insys-icom.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1025
Fokus<br />
Messen · Steuern · Regeln<br />
Online-Messtechnik für schwierigste<br />
<strong>Abwasser</strong>applikationen<br />
Die Anforderungen an ein<br />
Online-TOC-Messsystem für<br />
schwierige <strong>Wasser</strong>applikationen<br />
sind hoch. Es wird eine robuste<br />
Technik für hohe Partikeldichten<br />
und hohe Salzgehalte gefordert.<br />
Der QuickTOC ultra , eine Weiterentwicklung<br />
der erfolgreichen<br />
QuickTOC®-Reihe der LAR AG, integriert<br />
alle Anforderungen in einem<br />
Gerät. Mit Hilfe des einzigartigen<br />
Injektionssystems werden partikelhaltige<br />
Proben problemlos injiziert<br />
und gemessen. Die bewährte und<br />
patentierte katalysator-freie Hochtemperaturmethode<br />
bei 1200 °C<br />
gewährleistet eine Oxidation aller<br />
organischen Bestandteile der Probe.<br />
Bei einer derart hohen Temperatur<br />
werden Salze problemlos aufgeschmolzen.<br />
Verstopfungen durch<br />
Salzablagerungen im Reaktor werden<br />
somit vermieden. Die Multistrom-Option<br />
ermöglicht die gleichzeitige<br />
Messung von bis zu sechs<br />
Probenströmen.<br />
Mit all diesen Eigenschaften eignet<br />
<strong>sich</strong> der QuickTOC ultra besonders<br />
zur Überwachung und Steuerung<br />
von industriellen Prozessen<br />
sowie in der industriellen und kommunalen<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung.<br />
Kontakt:<br />
LAR Process Analysers AG,<br />
Neukoellnische Allee 134,<br />
D-12057 Berlin,<br />
Tel. (030) 278958-59,<br />
Fax (030) 278958-700,<br />
E-Mail: marketing@lar.com,<br />
www.lar.com<br />
Der BonBloc. © BIBUS GmbH<br />
Kleinkläranlagensteuerungen mit und<br />
ohne Stromspar-Ventilblock<br />
Energieverbrauch und Ablaufoptimierung<br />
haben höchste Priorität.<br />
Eine bedarfsgerechte Steuerung<br />
von Ablaufprozessen schont aber<br />
nicht nur den Energieverbrauch<br />
und damit die Umwelt, sondern<br />
auch den Verschleiß der eingesetzten<br />
Maschinenbauteile.<br />
Unter diesen Aspekten hat die<br />
BIBUS GmbH mit dem Sequetrol<br />
und dem BonBloc das Portfolio im<br />
Bereich Umwelttechnik erweitert.<br />
Der Sequetrol bietet in der Basisversion<br />
eine einfache Steuerung mit<br />
LED-Display und Betriebsstundenzähler.<br />
Ein Netzausfallalarm ist<br />
ebenfalls enthalten. Die über<strong>sich</strong>tliche<br />
Programmerstellung erfolgt<br />
mit Hilfe einer Excel®Tabelle. Auf<br />
Kundenwunsch kann diese Steuerung<br />
optional erweitert werden.<br />
Weitere Bausteine sind unter anderem<br />
LCD-Display, frei programmierbare<br />
Menüstruktur, Touchscreen,<br />
Fernabfrage/-steuerung über GSM<br />
oder W-LAN. Der BonBloc vereint<br />
einen Stromsparventilblock mit<br />
einer integrierten Ablaufsteuerung<br />
für SBR-Kleinkläranlagen.<br />
Die Steuerungsbausteine sind<br />
analog zur Sequetrol frei und kundenspezifisch<br />
wählbar.<br />
Der Ventilblock besteht aus<br />
einem Eingang 1“ oder ½“ und vier<br />
Ausgängen ½“ oder ¼“. Anstelle der<br />
herkömmlich verwendeten elektromagnetischen<br />
Ventile, bedient <strong>sich</strong><br />
der BonBloc einer bewährten<br />
Schrittmotoren-Technik aus der<br />
Automobilindustrie. Die wesentlichen<br />
Vorteile dieser Ventiltechnik<br />
sind zuverlässige und geräuschreduzierte<br />
Schaltvorgänge sowie<br />
ein geringerer Energieverbrauch.<br />
Kontakt:<br />
BIBUS GmbH,<br />
Oliver Howein,<br />
Lise-Meitner-Ring 13,<br />
D-89231 Neu-Ulm,<br />
Tel. (0731) 20769-686, Fax (0731) 20769-620,<br />
E-Mail: oh@bibus.de, www.sauerbibus.de<br />
November 2011<br />
1026 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Messen · Steuern · Regeln<br />
Fokus<br />
C3 Compact-Condition-Controller<br />
Die Firma Unitro-Fleischmann<br />
stellt auf der SPS, 22. bis<br />
24. November 2011, Nürnberg, erstmalig<br />
ihre C3 Serie vor.<br />
Bei dieser Serie handelt es <strong>sich</strong><br />
um eine in Kooperation mit einer<br />
Hochschule durchgeführten, völligen<br />
Neuentwicklung von kompakten,<br />
intelligenten, modularen Fernwirk-Komponenten<br />
im 22,5 mm<br />
Aufschnappgehäuse mit integriertem<br />
Hutschienenbus.<br />
Die momentane Ausbaustufe<br />
beinhaltet:<br />
""<br />
Digitale 8fach I/O Module 24V<br />
AC/DC bzw. Relaisausgänge<br />
potenzialfrei.<br />
""<br />
Analogmodul 4fach wahlweise<br />
IN/Out 0–10V/0–20mA/PT 100<br />
mit Potenzialtrennung.<br />
""<br />
LON-Bus Modul FT 5000 und<br />
""<br />
LON-Bus Powerline Modul PL<br />
3150 jeweils mit USB Parametrierschnittstelle.<br />
In Kürze sind folgende Schnittstellen<br />
lieferbar:<br />
""<br />
Ethernet- TCP/IP mit Remote<br />
Manager<br />
""<br />
Telefon-Sprachmeldung<br />
""<br />
Fernalarmierung über<br />
VDS-Protokoll<br />
""<br />
GSM/GPRS<br />
Drahtlos Datenübertragung<br />
""<br />
LWL Datenübertragung<br />
""<br />
Klartextanzeige mit<br />
Protokolldrucker<br />
Durch die verschiedenen Schnittstellen<br />
und die montagefreundlichen<br />
Aufschnappgehäuse mit<br />
Steck-Schraubklemmenanschluss<br />
ist das System universell einsetzbar<br />
zur Steuerung und Überwachung<br />
von Versorgungs- und Betriebseinrichtungen.<br />
Der C3 Compact-Condition-Controller.<br />
Kontakt:<br />
Unitro-Fleischmann,<br />
Inhaber: Jürgen Fleischmann,<br />
Gaildorfer Straße 15,<br />
D-71522 Backnang,<br />
Tel. (07191) 141-0,<br />
Fax (07191) 141-299,<br />
www.unitro.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1027
Nachrichten<br />
Branche<br />
Sauberes <strong>Wasser</strong> durch deutsch-russische Kooperation<br />
Erster Russian-German Water Partnership Day in Moskau<br />
Im Pestrowski-<br />
Schloss startete<br />
die zweitägige<br />
Veranstaltung<br />
von<br />
German Water<br />
Partnership.<br />
Quelle GWP<br />
Der erste Russian-German Water<br />
Partnership Day fand vom 26.<br />
bis 27. Oktober 2011 in Moskau<br />
statt. Ziel der Veranstaltung war es,<br />
sowohl die politischen Aspekte als<br />
auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten<br />
und Rahmenbedingungen<br />
für eine internationale Zusammenarbeit<br />
im Bereich der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
zu diskutieren, bestehende<br />
Kontakte und Netzwerke zu intensivieren<br />
und neue Vernetzungen zu<br />
initiieren.<br />
Am ersten Tag der Veranstaltung<br />
sprachen im Petrowski-Schloss,<br />
dem Empfangshaus der Moskauer<br />
Regierung, hochrangige Vertreter<br />
aus dem Föderationsrat der Russischen<br />
Föderation, den deutschen<br />
und russischen Ministerien sowie<br />
den <strong>Wasser</strong>vereinigungen und -Verbänden<br />
beider Länder über politische<br />
und wirtschaftliche Ansätze für<br />
effektive Kooperation im Bereich<br />
<strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong>.<br />
Im Fokus des zweiten Veranstaltungstages<br />
standen verschiedene<br />
informative Fachvorträge deutscher<br />
Unternehmen und russischer Entscheidungsträger<br />
sowie Roundtable-Gespräche<br />
zu den Themen<br />
Finanzierung, Kommunale <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
und Industriewasserwirtschaft.<br />
Hintergrundinformation<br />
Landesweit sind erst 75 Prozent der<br />
Bevölkerung an die zentrale Trinkwasserversorgung<br />
angeschlossen.<br />
Das bedeutet, dass über 30 Millionen<br />
Menschen ihr <strong>Wasser</strong> aus dem<br />
Brunnen oder aus anderen Quellen<br />
beziehen. Doch auch die zentrale<br />
Versorgung garantiert kein sauberes<br />
<strong>Wasser</strong> aus dem Hahn. Laut <strong>Wasser</strong>strategie<br />
werden nur knapp 60<br />
Prozent der in die zentrale <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
eingespeisten Menge<br />
(pro Jahr 18 Kubikkilometer) zuvor<br />
aufbereitet und gereinigt. Nicht<br />
zuletzt vor diesem Hintergrund hat<br />
die Regierung in Moskau die strategische<br />
Bedeutung der kostbaren<br />
Ressource erkannt und eine <strong>Wasser</strong>strategie<br />
verabschiedet, die Maßnahmen<br />
für die nächsten zehn Jahre<br />
definiert. Von der rationelleren Nutzung<br />
der Ressourcen, über die Verringerung<br />
der Transportverluste<br />
und Verbesserung der Trinkwasserqualität<br />
bis hin zur Verringerung der<br />
<strong>Wasser</strong>intensität des Bruttoinlandsprodukts.<br />
Die <strong>Wasser</strong>strategie und das<br />
Programm „Reines <strong>Wasser</strong>“<br />
Neben der <strong>Wasser</strong>strategie hat Moskau<br />
noch ein staatliches Programm<br />
„Sauberes <strong>Wasser</strong>“ erarbeitet, in<br />
dem konkret Maßnahmen zur Trinkwasserversorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
beschrieben werden.<br />
In dieses Programm sollen jährlich<br />
20 Mrd. Rubel (rund 500 Mio. Euro)<br />
aus dem Staatshaushalt fließen.<br />
Dafür ist Russland auf die<br />
Unterstützung privater Partner<br />
angewiesen, die im Rahmen von<br />
Public Private Partnerships die<br />
Anlagen modernisieren und das<br />
entsprechende Know-how für den<br />
Betrieb mitbringen.<br />
Für die deutschen Unternehmen<br />
sind somit zentrale Fragestellungen:<br />
Wie können Know-how, Technologie<br />
und Erfahrung aus der ganzen<br />
Breite des <strong>Wasser</strong>sektors in die Weiterentwicklung<br />
der russischen <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
integriert werden?<br />
Welche Kooperationen und Finanzierungsmodelle<br />
sind geeignet?<br />
GWP als zentraler<br />
Ansprechpartner<br />
Aktuell bündelt GWP 332 Mitglieder<br />
aus dem gesamten <strong>Wasser</strong>sektor<br />
unter dem Dach von German Water<br />
Partnership ihr Wissen und ihre<br />
Erfahrungen, und transferieren<br />
deutsches Know-how und innovative<br />
Technologien international.<br />
Experten der <strong>Wasser</strong>branche aus<br />
Industrie und Forschung haben <strong>sich</strong><br />
im Länderforum Russland, eines der<br />
17 internationalen regionalspezifischen<br />
Arbeitsgremien von GWP,<br />
zusammengeschlossen. Ziel des<br />
Länderforums ist es, in der Zielregion<br />
langfristige Kontakte aufzubauen,<br />
Projekte anzustoßen und<br />
nach den Anforderungen des Landes<br />
individuell angepasste wasserwirtschaftliche<br />
Lösungen zu erarbeiten.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.germanwaterpartnership.de<br />
November 2011<br />
1028 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Nachrichten<br />
Uferschutz und Ökologie<br />
Internetportal informiert über technisch-biologische Ufer<strong>sich</strong>erungen<br />
an Binnenwasserstraßen<br />
Um die Ufer von Binnenschifffahrtsstraßen<br />
dauerhaft vor<br />
Erosion und hydraulischen Belastungen<br />
durch den Schiffsverkehr zu<br />
schützen, <strong>sich</strong>erte man sie im<br />
Bereich der <strong>Wasser</strong>- und Schifffahrtsverwaltung<br />
des Bundes (WSV)<br />
bislang in der Regel mit Steinschüttungen<br />
oder Spundwänden. Inzwischen<br />
bieten <strong>sich</strong> jedoch komplex<br />
aufgebaute technisch-biologische<br />
Ufer<strong>sich</strong>erungen als ökologisch verträgliche<br />
Alternative dazu an: Der<br />
innovative Uferschutz setzt auf eine<br />
geschickte Kombination technischer<br />
Maßnahmen mit einem darauf<br />
abgestimmten Bewuchs unterschiedlicher<br />
Pflanzenarten.<br />
Allerdings sind die technischbiologischen<br />
Uferbefestigungen<br />
noch nicht ausgereift. Erste Erfahrungen<br />
liegen vor, wurden allerdings<br />
hauptsächlich an kleineren<br />
Fließgewässern gesammelt. Bei der<br />
Umsetzung der Europäischen <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
(EG-WRRL), die<br />
einen Schwerpunkt auf die ökologischen<br />
Aspekte bei Aus- und Neubauten<br />
sowie beim Unterhalt von<br />
<strong>Wasser</strong>straßen legt, geht es nun<br />
auch darum, ein den bisherigen<br />
Uferschutzmaßnahmen entsprechendes,<br />
verlässliches Regelwerk<br />
für technisch-biologische Ufer<strong>sich</strong>erungen<br />
zu schaffen.<br />
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt<br />
ermitteln deshalb<br />
Wissenschaftler und Ingenieure der<br />
Bundesanstalt für <strong>Wasser</strong>bau (BAW)<br />
und der Bundesanstalt für Gewässerkunde<br />
(BfG) systematisch das<br />
Potenzial der technisch-biologischen<br />
Uferbefestigungen. In um -<br />
fangreichen Untersuchungen testen<br />
sie unter anderem deren hydraulische<br />
Belastbarkeit unter<br />
Schifffahrtsbedingungen und entwickeln<br />
Ansätze für die Weiterentwicklung<br />
dieser innovativen Ufer<strong>sich</strong>erungsmaßnahmen.<br />
Relaunch des Internetportals<br />
Unter der Adresse http://ufer<strong>sich</strong>erung.baw.de<br />
gibt jetzt ein neu<br />
gestaltetes und über<strong>sich</strong>tlich<br />
strukturiertes Internetportal<br />
Auskunft zum Stand<br />
der gemeinsamen Forschungs-<br />
und Entwicklungsarbeiten<br />
von BAW<br />
und BfG. Die Website bietet<br />
dem Nutzer jetzt noch<br />
mehr Service, gleichzeitig<br />
sind die Informa tionen zur<br />
technisch-biologischen<br />
Ufer<strong>sich</strong>erung nun auch in<br />
englischer Sprache hinterlegt.<br />
Ebenfalls neu sind<br />
spezielle Hinweise für die<br />
Praxis. In einem Downloadbereich<br />
stehen Forschungsberichte,<br />
Vorträge<br />
und Veröffentlichungen,<br />
die aus dem Forschungsund<br />
Entwicklungsprojekt<br />
der beiden Bundeseinrichtungen<br />
heraus entstanden<br />
sind, zeitnah zur Verfügung.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.baw.de<br />
Aufbau eines Deckwerks. Die Ufer<strong>sich</strong>erung mit<br />
Deckwerken hat <strong>sich</strong> an der <strong>Wasser</strong>straße bewährt.<br />
Quelle/Urheberinfo: BAW<br />
Trinkwasserbehälter<br />
In bewährter Wiedemanntechnik sanieren wir jedes Jahr nahezu<br />
100 Trinkwasserbehälter, seit 1947, Jahr für Jahr.<br />
Von der Zustandsanalyse, Beratung und Ausarbeitung des<br />
Sanierungs kon zeptes bis zur fix und fertigen Ausführung.<br />
Abdichtung<br />
Betoninstandsetzung<br />
Rissinjektion<br />
Stahlkorrosionsschutz<br />
Zentrale<br />
65189 Wiesbaden<br />
Weidenbornstr. 7-9<br />
Tel. 0611/7908-0<br />
Fax 0611/761185<br />
Niederlassung<br />
01159 Dresden<br />
Ebertplatz 7-9<br />
Tel. 0651/42441-0<br />
Fax 0351/42441-11<br />
Wiedemann<br />
Instandsetzung und Schutz von Betonbauwerken<br />
Statische Verstärkung -CFK-Lamellen-<br />
Vergelung<br />
Spritzbeton / Spritzmörtel<br />
Mineralische Beschichtung<br />
Unsere Fachleuchte sind für Sie da, rufen Sie an!<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.wiedemann-gmbh.com<br />
Zertifiziert nach<br />
DIN EN ISO 9001:2008<br />
seit 1947<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1029
Nachrichten<br />
Branche<br />
acqua alta in Hamburg als bedeutendes<br />
internationales Forum für Klimafolgen<br />
und Hochwasserschutz bestätigt<br />
Rund 70 Aussteller<br />
aus<br />
neun Ländern<br />
präsentierten<br />
<strong>sich</strong> auf der<br />
aqua alta.<br />
© Stephan<br />
Wallocha (WA)<br />
Unter dem aktuellen Eindruck<br />
der Flutkatastrophe in Südostasien<br />
ist in der europäischen<br />
Umwelthauptstadt Hamburg die<br />
acqua alta, Fachmesse mit internationalem<br />
Kongress für Klimafolgen,<br />
Hochwasserschutz und <strong>Wasser</strong>bau,<br />
zu Ende gegangen. Drei Tage, vom<br />
11. bis 13. Oktober 2011, lang präsentierten<br />
mehr als 70 Referenten<br />
aus 13 Nationen im CCH-Congress<br />
Center Hamburg neueste Forschungsergebnisse<br />
und diskutierten<br />
über Anpassungsstrategien in<br />
Deutschland und anderen Ländern<br />
sowie konkrete Maßnahmen insbesondere<br />
für den Hochwasser- und<br />
Küstenschutz. „Besonders erfreulich<br />
ist, dass <strong>sich</strong> der Auslandsanteil<br />
der Fachbesucher mit 39 Prozent<br />
nahezu verdoppelt hat. Damit hat<br />
die acqua alta erneut gezeigt, dass<br />
sie für Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft<br />
und öffentlicher Hand ein<br />
wichtiges Forum für intensiven Wissenstransfer,<br />
Dialog und Networking<br />
ist“, zog Bernd Aufderheide,<br />
Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der Hamburg Messe und Congress,<br />
Bilanz. „Wir haben viel Bestätigung<br />
für die Notwendigkeit dieser Fachveranstaltung<br />
und für unser Konzept<br />
bekommen. Gerade jetzt wird<br />
deutlich, dass <strong>sich</strong> die globalen Folgen<br />
des Klimawandels nur durch<br />
gemeinsame internationale Bemühungen<br />
bewältigen lassen.“<br />
Insgesamt besuchten rund 800<br />
Teilnehmer aus 17 Nationen die<br />
Messe, um <strong>sich</strong> über neueste Forschungsergebnisse,<br />
Projekte und<br />
Anpassungsstrategien zu informieren.<br />
Auf großes Interesse stießen<br />
ebenso die rund 70 Aussteller aus<br />
neun Ländern, die ihre Produktneuheiten<br />
und Dienstleistungen, unter<br />
anderem für Hochwasser- und Küstenschutz,<br />
Risiko- und Katastrophenmanagement,<br />
<strong>Wasser</strong>bau sowie<br />
Forschung und Entwicklung,<br />
präsentierten.<br />
Dr. Helge Wendenburg, Ministerialdirektor<br />
im Bundesumweltministerium,<br />
das die Schirmherrschaft über<br />
die Fachveranstaltung übernommen<br />
hatte: „Von der acqua alta sind<br />
wertvolle Impulse dafür ausgegangen,<br />
wie man Städte und Gemeinden<br />
fit macht, auch unter Klimawandel-Bedingungen<br />
zukunftsfest zu<br />
sein oder zu werden. Diese Fachveranstaltung<br />
hat deutlich gezeigt, dass<br />
man <strong>sich</strong> verstärkt über flexible und<br />
nachrüstbare Lösungen unterhält.<br />
Dies wird für alle Städte und Kommunen<br />
ganz wesentlich sein. Wir<br />
müssen die Verantwortlichen befähigen,<br />
mit den Risiken des Klimawandels<br />
umzugehen.“<br />
Prof. Dr. Walter Leal, Leiter des<br />
Forschungszentrums „Applications<br />
of Life Sciences“ an der Hochschule<br />
für angewandte Wissenschaften<br />
Hamburg: „Die acqua alta ist sehr<br />
wichtig und stößt auch auf großes<br />
internationale Interesse – gerade<br />
jetzt, wo die Ereignisse in Südostasien<br />
zeigen, wie aktuell die Themen<br />
Klimafolgen und Hochwasserschutz<br />
sind. Zum einen ist sie ein<br />
gutes Forum, bei dem man die neuesten<br />
technologischen Entwicklungen<br />
präsentieren und über sie diskutieren<br />
kann. Zum anderen kamen<br />
hier nicht nur Wissenschaftler, sondern<br />
auch Vertreter von Industrie<br />
und öffentlicher Hand zusammen.<br />
Es ist leider eine Tatsache, dass <strong>sich</strong><br />
Extremwetterereignisse wiederholen,<br />
daher wird die acqua alta weiter<br />
an Bedeutung gewinnen.“ Dr. Lam<br />
Hung Son, Mekong River Commission,<br />
Kambodscha: „Die Teilnahme<br />
an diesem internationalen Kongress<br />
war für uns eine sehr gute Gelegenheit,<br />
andere Experten zu treffen und<br />
unsere Arbeit darzustellen. Vor<br />
allem für das Networking war die<br />
acqua alta gut. Es ist sehr wichtig,<br />
hin<strong>sich</strong>tlich der Anpassungsstrategien<br />
international voneinander zu<br />
lernen.“<br />
Die nächste acqua alta findet im<br />
Herbst 2013 auf dem Gelände der<br />
Hamburg Messe und Congress statt.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.acqua-alta.de<br />
November 2011<br />
1030 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
ECWATECH 10TH ANNIVERSARY<br />
ECWATECH<br />
5-8 June 2012<br />
IEC «Crocus Expo», Moscow, Russia<br />
The Best Water Event<br />
in Russia, CIS and<br />
Eastern Europe<br />
ECWATECH-2012<br />
For more information visit<br />
www.ecwatech.com<br />
Approved<br />
Event
Nachrichten<br />
Branche<br />
Jubiläum: 10. Goldener Kanaldeckel des IKT<br />
Der „Goldene Kanaldeckel“ des IKT wird zehn Jahre alt<br />
Der „Goldene Kanaldeckel“ feiert<br />
in diesem Jahr sein 10. Jubiläum.<br />
Der „Oscar“ der Kanalbranche<br />
wird auf dem IKT-Forum „Klima,<br />
Energie und Kanalisation“ am 31.<br />
Begehrte Trophäe: „Oscar“ der Kanalbranche.<br />
Goldener Kanaldeckel 2010: Hans-Josef Düwel, Ludger<br />
Wördemann, Lothar Dören, Andrea Hollenberg,<br />
Mario Hecker, Roland W. Waniek (v.l.n.r.).<br />
Der Goldene Kanaldeckel wird während des IKT-<br />
Forums „Klima, Energie und Kanalisation“ verliehen.<br />
Januar 2012 verliehen. Weitere<br />
Informationen unter www.ikt.de/<br />
klima2012<br />
Der „Goldene Kanaldeckel“ richtet<br />
<strong>sich</strong> an Mitarbeiter von Kanalnetzbetreibern<br />
wie Stadtentwässerungen,<br />
Tiefbauämter und Stadtwerken,<br />
sei es in öffentlicher oder<br />
privater Trägerschaft. Ziel des Goldenen<br />
Kanaldeckels ist es, die<br />
Bedeutung der Kanalisation in das<br />
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu<br />
rufen.<br />
Mit dem „Goldenen Kanaldeckel“<br />
werden herausragende Leistungen<br />
einzelner Mitarbeiter prämiert. Der<br />
Öffentlichkeit wird damit beispielhaft<br />
verdeutlicht, welche Technologien,<br />
welche wirtschaftliche Dimension<br />
und welche Leistungen für den<br />
Gewässerschutz hinter einer als<br />
selbstverständlich wahrgenommenen<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitung stehen. Auf<br />
diese Weise wird ein positives Image<br />
der gesamten Branche gefördert,<br />
also auch der Industrie, der Bauunternehmen<br />
und der Dienstleister.<br />
Als Symbol für diesen Preis steht ein<br />
Kanaldeckel, weil die Kanaldeckel in<br />
öffentlichen Straßen die <strong>sich</strong>tbare<br />
Schnittstelle zwischen Bürger und<br />
Kanalisation sind.<br />
Fakten und Fristen<br />
Der „Goldene Kanaldeckel“ des IKT<br />
wird im gesamten Bundesgebiet<br />
öffentlich ausgelobt und für die drei<br />
Schwerpunkte Neubau, Sanierung<br />
und Betrieb verliehen:<br />
""<br />
1. Preis: 2 000,00 Euro<br />
""<br />
2. Preis: 1 000,00 Euro<br />
""<br />
3. Preis: 500,00 Euro<br />
Kandidatenvorschläge können bis<br />
zum 11. Januar 2012 per Post, Fax<br />
oder E-Mail an das IKT gesendet<br />
werden. Dafür gibt es keinerlei<br />
Formvorschriften. Es ist vielmehr<br />
dem Kandidaten überlassen, die<br />
Bewerbung interessant und aufschlussreich<br />
zu gestalten. Es muss<br />
der Jury eine nachvollziehbare und<br />
stichhaltige, schriftliche Begründung<br />
vorgelegt werden. Schließlich<br />
entscheidet die Jury nach Aktenlage.<br />
Worauf es der Jury ankommt<br />
und wie eine Bewerbung zielgerichtet<br />
und Erfolg versprechend gestaltet<br />
werden kann, verraten sieben<br />
Tipps: Dazu mehr unter www.ikt.de/<br />
down/11_09_siebentipps.pdf<br />
Jury<br />
Eine unabhängige Jury aus anerkannten<br />
Fachleuten wird entscheiden,<br />
wem in diesem Jahr der „Goldene<br />
Kanaldeckel“ verliehen wird.<br />
Die Mitglieder der Jury sind:<br />
""<br />
Artur Graf zu Eulenburg<br />
(bi-UmweltBau)<br />
""<br />
Dr.-Ing. Marco Künster<br />
(Güteschutz Kanalbau)<br />
""<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf<br />
(DWA-Präsident)<br />
""<br />
Roland W. Waniek (IKT)<br />
Öffentlichwirksam<br />
Die Projekte der Preisträger werden<br />
vom IKT ausführlich dargestellt und<br />
sowohl der Fachöffentlichkeit als<br />
auch einem breiten Publikum, beispielsweise<br />
Kommunal- und Landespolitikern,<br />
vorgestellt. Damit<br />
wird gezeigt, dass bei Kanalnetzbetreibern<br />
Menschen tätig sind, deren<br />
Projekte, Engagement, Innovationsfreude<br />
und Kreativität Vorbildfunktion<br />
haben.<br />
Kontakt:<br />
IKT – Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur gGmbH,<br />
Exterbruch 1,<br />
D-45886 Gelsenkirchen,<br />
Tel. (0209) 17806-0,<br />
Fax (0209) 17806-88,<br />
E-Mail: info@ikt.de,<br />
www.ikt.de<br />
November 2011<br />
1032 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Branche<br />
Grün gekauft<br />
und Geld gespart<br />
Nachrichten<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe beziehen mehrheitlich<br />
Strom aus erneuerbaren Quellen<br />
Die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe beziehen im zweiten Halbjahr<br />
2011 mehr als die Hälfte ihres Stroms aus regenerativen<br />
Energien und sparen dabei Geld ein. Dafür nutzt das<br />
Unternehmen den Paragrafen 37 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes<br />
(EEG). Er regelt, dass der gesamte Stromverbrauch<br />
von der EEG-Umlage befreit wird, wenn mehr als<br />
50 % des Stromverbrauchs durch regenerative Energien ge -<br />
deckt wird.<br />
Um das Preisrisiko zu beherrschen, beschafft das Unternehmen<br />
seinen Strom in Teilen ein bis drei Jahre vor dem<br />
Bezug. Und zwar in einem Mix aus Strom aus herkömmlichen<br />
(„Graustrom“) und erneuerbaren („Grünstrom“) Energiequellen.<br />
Dieser Strommix entsprach bisher dem deutschen<br />
Durchschnitt aus etwa 50 % Kohle, 20 % Kernkraft,<br />
18 % erneuerbaren Energien und 12 % aus Gas- und Ölkraftwerken.<br />
Der „Grünstrom“ ist komplett aus regenerativer<br />
Erzeugung, also aus Wind, Biogas und Fotovoltaik.<br />
Die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe brauchen pro Jahr rund 314<br />
Gigawattstunden (GWh, Giga = Milliarde) Strom, von denen<br />
etwa 250 GWh eingekauft und rund 64 GWh selbst erzeugt<br />
werden – aus den erneuerbaren Energiequellen Klärschlamm<br />
in allen sechs Klärwerken sowie Sonnenlicht mit der größten<br />
Solaranlage Berlins im <strong>Wasser</strong>werk Tegel. Setzt man einen<br />
Vierpersonen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von<br />
4500 kWh voraus, dann entspricht die von den <strong>Wasser</strong>betrieben<br />
be nötigte Energiemenge der einer Stadt mit 280 000<br />
Einwohnern. So viele Menschen leben in etwa im Berliner<br />
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (271 000 Einwohner) oder in<br />
der hessischen Hauptstadt Wiesbaden (276 000 Einwohner).<br />
Weitere Informationen:<br />
www.bwb.de<br />
<strong>gwf</strong>Gas<br />
Erdgas<br />
Die Fachzeitschrift für<br />
Gasversorgung und<br />
Gaswirtschaft<br />
Jedes zweite Heft mit<br />
Sonderteil R+S<br />
Recht und Steuern im<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
Vom Fach fürs Fach<br />
Sichern Sie <strong>sich</strong> regelmäßig diese führende<br />
Publi kation. Lassen Sie <strong>sich</strong> Antworten geben auf<br />
alle Fragen zur Gewinnung, Erzeugung, Verteilung<br />
und Verwendung von Gas und Erdgas.<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-gas-erdgas.de<br />
✁<br />
<strong>gwf</strong> Gas/Erdgas erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Str. 145, 81671 München<br />
2Hefte<br />
gratis<br />
zum<br />
Kennenlernen!<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0)931 / 4170-492<br />
oder per Post: Leserservice <strong>gwf</strong> • Postfach 91 61 • 97091 Würzburg<br />
Ja, senden Sie mir die nächsten beiden Ausgaben des Fachmagazins <strong>gwf</strong> Gas/<br />
Erdgas gratis zu. Nur wenn ich überzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen<br />
nach Erhalt des zweiten Hefts schriftlich absage, bekomme ich <strong>gwf</strong> Gas/Erdgas<br />
für zunächst ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von € 170,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 15,- / Ausland: € 17,50) pro Halbjahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) € 85,- zzgl. Versand<br />
pro Halbjahr.<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Regenerative Erzeugung<br />
aus Windkraft.<br />
© Margot Kessler<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
PAGWFW1111<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>gwf</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene<br />
Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag<br />
oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Nachrichten<br />
Branche<br />
Deutliche Nachbesserungen<br />
beim Pflanzenschutzgesetz erforderlich<br />
Konsequente<br />
Regelungen für<br />
Gewässerrandstreifen<br />
sind<br />
notwendig.<br />
@ Tim Gaspary<br />
ass <strong>sich</strong> der Bundesrat auf<br />
„Dklare und verbindliche<br />
Vorgaben zu den Gewässerrandstreifen<br />
einigen konnte, ist ein erster<br />
Schritt in die richtige Richtung.<br />
Die vor gesehenen Gewässerrandstreifen<br />
mit einer Breite von nur<br />
einem Meter sind jedoch für den<br />
Schutz der Gewässerressourcen<br />
nicht ausreichend. Aus unserer<br />
Sicht sind Pufferzonen mit einer<br />
Breite von zehn Metern erforderlich“,<br />
so Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer<br />
<strong>Wasser</strong>/ <strong>Abwasser</strong> des<br />
Bundesverbandes der Energie- und<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft (BDEW) in Berlin.<br />
„Wichtig sind jetzt die Beratungen<br />
im Deutschen Bundestag zur Gesetzesvorlage.“<br />
Die Festlegung ausreichender<br />
Pufferzonen gehöre zu den<br />
wichtigsten und effektivsten Maßnahmen<br />
zum Schutz der Gewässer.<br />
Sie seien besonders geeignet, um<br />
den Eintrag unerwünschter Stoffe<br />
beispielsweise von angrenzenden<br />
Ackerflächen in die Gewässer zu<br />
vermeiden oder zumindest zu reduzieren.<br />
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln<br />
in <strong>Wasser</strong>schutz-<br />
und Trinkwassergewinnungsgebieten<br />
müsse zudem gesondert geregelt<br />
werden. Dabei müsse der Fokus<br />
darauf liegen, eine Gefährdung der<br />
Grund- und Oberflächengewässer<br />
in solchen Gebieten unter allen<br />
Umständen zu vermeiden.<br />
Positiv bewerte der BDEW die<br />
Entscheidungen des Bundesrates<br />
zum Internet- und Versandhandel<br />
mit Pflanzenschutzmitteln. „Wir<br />
begrüßen das Votum des Bundesrats,<br />
nach dem Internetanbieter<br />
zukünftig ihren aktuellen Sachkundenachweis<br />
im Internet veröffentlichen<br />
müssen“ so Weyand. Konsequent<br />
und richtig sei auch das<br />
Votum des Bundesrates, die Pflicht<br />
zur Wiederauffrischung der Sachkunde<br />
schon nach drei statt erst<br />
nach fünf Jahren zu verankern. „Mit<br />
dem neuen Pflanzenschutzgesetz<br />
muss der Gesetzgeber neuen Trends<br />
wie dem zunehmenden Internetund<br />
Versandhandel von Pflanzenschutzmitteln<br />
ausreichend Rechnung<br />
tragen. Aus BDEW-Sicht<br />
besteht hier die große Gefahr einer<br />
Ausweitung des illegalen Handels.<br />
Der Gesetzgeber sowie die zuständigen<br />
Behörden müssen dafür sorgen,<br />
dass in Deutschland nur zugelassene<br />
Pflanzenschutzmittel verkauft<br />
und eingesetzt werden. Es gilt,<br />
den Verbraucher, die Umwelt und<br />
die Gewässer inklusive des Trinkwassers<br />
vor diesen Stoffen zu schützen“,<br />
so Weyand. „Der Schutz der<br />
Gewässerressourcen hat für die<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft hohe Priorität. Das<br />
neue Pflanzenschutzgesetz muss<br />
eine Balance zwischen den Interessen<br />
der landwirtschaftlichen Produktion<br />
und dem Ressourcenschutz<br />
finden.“<br />
Weitere Informationen:<br />
www.bdew.de<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH<br />
Grasstraße 11 • 45356 Essen<br />
Telefon (02 01) 8 61 48-60<br />
Telefax (02 01) 8 61 48-48<br />
www.aquadosil.de<br />
November 2011<br />
1034 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
NETZWERK WISSEN<br />
Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,<br />
Forschung und Entwicklung<br />
© Trexer Wikipedia.de<br />
Studienort Aachen im Porträt<br />
""<br />
Einleitung von Prof. Dr. Johannes Pinnekamp<br />
""<br />
„Mehr als nur gute Karrierechancen“ –<br />
RWTH Aachen startet neuen Studiengang Umweltingenieurwissenschaften<br />
""<br />
Umwelt- und Gewässerschutz im Fokus – Das ISA der RWTH Aachen stellt <strong>sich</strong> vor<br />
""<br />
Vier Projekte, die etwas bewegen – Die Forschungsschwerpunkte des Instituts für<br />
Siedlungswasserwirtschaft (ISA)<br />
""<br />
Die Führungskraft-Schmiede Deutschlands –<br />
Jedes 5. Vorstandsmitglied kommt von der RWTH Aachen<br />
""<br />
RWTH ist Spitzenreiter bei Stipendien<br />
""<br />
Wo der Quell des Lebens sprudelt – Als „Stadt des <strong>Wasser</strong>s“ blickt Aachen auf<br />
eine geschichtsträchtige Vergangenheit zurück<br />
Forschungs-Vorhaben und -Ergebnisse<br />
""<br />
Sächsische Forscher arbeiten an <strong>Wasser</strong>versorgung Brasílias<br />
""<br />
Netzwerk gegen Umweltprobleme im Mittelmeerraum –<br />
Drohender Klimawandel<strong>Wasser</strong>versorgung Brasilias<br />
""<br />
Der Bachflohkrebs als Assistent – Eine neue Studie zeigt, wie Ozonierung <strong>Abwasser</strong> reinigt
NETZWERK WISSEN Einleitung<br />
Forschung und Lehre für das <strong>Wasser</strong><br />
Univ.-Prof. Dr.-<br />
Ing. Johannes<br />
Pinnekamp<br />
<strong>Wasser</strong> ist die Grundvoraussetzung<br />
allen Lebens. Es hat für<br />
den Menschen die gleiche essentielle<br />
Bedeutung wie Nahrung oder<br />
Sauerstoff. <strong>Wasser</strong> ist nicht nur ein<br />
Lebensmittel, sondern ein Überlebensmittel.<br />
Die Menschheit nutzt<br />
<strong>Wasser</strong> für viele unterschiedliche<br />
Zwecke: als Nahrungsmittel, aber<br />
auch zur Bewässerung in der Landwirtschaft,<br />
für die verschiedenen<br />
Arten der Energiegewinnung, zu<br />
Transportzwecken oder für Freizeit<br />
und Erholung.<br />
<strong>Wasser</strong> ist aber auch eine be -<br />
drohte Ressource. Vor wenigen<br />
Tagen hat die Zahl der Menschen<br />
auf der Erde die 7 Milliarden überschritten.<br />
Mehr als die Hälfte davon<br />
lebt in urbanen Zentren, das Wachstum<br />
der Weltbevölkerung findet<br />
fast ausschließlich in Entwicklungsund<br />
Schwellenländern statt. Die<br />
Bereitstellung von Trinkwasser in<br />
ausreichender Menge und Qualität,<br />
aber auch die Ableitung und Reinigung<br />
der anfallenden Abwässer<br />
sind Probleme von hoher Dringlichkeit.<br />
Eine weitere wichtige Herausforderung<br />
für die Ressource <strong>Wasser</strong> ist<br />
der Klimawandel mit den durch ihn<br />
verursachten Änderungen der Niederschlagscharakteristik.<br />
Als Antwort<br />
auf diese Veränderungen werden<br />
wir die Bemessungsgrundlagen,<br />
die Struktur und den Betrieb<br />
unserer Entwässerungssysteme an -<br />
passen müssen. Der demographische<br />
Wandel in Deutschland und<br />
Änderungen im Verbrauchsverhalten<br />
führen, regional allerdings<br />
unterschiedlich, zu Reduzierungen<br />
der benötigten Trinkwassermengen<br />
mit erheblichen Folgen für den<br />
Betrieb und die Finanzierung der<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>netze.<br />
Der Gebrauch einer stetig wachsenden<br />
Zahl von Chemikalien in<br />
Haushalt, Landwirtschaft und In -<br />
dustrie, aber auch die immer feiner<br />
werdenden Analysenverfahren führen<br />
dazu, dass wir in großem<br />
Umfang im <strong>Abwasser</strong>, im Oberflächenwasser,<br />
aber immer häufiger<br />
auch im Trinkwasser Mikroverunreinigungen<br />
identifizieren. Die Fachwelt<br />
forscht und diskutiert intensiv<br />
über die Frage, ob diese einen negativen<br />
Einfluss auf die Gesundheit<br />
des Menschen haben können und<br />
mit welchen Strategien und Technologien<br />
die Belastung vermindert<br />
werden kann. Auch die hygienischen<br />
Fragen, denen lange Zeit nur<br />
noch wenig Beachtung geschenkt<br />
wurde, spielen wieder eine wichtigere<br />
Rolle.<br />
Die Lösung der geschilderten<br />
Probleme erfordert eine Bündelung<br />
von Erfahrungen und Kompetenzen.<br />
<strong>Wasser</strong> ist ein idealer Kristallisationskern<br />
für interdisziplinäre<br />
Forschung und Entwicklung. Das<br />
Thema tangiert so viele Bereiche<br />
und bietet so unterschiedliche<br />
Aspekte, dass nur durch eine<br />
Zusammenarbeit von Natur, Kulturund<br />
Ingenieurwissenschaften zu -<br />
kunftsfähige Lösungen gefunden<br />
werden können. Die RWTH Aachen<br />
bietet hierfür ein exzellentes<br />
Umfeld.<br />
Die <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft<br />
ist international einer der am stärksten<br />
wachsenden Märkte. Deutsche<br />
Technologie und deutsches Knowhow<br />
sind weltweit hoch angesehen.<br />
Der Engpass bei der Erschließung<br />
dieser Märkte liegt in der Zahl und<br />
der Kompetenz gut ausgebildeter<br />
Ingeneurinnen und Ingenieure.<br />
Dabei ändern <strong>sich</strong> klassische Berufsbilder<br />
und Ausbildungsgänge. Die<br />
RWTH Aachen hat darauf reagiert,<br />
indem sie den neuen Studiengang<br />
„Umweltingenieurwissenschaften“<br />
geschaffen hat, der ein hohes Interesse<br />
bei den Studienanfängern,<br />
aber auch bei potentiellen Arbeitgebern<br />
gefunden hat. Wir sind<br />
überzeugt, damit für die zukünftigen<br />
Herausforderungen in Forschung<br />
und Lehre bestens gerüstet<br />
zu sein!<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br />
Johannes Pinnekamp<br />
Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
der RWTH Aachen<br />
November 2011<br />
1036 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
„Umwelt- und Gewässerschutz wird unter<br />
deutschen Studenten immer beliebter“<br />
(c) Gerd Altmann_Pixelio.de<br />
„Mehr als nur gute Karrierechancen“<br />
RWTH Aachen startet neuen Studiengang Umweltingenieurwissenschaften<br />
Umweltthemen werden unter Studienanfängern immer beliebter: Mehr als 250 junger Menschen schrieben <strong>sich</strong><br />
im Wintersemester 2010/2011 für den neu konzipierten Bachelor-Studiengang „Umweltingenieurwissenschaften“<br />
an der RWTH Aachen, Fakultät für Bauingenieurwesen, ein. Und das, obwohl der Studiengang<br />
zuvor kaum beworben worden war. Allein die inhaltliche Gestaltung schien Anreiz genug gewesen zu sein.<br />
Im Wintersemester 2011/2012 starteten bereits fast 600 Erstsemester.<br />
In ingenieurtypischen Vorlesungen<br />
und Übungen sowie in eigenen<br />
schriftlichen Ausarbeitungen wie<br />
Studien- und Bachelorarbeiten sollen<br />
die Studierenden auf wissenschaftlichem<br />
Niveau Antworten auf<br />
die drängenden umwelttechnischen<br />
Fragen erarbeiten. Daneben<br />
erhalten sie eine Grundausbildung<br />
in Mathematik, Mechanik, Thermodynamik,<br />
Hydromechanik, Chemie<br />
und Ökologie. „Die Bezeichnung<br />
Umweltingenieurwissenschaften ist<br />
ganz bewusst gewählt. Wir wollen<br />
ingenieurmäßige Antworten auf die<br />
drängenden umwelttechnischen<br />
Fragen auf wissenschaftlichem<br />
Niveau geben“, erklärt der Initiator<br />
des neuen Studiengangs und Vorsitzende<br />
des Prüfungsausschusses<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp<br />
vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
der RWTH-Fakultät<br />
für Bauingenieurwesen.<br />
„Es handelt <strong>sich</strong> <strong>sich</strong>erlich um<br />
eine anspruchsvolle Ausbildung,<br />
aber diese bietet den zukünftigen<br />
Absolventen auch breite Anwendungsfelder“,<br />
sagt Professor Pinnekamp.<br />
Klassische Berufsgebiete sind<br />
Planung, Bau und Betrieb von<br />
umwelttechnischen Anlagen, Lehre<br />
und Forschung, Umweltverbände<br />
und -verwaltungen sowie die Entwicklungszusammenarbeit.<br />
„Aktuelle<br />
Studien zeigen, dass Deutschland<br />
<strong>sich</strong> in Richtung GreenTech<br />
entwickeln muss und wird“, meint<br />
Professor Pinnekamp. „Den begrenzenden<br />
Faktor dabei bilden ausreichend<br />
qualifizierte Absolventen.<br />
Deshalb sind wir <strong>sich</strong>er, dass die<br />
Absolventen des neuen Studiengangs<br />
mehr als nur gute Berufs- und<br />
Karrierechancen haben.“<br />
Der neue Bachelor-Studiengang<br />
wird ergänzt durch einen Master-<br />
Studiengang, der im Wintersemester<br />
2011/12 gestartet ist, und fünf<br />
thematische Schwerpunkte um -<br />
fasst: Urban Water, Water Resources<br />
Management, Energie und Umwelt<br />
im Bauwesen, Recycling sowie<br />
Umweltverfahrenstechnik. Damit<br />
sind Ingenieurwissenschaften und<br />
Umweltfragen an der RWTH Aachen<br />
stärker verzahnt als an anderen Universitäten.<br />
Weitere Informationen bei:<br />
www.rwth-aachen.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1037
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Umwelt- und Gewässerschutz im Fokus<br />
Das ISA der RWTH Aachen stellt <strong>sich</strong> vor<br />
Der Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und Siedlungsabfallwirtschaft und das Institut für Siedlungswasserwirtschaft<br />
(ISA) der RWTH Aachen unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp ist eine seit<br />
vielen Jahren vor allem im Dienste des Umwelt- und Gewässerschutzes tätige Einrichtung der Fakultät für<br />
Bauingenieurwesen.<br />
Essener Tagung für <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft<br />
Ein besonderes Markenzeichen der dreitägigen ESSENER TAGUNG für <strong>Wasser</strong>- und<br />
Abfallwirtschaft ist die Breite der Themen. Diese reichen von perspektivischen, umweltpolitischen<br />
und -rechtlichen Entwicklungen bis zu Problemen und technischen Innovationen<br />
in der <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft.<br />
Jedes Jahr greifen die Veranstalter aktuelle und zukunftsweisende Themenkomplexe auf.<br />
In über 70 Vorträgen stellen namhafte Fachleute aus Wissenschaft, Politik und Praxis<br />
neueste Forschungsergebnisse und Entwicklungen vor. Über 900 Teilnehmer besuchen<br />
die Tagung jährlich, die <strong>sich</strong> in den vergangenen 44 Jahren als Treffpunkt der Fachwelt<br />
aus der <strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft etabliert hat. Tagungsbegleitend finden Exkursionen<br />
statt, die moderne Umwelttechnik in der Praxis vorführen.<br />
Eine ergänzende Fachausstellung mit integriertem Technologieforum bietet Unternehmen<br />
die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Die Veranstaltung<br />
findet jährlich abwechselnd in Aachen und Essen statt, nächster Termin ist der<br />
4. bis 16. März 2012.<br />
Website: www.essenertagung.de<br />
Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium<br />
Seit über elf Jahren behandelt das Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium Fragestellungen<br />
zur Kanalisationstechnik. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Bau, Betrieb,<br />
Zustandserfassung, Instandhaltung und Sanierung von Kanälen, die Erfassung und<br />
Bewertung des Umweltgefährdungspotenzials oder durch Fremdwasser bestehende Einflüsse,<br />
ebenso wie die Einschätzung der rechtlichen Situation. Daneben werden auch<br />
aktuelle Fragen zu Technik, Betrieb und Unterhaltung von <strong>Abwasser</strong>reinigungsanlagen<br />
behandelt. Die Veranstaltung findet jährlich in Köln statt.<br />
Website: www.kanalkolloquium.de<br />
(c) Rosel Eckstein_pixelio.de<br />
Im Jahr 1966 ging das ISA aus dem<br />
Lehrstuhl und Institut für Stadtbauwesen,<br />
Stadtverkehr und Siedlungswasserwirtschaft<br />
hervor. Erster<br />
Institutsdirektor wurde Prof.<br />
Dr.-Ing. B. Böhnke, dem von 1987<br />
bis 2004 Prof. Dr.-Ing. M. Dohmann<br />
folgte. Die vielfältigen Forschungsund<br />
Entwicklungsarbeiten aus allen<br />
Bereichen der Siedlungsentwässerung,<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung und<br />
Gewässergütewirtschaft sowie der<br />
Abfallwirtschaft werden am ISA<br />
durch rund 25 wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter/innen in interdisziplinärer<br />
Zusammenarbeit durchgeführt.<br />
Der Mitarbeiterstab setzt <strong>sich</strong><br />
zusammen aus Ingenieurwissenschaftlern<br />
der Sparten Bauingenieurwesen,<br />
Verfahrenstechnik und<br />
Entsorgungsingenieurwesen sowie<br />
aus Naturwissenschaftlern der Disziplinen<br />
Biologie und Chemie. Eine<br />
leistungsfähige Werkstatt schafft<br />
die Grundlagen für die erfolgreiche<br />
Abwicklung der Forschungs- und<br />
Entwicklungsvorhaben. Das ISA verfügt<br />
zudem über zwei eigene Versuchsfelder<br />
und zwei Versuchshallen.<br />
Zahlreiche studentische Mitarbeiter<br />
unterstützen die Arbeit der<br />
Wissenschaftler.<br />
Die Aufbereitung und Analytik<br />
der täglich in großer Anzahl anfallenden<br />
Proben aus den Bereichen<br />
der <strong>Abwasser</strong>-, Schlamm-, Abfallund<br />
Altlasten- sowie der Bodenund<br />
Luftuntersuchungen werden in<br />
dem gerätetechnisch hochmodern<br />
ausgestatteten umweltanalytischen<br />
Laboratorium des ISA vorgenommen.<br />
Spuren- und Ultraspurenanalytik<br />
wird mittels hochauflösender<br />
Massenspektrometrie nach<br />
hochaufgelöster gaschromatogra-<br />
November 2011<br />
1038 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
phischer Trennung (HR-GC/MS-MS)<br />
bzw. nach hochauflösender flüssigkeitschromatographischer<br />
(HR-<br />
HPLC/MS n ) Trennung durchgeführt.<br />
International anerkannt<br />
Neben den von verschiedenen<br />
Fördermittelgebern – wie BMBF,<br />
DBU, DFG, AiF, Umweltministerium<br />
(MKULNV) NRW – finanzierten Forschungsprojekten<br />
zu wasserwirtschaftlichen<br />
Fragestellungen werden<br />
am ISA auch Aufträge von<br />
Industrieunternehmen bearbeitet.<br />
Mit der „Essener Tagung für <strong>Wasser</strong>und<br />
Abfallwirtschaft“ und der<br />
„Aachener Tagung <strong>Wasser</strong> und<br />
Membranen“, die 2011 als IWA<br />
Specialist Conference on Membrane<br />
Technology for Water & Wastewater<br />
Treatment stattgefunden hat, organisiert<br />
das ISA zwei international<br />
anerkannte Fachtagungen, die eine<br />
hervorragende Plattform zum<br />
Wissens transfer bilden. Weitere<br />
Ta gungs veranstaltungen mit langer<br />
jährlicher Tradition sind das Kölner<br />
Kanal- und Kläranlagen Kolloquium<br />
sowie das Aachener Kolloquium<br />
Abfallwirtschaft. In loser Folge findet<br />
zudem der Aachener Kongress<br />
Dezentrale Infrastruktur statt.<br />
Publikationen<br />
Das ISA unterhält mehrere bedeutende<br />
Schriftenreihen, allen voran<br />
die als „Gelbe Reihe“ bekannte Serie<br />
„Gewässerschutz – <strong>Wasser</strong> – <strong>Abwasser</strong>“<br />
(GWA), außerdem die „Aachener<br />
Schriften zur Stadtentwässerung“<br />
und die Reihe „Abfall – Recycling<br />
– Altlasten“.<br />
Das ISA hat zwei An-Institute: das<br />
Forschungsinstitut für <strong>Wasser</strong>- und<br />
Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen<br />
(FiW) e.V. sowie das Prüf- und Entwicklungsinstitut<br />
für <strong>Abwasser</strong>technik<br />
an der RWTH Aachen (PIA) e.V.<br />
Diese drei Institute haben <strong>sich</strong> unter<br />
dem Namen acwa (Aachen <strong>Wasser</strong>)<br />
ein gemeinsames Dach gegeben.<br />
Aachener Kolloquium Abfallwirtschaft<br />
Jährlich präsentiert das Aachener Kolloquium Abfallwirtschaft Fachleuten aus Industrie,<br />
Ingenieurbüros und Umweltverwaltung ein besonders relevantes abfallwirtschaftliches<br />
Kernthema in konzentrierter Form. Dabei werden nachhaltige und zukunftsfähige<br />
Entwicklungen sowie Antworten auf gegenwärtige Probleme in der Abfallwirtschaft aufgezeigt<br />
und diskutiert. Die Veranstaltung findet jährlich in Aachen statt. Die 24. Auflage<br />
ist auf den 24. November 2011 terminiert, Veranstaltungsort ist das Forum M der Mayerschen<br />
Buchhandlung in Aachen.<br />
Website: www.aka-ac.de<br />
acwa Aachen <strong>Wasser</strong><br />
Unter dem Namen acwa Aachen <strong>Wasser</strong> zusammengeschlossen haben <strong>sich</strong> die siedlungswasserwirtschaftlichen<br />
Institute:<br />
Institut für<br />
Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen (ISA)<br />
Forschungsinstitut für<br />
<strong>Wasser</strong>- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW)<br />
Prüf- und Entwicklungsinstitut für <strong>Abwasser</strong>technik an der RWTH Aachen (PIA)<br />
Das Forschungsspektrum von acwa umfasst Grundlagenforschung, angewandte Forschung<br />
sowie wissenschaftliche Begleitungen, z. B. von Baumaßnahmen und Inbetriebnahmen.<br />
Außerdem wird eine Vielzahl von Dienstleistungen angeboten, die von praktischen<br />
Anwendungen wie Zulassungsprüfungen von abwassertechnischen Anlagen,<br />
Labor analysen und Durchflussmessungen über Organisationsberatung bis zum Technologietransfer<br />
im In- und Ausland reichen.<br />
Verbunden durch acwa verfügen die drei Institute über mehrere eigene Versuchsfelder und<br />
-hallen, ein modernes umweltanalytisches Laboratorium sowie über zahlreiche fachspezifische<br />
Softwareanwendungen. Die insgesamt etwa 50 wissenschaftlichen und weiteren<br />
40 technischen und administrativen Mitarbeiter sorgen für eine zuverlässige Bearbeitung<br />
siedlungswasserwirtschaftlicher Projekte.<br />
Aachener Tagung <strong>Wasser</strong> und Membranen<br />
Hauptinhalt der Konferenz ist die Vorstellung und Reflexion aktueller Erkenntnisse aus<br />
Forschung, Wissenschaft und Technik. Sie möchte den Austausch zwischen Experten<br />
aus den Bereichen Membranherstellung, <strong>Wasser</strong>wirtschaftsverwaltung sowie Betreibern<br />
von <strong>Wasser</strong>aufbereitungs- und <strong>Abwasser</strong>behandlungsanlagen fördern. Mit über 500 Teilnehmern<br />
bietet die Veranstaltung ein breites Diskussionsforum für Vertreter aus Industrie,<br />
Forschungseinrichtungen und Verwaltung. Die Themenfelder decken die Bereiche<br />
Anlagenplanung, Neuentwicklungen sowie Betriebserfahrungen mit bereits im Betrieb<br />
befindlichen Anlagen ab. Das Vortragsprogramm wird durch eine Fachausstellung im<br />
Foyer abgerundet. Die zweijährlich abgehaltene Tagung wird das nächste Mal im Oktober<br />
2013 in Aachen stattfinden.<br />
Website: www.awm.rwth-aachen.de<br />
(c) Torsten Lohse_pixelio.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1039
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Vier Projekte, die etwas bewegen<br />
Forschungsschwerpunkte des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen<br />
Aktuell beschäftigen <strong>sich</strong> die Wissenschaftler am Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) unter anderem<br />
mit den folgenden Forschungsschwerpunkten: Elimination von Spurenstoffen in kommunalen Kläranlagen,<br />
Ressourcenschonung: Phosphorrückgewinnung, <strong>Wasser</strong>sensible Stadtentwicklung zur Anpassung der Infrastruktur<br />
an Klimatrends und Energieoptimierung in der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Das ISA erforscht Möglichkeiten und Grenzen der Technologien zur Elimination von<br />
Spurenstoffen in kommunalen Kläranlagen. © RWTH Aachen<br />
Elimination von Spurenstoffen<br />
in kommunalen<br />
Kläran lagen – Mikroverunreinigungen<br />
in der aquatischen<br />
Umwelt<br />
Spurenstoffe, die auch als Mikroverunreinigungen<br />
bezeichnet<br />
werden, sind in der aquatischen<br />
Umwelt allgegenwärtig und aufgrund<br />
des Fortschritts hochauflösender<br />
Analyseverfahren in den<br />
letzten Jahren vermehrt detektiert<br />
worden. Neben Stoffen wie Industriechemikalien<br />
und Flammschutzmitteln<br />
rückten in den vergangenen<br />
Jahren die pharmazeutischen Wirkstoffe<br />
in den Fokus von Wissenschaftlern<br />
und Öffentlichkeit.<br />
Humanpharmaka werden entweder<br />
unverändert oder nach Umbau im<br />
menschlichen Organismus als Konjugate<br />
bzw. Metaboliten ausgeschieden<br />
und gelangen so ins<br />
<strong>Abwasser</strong>. Da eine gezielte Elimination<br />
dieser Stoffe nicht dem Stand<br />
der Technik kommunaler Kläranlagen<br />
entspricht, werden Humanpharmaka<br />
und ihre Metaboliten zu<br />
nennenswerten An teilen über den<br />
Kläranlagenablauf in die als Vorfluter<br />
genutzten Oberflächengewässer<br />
geleitet. Veterinärpharmaka werden<br />
mit der Gülle auf die Felder ausgebracht<br />
und gelangen überwiegend<br />
durch Abspülungen in die Oberflächengewässer.<br />
Bislang wurden weit<br />
über 100 Arzneimittelwirkstoffe teilweise<br />
in relevanten Konzentrationen<br />
oberhalb ökotoxikologischer<br />
Wirkschwellen im aquatischen<br />
Kreislauf nachgewiesen.<br />
Humanpharmaka werden, insbesondere<br />
vor dem Hintergrund<br />
des demographischen Wandels, der<br />
steigenden individuellen Lebenserwartung<br />
und des damit verknüpften<br />
steigenden Arzneimittelkonsums,<br />
in Zukunft in noch größerer<br />
Anzahl und Menge über die kommunalen<br />
<strong>Abwasser</strong>wege in die<br />
Umwelt eingebracht werden.<br />
Aufgrund der Persistenz, des Bioakkumulationspotenzials<br />
und der<br />
Toxizität von Spurenstoffen sind<br />
breit gefächerte Bestrebungen<br />
unerlässlich, den Eintrag von Spurenstoffen<br />
in die Kanalisation bzw.<br />
in die Gewässer zu minimieren.<br />
Dazu bedarf es zunächst der Bilanzierung<br />
von Spurenstoffen aus<br />
Direkt- und Indirekteinleiter-Punktquellen,<br />
wie Industriebetrieben,<br />
Krankenhäusern und Kläranlagen.<br />
Zudem sind Untersuchungen verschiedener<br />
Verfahren und Verfahrenskombinationen<br />
nötig, durch<br />
deren Einsatz der Eintrag von Spurenstoffen<br />
in die aquatische Umwelt<br />
vermindert werden kann. Derzeit<br />
werden insbesondere die Oxidation<br />
mittels Ozon und die Adsorption<br />
der Spurenstoffe an Aktivkohle wissenschaftlich<br />
untersucht. Darüber<br />
hinaus sind erweiterte Oxidationsverfahren<br />
(advanced oxidation processes<br />
– AOP) sowie der Einsatz von<br />
Membrantechnik (als Vorbehandlungsschritt<br />
oder in Verbindung mit<br />
einer anderen Verfahrenstechnik)<br />
Gegenstand der Forschung. Zu allen<br />
Technologien erforscht das ISA<br />
November 2011<br />
1040 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Möglichkeiten und Grenzen hin<strong>sich</strong>tlich<br />
des Einsatzes zur Spurenstoffelimination<br />
in kommunalen<br />
Kläranlagen und befasst <strong>sich</strong> außerdem<br />
mit dem Energiebedarf und<br />
den Kosten dieser zusätzlichen Verfahrensstufen.<br />
Viele dieser Projekte gehören<br />
einem großen Forschungsschwerpunkt<br />
an, den das Ministerium für<br />
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,<br />
Natur- und Verbraucherschutz<br />
(MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
2008 durch eine<br />
europaweite Ausschreibung eines<br />
Ideenwettbewerbes initiierte. Dem<br />
Themenschwerpunkt „Elimination<br />
von Arzneimitteln und organischen<br />
Spurenstoffen“ fielen zehn Projekte<br />
zu, deren Bearbeitung Mitte 2010<br />
gestartet wurde. In den meisten<br />
Projekten ist das ISA maßgeblich<br />
beteiligt. Insgesamt sind über<br />
30 Institutionen mit der Bearbeitung<br />
der Projekte betraut. Informationen<br />
zu den Projektinhalten und<br />
-teams sind unter der vom ISA un -<br />
terhaltenen Internetpräsenz www.<br />
spurenstoffe.net zu finden.<br />
Ressourcenschonung:<br />
Phosphorrückgewinnung<br />
Seit zehn Jahren befassen <strong>sich</strong> die<br />
Wissenschaftler am ISA mit Möglichkeiten,<br />
Nährstoffe – vor allem<br />
Phosphor – im Bereich der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
und Klärschlammbehandlung<br />
rückzugewinnen.<br />
Phosphor ist neben Stickstoff<br />
von essentieller Wichtigkeit für alle<br />
biologischen Organismen. Für das<br />
Wachstum der Pflanzen ist Phosphor<br />
ein limitierender Faktor und<br />
daher ein Hauptbestandteil jedes<br />
Pflanzendüngers. In dieser Funktion<br />
ist Phosphor nicht durch andere<br />
Stoffe substituierbar. Zentrale Be -<br />
deutung im Sinne eines nachhaltigen<br />
Wirtschaftens erhält Phosphor<br />
bereits heute, da die statische<br />
Reichweite der weltweit verfügbaren<br />
und heute wirtschaftlich abbaubaren<br />
Lagerstätten auf etwa 100<br />
Jahre beziffert wird.<br />
In der Siedlungswasserwirtschaft<br />
hat Phosphor eine besondere<br />
Bedeutung, da er seit vielen Jahren<br />
gezielt aus dem <strong>Abwasser</strong> eliminiert<br />
wird, um einer Eutrophierung der<br />
Vorfluter und nachfolgenden Ge -<br />
wässer vorzubeugen. Der bei der<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung in den Klärschlamm<br />
überführte Phosphor wird<br />
seit Jahrzehnten in unterschiedlichem<br />
Maße in der Landwirtschaft<br />
eingesetzt und trägt so zur Düngung<br />
der angebauten Nutzpflanzen<br />
bei. Mit dem Klärschlamm werden<br />
allerdings nicht nur Nährstoffe sondern<br />
auch organische und anorganische<br />
Schadstoffe auf die Felder<br />
ausgebracht, weshalb diese Entsorgungsoption<br />
immer mehr im Brennpunkt<br />
steht. In gleichem Maße<br />
ansteigend sind dadurch die Klärschlammmengen,<br />
die einer thermischen<br />
Entsorgung ohne stoffliche<br />
Nutzung der enthaltenen Nährstoffe<br />
zugeführt werden.<br />
Verfahren zur Phosphorrückgewinnung<br />
aus <strong>Abwasser</strong> oder Klärschlamm,<br />
die den Phosphor gezielt<br />
rückgewinnen und dabei eine Trennung<br />
der Wertstoffe von den Schadstoffen<br />
ermöglichen, können dieses<br />
Dilemma lösen: Einerseits werden<br />
die Nährstoffe in den Kreislauf<br />
zurückgeführt, andererseits kann<br />
eine schadlose Klärschlammentsorgung<br />
über thermische Prozesse<br />
erfolgen.<br />
Die erzeugten Sekundärphosphate,<br />
die als Dünger oder als Ausgangsstoffe<br />
für die Düngemittelindustrie<br />
eingesetzt werden können,<br />
müssen folgende zwei<br />
Bedingungen erfüllen:<br />
1. Die enthaltenen Pflanzennährstoffe<br />
müssen ausreichend löslich<br />
sein, um über die Pflanzenwurzeln<br />
aufgenommen werden<br />
zu können.<br />
2. Der Gehalt an Schadstoffen soll<br />
die gesetzlichen Vorgaben für<br />
Düngemittel deutlich unterschreiten<br />
und bei sachgerechter<br />
Anwendung der Düngemittel<br />
nicht zu einer Schadstoffanreicherung<br />
im Boden führen.<br />
Zum Themenbereich „Phosphorrecycling“<br />
wurde Mitte September die<br />
von BMBF und BMU getragene Förderinitiative<br />
„Kreislaufwirtschaft für<br />
Pflanzennährstoffe, insbesondere<br />
Phosphor“ im Rahmen einer<br />
Schlusspräsentation in der Auferstehungskirche<br />
in Berlin abgeschlossen.<br />
Die vielfältigen Arbeitsergebnisse<br />
wurden von den Projektbearbeitern<br />
der Öffentlichkeit präsentiert.<br />
An mehreren Projekten der<br />
Förderinitiative war das ISA beteiligt,<br />
u.a. am wissenschaftlichen Koordinierungsprojekt.<br />
Die Textbeiträge zu<br />
den Schlusspräsentationen aller Forschungsnehmer<br />
sind im Band 228<br />
der Schriftenreihe Ge wässerschutz<br />
– <strong>Wasser</strong> – <strong>Abwasser</strong> doku mentiert<br />
und stehen auf der Home page der<br />
Förderinitiative zur Verfügung<br />
(www.phosphorrecycling.eu).<br />
<br />
Phosphor ist<br />
neben Stickstoff<br />
von essentieller<br />
Wichtigkeit für<br />
alle biologischen<br />
Organismen.<br />
© RWTH Aachen<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1041
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Im Rahmen des Projektes „Prozessoptimierung von<br />
Membranbelebungsanlagen“ (ProM) wird untersucht, wie<br />
<strong>sich</strong> der Energiebedarf senken lässt.<br />
© RWTH Aachen<br />
<strong>Wasser</strong>sensible Stadtentwicklung<br />
zur Anpassung der<br />
Infrastruktur an Klimatrends<br />
Im Rahmen des Forschungsvorhabens<br />
„<strong>Wasser</strong>sensible Stadtentwicklung“<br />
wurden im ISA Anpassungsmaßnahmen<br />
für die Siedlungsentwässerung<br />
entwickelt, die es er -<br />
möglichen, die Folgen des Klimawandels<br />
zu kompensieren und die<br />
zielgerichtete Regenwasserbehandlung<br />
und -ableitung auch zukünftig<br />
zu gewährleisten. Das Projekt steht<br />
für einen weiteren Arbeitsschwerpunkt<br />
des ISA.<br />
Die bisherigen Ergebnisse der<br />
Klimamodelle lassen zukünftig eine<br />
Häufung von Starkniederschlägen<br />
erwarten. Damit verbunden ist mit<br />
einer Zunahme von Sturzfluten in<br />
besiedelten Räumen wie auch mit<br />
einer Zunahme von Mischwasserentlastungen<br />
in die Gewässer zu<br />
rechnen. Deshalb ist es wichtig, die<br />
nur langsam transformierbaren Entwässerungsanlagen<br />
rechtzeitig an<br />
die <strong>sich</strong> verändernden Niederschlagsverhältnisse<br />
anzupassen. So<br />
zeigt das Projekt „<strong>Wasser</strong>sensible<br />
Stadtentwicklung“ Lösungen, wie<br />
den Herausforderungen des Klimawandels<br />
begegnet werden kann:<br />
Um die Auswirkungen des Klimawandels<br />
zu kompensieren und<br />
dabei den bisherigen Un<strong>sich</strong>erheiten<br />
bei der Bestimmung der<br />
zukünftigen Bemessungsniederschläge<br />
Rechnung zu tragen, ist<br />
eine Reduzierung der an das zentrale<br />
Entwässerungssystem angeschlossenen<br />
Flächen ein erster<br />
Schritt. Ergänzend sind flexible<br />
Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln,<br />
die eine Reduzierung der<br />
Folgen von Überflutungen nach<br />
Extremereignissen zum Ziel haben.<br />
Der Umgang mit Extremereignissen<br />
kann nicht ausschließlich über den<br />
Ausbau des Kanalisationssystems<br />
geschehen. Die Ableitung derartiger<br />
Abflüsse kann ergänzend zu der<br />
Ableitung über die Kanalisation nur<br />
auf der Oberfläche der Gebiete<br />
erfolgen. Insbesondere in innerstädtischen<br />
Bereichen kann mit<br />
einer multi-funktionalen Flächennutzung<br />
eine Reduzierung der Folgen<br />
von Überflutungsereignissen<br />
erreicht werden. Zur Entwicklung<br />
von Maßnahmen einer wassersensiblen<br />
Stadtentwicklungen wurden in<br />
den Gebieten Bochum, Essen und<br />
Herne gekoppelte 1D/2D-Simulationen<br />
von Oberfläche und Kanalnetz<br />
durchgeführt. So war es möglich,<br />
detaillierte Überflutungsbetrachtungen<br />
durchzuführen und zielgerichtet<br />
Maßnahmen zu ergreifen.<br />
Die siedlungswasserwirtschaftlichen<br />
Planungen und die Simulationsberechnungen<br />
wurden ergänzend<br />
intensiv zwischen <strong>Wasser</strong>wirtschaftlern<br />
und Stadtplanern sowie weiteren<br />
Beteiligten des Forschungsprojektes<br />
diskutiert, um offen Vorteile<br />
aber auch Probleme der wassersensiblen<br />
Stadtentwicklung darzustellen.<br />
Die Ergebnisse wurden 2010 in<br />
einer Handlungsempfehlung zur<br />
wassersensiblen Stadtentwicklung<br />
zusammengestellt. Diese Handlungsempfehlung<br />
soll der Planungspraxis<br />
(Stadtbau, Stadtplanung,<br />
Straßenbau, Grünflächen,<br />
Siedlungswasserwirtschaft u.w.) zeigen,<br />
wie eine wassersensible Stadtentwicklung<br />
gelingen kann und<br />
welche Rahmenbedingungen zur<br />
Umsetzung und Akzeptanz der<br />
Maßnahmen auf lokaler Ebene<br />
geschaffen werden müssen.<br />
Die Forschungsarbeiten des ISA<br />
werden aktuell u.a. im Rahmen des<br />
BMBF-Verbundvorhabens „dynaklim“<br />
(www.dynaklim.de) fortgesetzt.<br />
Auf den Ergebnissen aufbauend<br />
setzt z. B. die Stadt Bochum vertiefende<br />
Planungen um.<br />
Energiebedarf und -optimierung<br />
der <strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Membranbioreaktoren (MBR) erreichen<br />
eine sehr gute, völlig feststofffreie<br />
Ablaufqualität, die in hygienischer<br />
Hin<strong>sich</strong>t die Anforderungen<br />
der EU-Badegewässerrichtlinie er -<br />
füllt. Ein weiterer Vorteil von MBR<br />
besteht in ihrer kompakten Bauweise.<br />
Ihr größter Nachteil ist jedoch<br />
der gegenüber Be lebungsanlagen<br />
mit Nachklärung erhöhte Energieverbrauch.<br />
Für eine weitere Verbreitung<br />
dieser aus Ge wässer schutzgründen<br />
vorteilhaften Technologie<br />
sind Energieoptimierungen zu identifizieren<br />
und vorzunehmen.<br />
Die Erarbeitung und Zusammenstellung<br />
von Optimierungsmöglichkeiten<br />
an großtechnischen MBR ist<br />
Ziel im Projekt „Prozessoptimierung<br />
von Membranbelebungsanlagen“<br />
(ProM). Hierzu gibt es erfolgreiche<br />
Beispiele, die den Energiebedarf<br />
einzelner Anlagen bereits wesentlich<br />
senken konnten, ohne die<br />
Betriebs<strong>sich</strong>erheit oder Langzeitbeständigkeit<br />
der Membranen zu<br />
vernachlässigen. Zum einen stehen<br />
die energieintensiven Membrangebläse<br />
zur Deckschichtkontrolle<br />
als Hauptverbraucher im Mittelpunkt.<br />
Die erzeugte Cross-Flow-<br />
Strömung sollte durch den Betrieb<br />
mit hohen Filtratflüssen bestmöglich<br />
ausgenutzt werden. Des Weiteren<br />
sind die Membrangebläse nicht<br />
zum primären Zweck des Sauerstoffeintrages<br />
zu aktivieren, und die<br />
Funktion der Durchmischung der<br />
November 2011<br />
1042 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
Ein Blick zurück auf die über 140 Jahre alte Geschichte der RWTH Aachen<br />
Mit 32 Lehrern und 223 Studenten eröffnete die RWTH Aachen als „Königlich Rheinisch-Westphälische Polytechnische<br />
Schule zu Aachen“ im Jahr 1870 den Lehrbetrieb, mitten im Deutsch-Französischen Krieg. Die lange Bauzeit von der Gründung<br />
eines privaten „Komitee zur Errichtung einer Polytechnischen Schule in Aachen“ 1858 über die Grundsteinlegung 1865<br />
bis zur Eröffnung 1870 lag unter anderem an den Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Baumaterialien: Das noch heute<br />
imposant wirkende Gebäude war in einer nicht einmal 80 000 Einwohner zählenden Stadt entstanden. Noch während der<br />
Planungs- und ersten Bauphase galt die polytechnische Schule als erste Einrichtung ihrer Art in Preußen. Im Sommer 1866<br />
verlor sie diesen Rang an das Polytechnikum zu Hannover. Preußen annektierte in diesem Jahr das gleichnamige Königreich.<br />
Ein Stich aus dem Jahr 1879 zeigt das Hauptgebäude und das chemische Laboratorium. ©Hochschularchiv RWTH Aachen.<br />
Im Jahr 1880 wurde aus der direktorgeführten Polytechnischen Schule eine „Technische Hochschule“ mit einer Rektoratsverfassung.<br />
Der Erste Weltkrieg bedeutete einen ernsten Rückschlag. Doch zwischen 1925 und 1932 wurden die bisherigen<br />
Studierendenzahlen wieder aufgeholt und neue Gebäude errichtet. Während des Nationalsozialismus wurde die RWTH wie<br />
andere Hochschulen politisch gleichgeschaltet: Die Freiheit der Lehre und der Forschung wurde eingeschränkt, führenden<br />
Dozenten wurde die Lehrerlaubnis entzogen und viele Studenten mussten die RWTH verlassen. Wegen der Grenznähe zu den<br />
Niederlanden und Belgien war die Hochschule während des Zweiten Weltkriegs ein Jahr lang geschlossen. Sobald der Krieg<br />
beendet war, nahm die RWTH ihren Lehrbetrieb wieder auf. Neue technikferne Fakultäten entstanden: 1965 für Philosophie<br />
und 1966 für Medizin. So wurde aus der technischen Hochschule eine Universität. 1980 wurde die Pädagogische Hochschule<br />
Aachen eingegliedert. Während <strong>sich</strong> andere bundesdeutsche Technische Hochschulen (TH) in Technische Universitäten (TU)<br />
umbenannten, behielt die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen in die Bezeichnung als Technische Hochschule<br />
bei.<br />
Weitere Informationen unter: www.rwth-aachen.de<br />
Membrankammern ist weitgehend<br />
durch andere Maßnahmen <strong>sich</strong>erzustellen.<br />
Darüber hinaus stellen<br />
Rührwerke und Rezirkulationspumpen<br />
weitere Verbraucher dar, denen<br />
im energieoptimierten Betrieb<br />
eines MBR besondere Berück<strong>sich</strong>tigung<br />
gebührt.<br />
Neben filtrationsbedingten<br />
Mehr aufwendungen besteht ein<br />
energetischer Nachteil von MBR<br />
darin, dass sie als aerob stabilisierende<br />
Anlagen betrieben werden,<br />
was mit erhöhtem Sauerstoffbedarf<br />
verbunden ist. Die Energiebilanz<br />
der Kläranlage wird weiterhin<br />
dadurch verschlechtert, dass der<br />
MBR-Schlamm somit keiner anaeroben<br />
Stabilisierung mit Energieerzeugung<br />
durch die Verstromung<br />
des anfallenden Klärgases zugeführt<br />
wird.<br />
Im Projekt „EnReMem“ wird<br />
daher die Implementierung einer<br />
anaeroben Stabilisierungsstufe in<br />
die Verfahrenskette von MBR untersucht.<br />
Wesentliche Projektinhalte<br />
sind die Ermittlung des Klärgasanfalls<br />
bei der Faulung von MBR-<br />
Schlämmen, Untersuchung der Entwässerbarkeit<br />
von MBR-Schlämmen<br />
vor und nach der Faulung sowie<br />
eine Energie- und Kostenbetrachtung<br />
anhand von Modellanlagen.<br />
Des Weiteren werden CO 2 -Bilanzen<br />
für MBR mit und ohne Vorklärung<br />
bzw. Faulung durchgeführt und die<br />
Auswirkungen einer Vorklärung<br />
und Umstellung der Betriebseinstellungen<br />
in Richtung höherer Gasausbeute<br />
auf die Filtrierbarkeit und das<br />
Membranfouling untersucht.<br />
Weitere Informationen:<br />
Institut für Siedlungswasserwirtschaft der<br />
RWTH Aachen<br />
E-Mail: isa@isa.rwth-aachen.de<br />
Telefon: (0241) 8025207<br />
Internet: www.isa.rwth-aachen.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1043
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Die Führungskraft-Schmiede Deutschlands<br />
Jedes 5. Vorstandsmitglied kommt von der RWTH Aachen<br />
Mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten gehört die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH)<br />
Aachen zu den drei größten Universitäten für technische Studiengänge in Deutschland und zu den wichtigsten<br />
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in Europa. Derzeit sind rund 33 000 Studenten in über 100 Studiengängen<br />
eingeschrieben. Davon kommen über 5200 ausländische Studierende aus 130 Ländern.<br />
Anzahl von 1250 Existenzgründungen.<br />
Daraus wuchsen in den letzten<br />
20 Jahren rund 30 000 neue Arbeitsplätze<br />
in der Region Aachen.<br />
Das imposante Hauptgebäude der RWTH Aachen. © Andreas Herrmann/ats<br />
Die wissenschaftliche Ausbildung<br />
an der RWTH Aachen ist<br />
stark praxisbezogen. Deshalb sind<br />
die Absolventen in der Wirtschaft<br />
gefragte Nachwuchs- und Führungskräfte.<br />
Nationale Rankings<br />
und internationale Bewertungen<br />
bescheinigen den RWTH-Absolventen<br />
eine ausgeprägte Befähigung<br />
zur Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen,<br />
zu konstruktiver<br />
Problemlösung in Teamarbeit und<br />
zur Übernahme von Leitungsaufgaben.<br />
Kein Wunder also, dass jedes<br />
fünfte Vorstandsmitglied deutscher<br />
Konzerne von der RWTH Aachen<br />
kommt.<br />
Die Forschungszentren der<br />
RWTH Aachen orientieren <strong>sich</strong> stark<br />
an den aktuellen Erfordernissen der<br />
Industrie. Die Kompetenzzentren<br />
der RWTH Aachen pflegen eine sehr<br />
effektive fach- und fakultätsübergreifende<br />
Zusammenarbeit in interdisziplinären<br />
Verbünden und Foren.<br />
Die Bereiche Informatik und Biologie<br />
beispielsweise, aber auch die<br />
Gesellschaftswissenschaften haben<br />
einen deutlichen Bezug zum ingenieurwissenschaftlichen<br />
Schwerpunkt<br />
der Hochschule. Deshalb entschieden<br />
<strong>sich</strong> unter anderem so<br />
internationale Unternehmen wie<br />
Philips, Microsoft oder Ford dafür,<br />
ihre Forschungseinrichtungen in<br />
der Aachener Region zu bauen. Die<br />
Innovationskraft der Hochschule<br />
zeigt <strong>sich</strong> zudem in der hohen<br />
Hohe Qualität<br />
Daneben ist die RWTH Aachen<br />
größte Arbeitgeberin und Ausbilderin<br />
der Region. Den erfolgreichen<br />
Wandel vom Bergbaugebiet zur<br />
Hightech-Region wird die Hochschule<br />
auch weiterhin als treibende<br />
Kraft entscheidend prägen und mitgestalten.<br />
Hohe Qualität in Lehre<br />
und Forschung bilden auch den<br />
Ausgangspunkt für die internationale<br />
Zusammenarbeit der RWTH<br />
Aachen. In Netzwerken wie der<br />
IDEA League setzt die RWTH Aachen<br />
mit führenden Technischen Universitäten<br />
anderer Länder die Qualitätsstandards<br />
für Studiengänge und<br />
wissenschaftliche Weiterbildung.<br />
Mit Universitätsgründungen nach<br />
Vorbild der RWTH Aachen in Thailand<br />
und im Oman wird diese<br />
erfolgreiche Wissenschaftsstruktur<br />
auch international vermarktet.<br />
Im Rahmen der Exzellenzinitiative<br />
erhielt die RWTH Aachen durch<br />
die Bewilligung von insgesamt drei<br />
Exzellenzclustern, einer Graduiertenschule<br />
und des Zukunftskonzepts<br />
„RWTH Aachen 2020: Meeting<br />
Global Challenges“ weitere Impulse<br />
für eine ausgeprägte internationale<br />
Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.rwth-aachen.de<br />
November 2011<br />
1044 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
RWTH ist Spitzenreiter bei Stipendien<br />
Im laufenden Wintersemester werden an der RWTH 589 Stipendiaten durch den Bildungsfonds gefördert. Damit<br />
ist die Aachener Hochschule zum dritten Mal Spitzenreiter bei der Stipendienvergabe in Nordrhein-Westfalen.<br />
Beim Bildungsfonds müssen die<br />
Universitäten jeweils 1800 Euro<br />
pro Stipendiat von Privaten, Unternehmen<br />
oder Organisationen einwerben,<br />
dann legen Land oder<br />
Bund noch einmal den gleichen<br />
Betrag drauf. Mehr als 1 Mio. Euro<br />
hat die Abteilung Fundraising der<br />
RWTH bislang für den 2009 eingerichteten<br />
Bildungsfonds von rund<br />
80 Geldgebern eingesammelt, darunter<br />
große Unternehmen wie<br />
Bosch, Continental und Aachen-<br />
Münchener, aber auch regionale<br />
Firmen und Ehemalige der Technischen<br />
Hochschule. 2012 will die<br />
RWTH insgesamt 800 Stipendien<br />
vergeben.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.rwth-aachen.de/go/id/bbkg/<br />
© Andreas Herrmann/ats<br />
Bonding schlägt Brücken zwischen Studenten und Unternehmern<br />
Aachener Initiative verbreitete <strong>sich</strong> über ganz Deutschland<br />
Studenten schon während des Studiums Einblicke ins spätere Berufsleben zu ermöglichen und Kontakte zu<br />
möglichen Arbeitgebern zu knüpfen – das ist das Ziel der bonding-studenteninitiative e.V. Seit über 20 Jahren<br />
organisiert die Initiative dazu verschiedene für Studenten kostenlose Veranstaltungen. So ist der<br />
Verbund unter anderem<br />
größter Anbieter von Firmenkontaktmessen<br />
in<br />
Deutschland.<br />
Im Jahr 1988 von Studenten<br />
der RWTH Aachen gegründet<br />
sprach <strong>sich</strong> das Konzept<br />
der bonding-studenteninitiative<br />
e.V. bald in ganz<br />
Deutschland herum wie ein<br />
Lauffeuer. Schon bald wurden<br />
weitere Gruppen auch<br />
an anderen Hochschulen<br />
gegründet. Inzwischen ist<br />
bonding deutschlandweit<br />
an 11 Standorten vertreten<br />
und zählt insgesamt ca. 350<br />
aktive Mitglieder. Auch international ist bonding aktiv. Zusammen mit der Partnerinitiative BEST (Board of<br />
European Students of Technology), einer internationalen unpolitischen Non-Profit-Organisation, engagiert<br />
<strong>sich</strong> die Studenteninitiative weltweit.<br />
Als eingetragener gemeinnütziger Verein arbeiten alle Mitarbeiter ehrenamtlich. Sämtliche Veranstaltungen<br />
sind für Studenten kostenlos.<br />
Weitere Informationen unter: www.bonding.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1045
NETZWERK WISSEN Porträt<br />
Der Aachener<br />
Dom.<br />
© Andreas<br />
Herrmann/ats<br />
Wo der Quell des Lebens sprudelt<br />
Als „Stadt des <strong>Wasser</strong>s“ blickt Aachen auf eine geschichtsträchtige<br />
Vergangenheit zurück<br />
Schon der Name verrät es: Aachen ist eine Stadt des <strong>Wasser</strong>s. So leitet <strong>sich</strong> der Name vom Altgermanischen<br />
Ahha – „<strong>Wasser</strong>“ ab. Denn bis zur Erbauung des Aachener Doms um 800 n. Chr. war die Stadt vor allem wegen<br />
ihrer zahlreichen Quellen bekannt, die stark schwefelhaltiges, bis zu 74 °C heißes <strong>Wasser</strong> sprudeln lassen.<br />
Bereits Kelten und Römer wussten<br />
um die wohltuende Kraft<br />
der „Aquae Granni“, wie Aachen auf<br />
Latein heißt. Diesen im Mittelalter<br />
verbreiteten Namen soll die Stadt<br />
dem keltischen <strong>Wasser</strong>- und Bädergott<br />
Grannus verdanken. Auch Karl<br />
der Große (747 bis 814 n. Chr.) soll<br />
schon von der Stadt geschwärmt<br />
haben: „Oft und mit besonderer<br />
Lust hat er die warmen <strong>Wasser</strong><br />
geliebt und sie gebraucht“, berichtet<br />
Karls Biograph Einhard (770 bis<br />
840 n. Chr.), ebenso, dass die Stadt<br />
eben jener kaiserlichen Vorliebe<br />
den Aufstieg zur Residenzstadt verdankte.<br />
Als Kurstadt darf <strong>sich</strong> die<br />
Stadt, die im heutigen Dreiländereck<br />
Deutschland-Belgien-Niederlande<br />
liegt, eigentlich Bad Aachen<br />
nennen. Diese Bezeichnung wird<br />
allerdings kaum verwendet, da der<br />
Name ansonsten in Listen und Verzeichnissen<br />
nicht mehr an erster<br />
Stelle erscheint.<br />
Mineral- und Heilquellen<br />
Ihr guter Ruf und der unverkennbare<br />
Schwefelgeruch der Quellen<br />
eilten Aachen weit voraus und<br />
machten es weithin berühmt. Während<br />
andernorts die Mineral- und<br />
Heilquellen noch im Nebel mittelalterlichen<br />
Aberglaubens gefangen<br />
hingen, entwickelte man in Aachen<br />
schon wegweisende Fremdenverkehrsstrategien<br />
rund um die heißen<br />
Quellen. Aus allen Teilen Europas<br />
eilten die Menschen herbei, um <strong>sich</strong><br />
November 2011<br />
1046 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Porträt NETZWERK WISSEN<br />
hier die vielgepriesenen Wonnen<br />
einer Bade- oder Trinkkur zu gönnen.<br />
Einzig Friedrich der Große<br />
(1712 bis 1786 n. Chr.) äußerte <strong>sich</strong><br />
kritisch über die sprudelnde Vielfalt<br />
des Aachener Badelebens: „wo<br />
soviel Leute hinkommen, um <strong>sich</strong><br />
abzulenken, und von wo so viele<br />
andere fortgehen, ohne gesund zu<br />
sein, wo Ruhmredigkeit der Ärzte<br />
wie Liebesintrigen ihr Spiel gleichermaßen<br />
treiben, wo schließlich<br />
Gebrechlichkeit und die Vorurteile<br />
so viele Personen aus allen Enden<br />
der Welt heranziehen“.<br />
Heute hat die moderne Wissenschaft<br />
Friedrichs Zweifel an der<br />
Heilkraft des Aachener <strong>Wasser</strong>s<br />
längst widerlegt. Es gilt als erwiesen,<br />
dass die Wärme und insgesamt<br />
19 verschiedene Mineral-Elemente<br />
der schwefelhaltigen NatriumchloridHydrogen-Carbonat-Thermen<br />
einen positiven Einfluss auf Erkrankungen<br />
der Knochen, Muskeln,<br />
Gelenke und Haut üben. Dies und<br />
wahrscheinlich auch das Ambiente<br />
dieser Kurstadt locken pro Jahr<br />
rund 8000 Besucher, <strong>sich</strong> in einem<br />
der drei Sanatorien einer Behandlung<br />
mit dem Aachener Quellwasser<br />
zu unterziehen.<br />
Schon Kaiser Karl der Große soll<br />
von Aachens Quellen geschwärmt<br />
haben. © Andreas Herrmann/ats<br />
Der Spatzenbrunnen erfrischt<br />
Mensch und Tier.<br />
© Andreas Herrmann/ats<br />
Weitere Informationen:<br />
aachen tourist service e.v.<br />
Tel. (0241) 180 29 60<br />
E-Mail: info@aachen-tourist.de<br />
www.aachen-tourist.de<br />
Der Elisenbrunnen. © Andreas Herrmann/ats<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1047<br />
Der Quell des<br />
Lebens sprudelt<br />
überall in<br />
Aachen.<br />
© Helene Souza_<br />
pixelio.de
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Sächsische Forscher arbeiten<br />
an <strong>Wasser</strong>versorgung Brasílias<br />
Die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt Brasiliens wird ab 2013 problematisch. Zu schaffen macht Brasília<br />
neben dem schnellen Wachstum der Bevölkerung vor allem der Wandel der Landnutzung im Bundesdistrikt<br />
um die Hauptstadt herum. Forscher aus Deutschland und Brasilien haben <strong>sich</strong> daher im Rahmen der Internationalen<br />
<strong>Wasser</strong>forschungsAllianz Sachsen zum Ziel gesetzt, die wissenschaftliche Grundlage zu schaffen,<br />
damit die <strong>Wasser</strong>ressourcen Brasílias und seiner Umgebung künftig nachhaltig bewirtschaftet werden.<br />
Im Jahr 1956 wurde Brasília für<br />
600 000 Menschen geplant. Mehr<br />
als 50 Jahre später stößt der Distrikt<br />
an seine Grenzen: 2,5 Mio. Menschen<br />
bevölkern die Hauptstadtregion.<br />
2025 werden es wahrscheinlich<br />
über 3,2 Mio. sein. Das ungebrochene<br />
Bevölkerungswachstum wird<br />
in naher Zukunft problematisch,<br />
besonders für die <strong>Wasser</strong>versorgung:<br />
„Die Stadt und der Bundesdistrikt<br />
Brasília werden ab 2013<br />
Schwierigkeiten mit der Trinkwasserversorgung<br />
bekommen“, sagt<br />
Prof. Holger Weiß. Der Leiter des<br />
UFZ-Departments Grundwassersanierung<br />
koordiniert zusammen mit<br />
Prof. Franz Makeschin von der Technischen<br />
Universität Dresden eines<br />
der fünf Projekte der Internationalen<br />
<strong>Wasser</strong>forschungsAllianz<br />
Sachsen (IWAS) in der Modellregion<br />
Lateinamerika, das Projekt IWAS<br />
Água DF.<br />
Geowissenschaftler suchen im Abstrom der Deponie<br />
Lixão do Jóquei nach belastetem Sickerwasser.<br />
© Reiner Stollberg/UFZ<br />
Die <strong>Wasser</strong>vorräte von Brasiliens Hauptstadt können in absehbarer<br />
Zeit dem Wachstum der Millionenstadt nicht mehr standhalten. Ein<br />
deutsch-brasilianisches Forscherteam hat <strong>sich</strong> zum Ziel gesetzt, bis<br />
2013 die wissenschaftlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass die<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcen Brasílias und seiner Umgebung in Zukunft<br />
nachhaltig bewirtschaftet werden können. © Prof. Dr. Georg Teutsch/UFZ<br />
Deutsches Know-how<br />
Ziel des vom Bundesforschungsministerium<br />
seit 2008 finanzierten<br />
Vorhabens ist es, für die Stadt und<br />
ihre Einwohner die wissenschaftlichen<br />
Grundlagen einer nachhaltigen<br />
Bewirtschaftung der <strong>Wasser</strong>ressourcen<br />
im Rahmen eines Integrierten<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcenmanagements<br />
(IWRM) zu schaffen. Ein Ansatz, der<br />
für Brasília sowie für ganz Südamerika<br />
noch weitgehend Neuland ist<br />
und gute Chancen bietet, deutsches<br />
Know-how zu vermarkten. Die<br />
schwierige <strong>Wasser</strong>versorgung ist<br />
typisch für viele boomende Städte in<br />
Lateinamerika und Asien: Die Anlage<br />
der Infrastruktur für die Versorgung<br />
und Entsorgung von <strong>Wasser</strong>, etwa<br />
der Bau von <strong>Abwasser</strong>leitungen,<br />
Kläranlagen und die Trinkwasseraufbereitung,<br />
hält mit der Bevölkerungsentwicklung<br />
kaum Schritt.<br />
Die Internationale <strong>Wasser</strong>forschungsAllianz<br />
Sachsen (IWAS) soll<br />
konkrete Beiträge zu einem integrierten<br />
<strong>Wasser</strong>ressourcen-Management<br />
(IWRM) in fünf hydrologisch<br />
sensitiven Regionen liefern. Ausgehend<br />
von drängenden <strong>Wasser</strong>problemen<br />
weltweit werden spezifische<br />
Fragestellungen in verschiedenen<br />
Weltregionen untersucht. IWAS ist<br />
ein Verbundprojekt des Helmholtz-<br />
Zentrums für Umweltforschung<br />
(UFZ), der Technischen Universität<br />
Dresden und der Stadtentwässerung<br />
Dresden GmbH als unternehmerischem<br />
Partner.<br />
Weitere Informationen bei:<br />
Helmholtz Centre For Environmental<br />
Research – UFZ<br />
www.ufz.de<br />
November 2011<br />
1048 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Aktuell NETZWERK WISSEN<br />
Netzwerk gegen Umweltprobleme<br />
im Mittelmeerraum<br />
Drohender Klimawandel<br />
Forschungszentren aus Frankreich und Deutschland haben ein Memorandum<br />
of Understanding unterzeichnet. In dieser Kooperation wollen<br />
deutsche und französische Forschungseinrichtungen Lösungen zur<br />
Anpassung an den globalen Wandel im Mittelmeerraum entwickeln.<br />
Das französische Forschungskonsortium SICMED vereint seine Kräfte<br />
mit dem deutschen TERENO-MED-Netzwerk, dessen Ziel es ist, Effekte<br />
des demografischen, ökonomischen und klimatischen Wandels auf<br />
mediterrane <strong>Wasser</strong>ressourcen und Ökosysteme zu untersuchen. Das<br />
Netzwerk wird geleitet vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung<br />
(UFZ) in Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.<br />
Der Mittelmeerraum, der die Länder<br />
Südeuropas, des östlichen<br />
Mittelmeerraums sowie Nordafrika<br />
einschließt, wird besonders stark<br />
von den Auswirkungen des globalen<br />
Klimawandels betroffen sein,<br />
etwa durch Dürren und <strong>Wasser</strong>knappheit.<br />
Hinzu kommen die politischen<br />
Entwicklungen in Nordafrika<br />
und dem Nahen Osten, die<br />
Bevölkerungszunahme, insbesondere<br />
durch Migration und die ökonomischen<br />
Entwicklungen in der<br />
Region. Diese werden die Land- und<br />
<strong>Wasser</strong>nutzung sowie Maßnahmen<br />
zur Sicherung von Nahrung, Energie<br />
und ökonomischem Wachstum in<br />
hohem Maße beeinflussen. Auch<br />
auf Europa werden <strong>sich</strong> die Veränderungen<br />
auswirken.<br />
Deshalb haben Deutschland und<br />
Frankreich ihre Aktivitäten vernetzt:<br />
Die Helmholtz-Gemeinschaft erweitert<br />
ihre integrierten Langzeit-<br />
Umweltobservatorien durch ein<br />
Observatoriennetzwerk im Mittelmeerraum<br />
zu „TERENO-MED“. Auf<br />
französischer Seite haben <strong>sich</strong> eine<br />
Reihe von Forschungsinitiativen<br />
zum übergreifenden „MISTRALS“-<br />
Verbund zusammengeschlossen.<br />
Hierzu gehört das Projekt SICMED,<br />
welches Landnutzungsänderungen<br />
und Effekte auf Ökologie und <strong>Wasser</strong><br />
beobachtet, ähnlich TERENO-<br />
MED. Beide Forschungskonsortien<br />
wollen Lösungsstrategien für eine<br />
nachhaltige Entwicklung der Mittelmeerregion<br />
entwickeln und streben<br />
daher eine verstärkte Zusammenarbeit<br />
an, bei der die Konzepte,<br />
Methoden und Modelle harmonisiert<br />
und gemeinsame Untersuchungsstandorte<br />
aufgebaut werden<br />
sollen.<br />
Deutschland und Frankreich<br />
stellen somit zusätzliche Mittel zur<br />
Verfügung, um die Richtlinie der<br />
Europäischen Kommission gegen<br />
<strong>Wasser</strong>knappheit und Dürren sowie<br />
die Ziele der <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
im wasserknappen Südeuropa<br />
und die Ziele des EU-Programms<br />
„Horizon 2020“ umzusetzen. Darüber<br />
hinaus können die Ergebnisse<br />
dazu beitragen, wichtige internationale<br />
politische Prozesse voranzutreiben,<br />
wie beispielsweise die<br />
Union für das Mittelmeer oder den<br />
„Blue Plan“ (MAP-UNEP) und eine<br />
verbesserte Zusammenarbeit zwischen<br />
Europa und Nordafrika.<br />
Zudem möchten das französische<br />
Umweltkonsortium „AllEnvie“, die<br />
Mitglieder des Forschungsbereichs<br />
„Erde und Umwelt“ der Helmholtz-<br />
Gemeinschaft und seine Partner das<br />
Forum nutzen, um die deutsch-französische<br />
Kooperation im Bereich<br />
der integrierten Umweltforschung<br />
zu vertiefen.<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.tereno.net<br />
www.ufz.de/index.php?de=21439<br />
www.sicmed.net/<br />
Helmholtz-Zentrum<br />
Im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung<br />
(UFZ) erforschen Wissenschaftler die Ursachen<br />
und Folgen der weit reichenden Veränderungen<br />
der Umwelt. Sie befassen <strong>sich</strong> mit <strong>Wasser</strong>ressourcen,<br />
biologischer Vielfalt, den Folgen des Klimawandels<br />
und Anpassungsmöglichkeiten, Umweltund<br />
Biotechnologien, Bioenergie, dem Verhalten<br />
von Chemikalien in der Umwelt, ihrer Wirkung<br />
auf die Gesundheit, Modellierung und sozialwissenschaftlichen<br />
Fragestellungen. Ihr Leitmotiv:<br />
Unsere Forschung dient der nachhaltigen Nutzung<br />
natürlicher Ressourcen und hilft, diese<br />
Lebensgrundlagen unter dem Einfluss des globalen<br />
Wandels langfristig zu <strong>sich</strong>ern. Das UFZ<br />
beschäftigt an den Standorten Leipzig, Halle und<br />
Magdeburg 1000 Mitarbeiter. Es wird vom Bund<br />
sowie von Sachsen und Sachsen-Anhalt finanziert.<br />
Website: http://www.ufz.de/<br />
UFZ-Standort Leipzig, Hauptgebäude 1.0<br />
© Norma Neuheiser<br />
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung<br />
(UFZ)<br />
Elisabeth Helen Krüger<br />
Koordination <strong>Wasser</strong>forschung<br />
Tel. (0341) 235 1671<br />
www.ufz.de/index.php?de=1432<br />
Forschungszentrum Jülich<br />
Prof. Harry Vereecken<br />
Tel. (02461) 61-4570<br />
www2.fz-juelich.de/icg/icg-4/index.<br />
php?index=139<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1049
NETZWERK WISSEN Aktuell<br />
Der Bachflohkrebs als Assistent<br />
Eine neue Studie zeigt, wie Ozonierung <strong>Abwasser</strong> reinigt<br />
Die Zufuhr von Ozon in Abwässer kann problematische Mikroverunreinigungen wie Pharmaka, Pflanzenschutzmittel<br />
oder Kosmetika aus Abwässern entfernen. Das weist eine neu entwickelte Test-Methode nach, die<br />
am Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau zusammen mit dem Schweizerischen<br />
Bundesamt für Umwelt im Rahmen des Pilotprojektes „Strategie MicroPoll“ entwickelt wurde. Diese Test-<br />
Methode basiert auf einem ganzheitlichen ökologischen Ansatz und untersucht anhand der Laubfraßrate des<br />
Bachflohkrebses Gammarus fossarum, wie wirksam Abwässer durch die Ozonierung gereinigt werden.<br />
Die Laubfraßrate<br />
des Bachflohkrebses<br />
gibt Auskunft<br />
über mögliche<br />
Verunreinigungen<br />
des <strong>Wasser</strong>s.<br />
© Wikipedia<br />
Moderne Kläranlagen haben es<br />
möglich gemacht: In Flüsse,<br />
die vor wenigen Jahrzehnten noch<br />
als stark verschmutzte Kloaken<br />
durch die Landschaft strömten,<br />
kehrte die Natur zurück. Dieser<br />
Erfolg basiert wesentlich auf der<br />
dreistufigen Reinigung der Abwässer:<br />
Grober Dreck wird mechanisch<br />
mit Rechen und Absetzbecken entfernt;<br />
in der biologischen Stufe fressen<br />
Milliarden von Mikroorganismen<br />
gelöste Stoffe; Phosphat wird<br />
schließlich chemisch durch Fällung<br />
entfernt. Doch Mikroverunreinigungen<br />
wie Medikamente, Kosmetika<br />
und Industriechemikalien können<br />
in den Kläranlagenausläufen noch<br />
in einer Konzentration im Nanound<br />
Milligramm-pro-Liter-Bereich<br />
gemessen werden. Besonders in<br />
dicht besiedelten Regionen können<br />
Fließgewässer einen hohen Anteil<br />
an biologisch gereinigtem <strong>Abwasser</strong><br />
aufwei sen. Dort verschlechtern<br />
die Mi kro verunreinigungen die<br />
Ge sund heit der <strong>Wasser</strong>lebewesen<br />
und belasten die Trinkwasservorkommen.<br />
Daher werden geeignete<br />
Technologien zur Reduzierung dieser<br />
Mikroverunreinigung gesucht,<br />
um Einträge in das Ökosystem und<br />
somit negative Auswirkungen auf<br />
Gesundheit des Menschen oder auf<br />
die Umwelt zu verhindern. Bei der<br />
Ozonierung wird Ozon in der dritten<br />
Reinigungsstufe in die weitestgehend<br />
geklärten Abwässer geleitet.<br />
Dort reagiert Ozon hauptsächlich<br />
mit organischen Substanzen<br />
und oxidiert diese auf.<br />
Die Methode<br />
Im Zentrum der Untersuchungen<br />
stand der ökologische Prozess rund<br />
um den Bachflohkrebs Gammarus<br />
fossarum. Dieser typische Bachbewohner<br />
hat die wichtige Aufgabe<br />
im Gewässerökosystem, die im Laub<br />
gebundene Energie anderen Organismen<br />
nutzbar zu machen.<br />
Welche Auswirkungen Mikroverunreinigungen<br />
und die Ozonierung<br />
von Ab wasser auf dieses Mikrosystem<br />
der Energiebereitstellung hat,<br />
un ter suchten die Landauer Wissenschaftler<br />
anhand der Laubfraßrate<br />
der Gammariden, also wie eifrig die<br />
Tierchen das Laub verspeisten oder<br />
verschmähten. In zahlreichen Experimenten<br />
im Labor und im Freiland<br />
zeigte <strong>sich</strong> ein deutlicher Zusammenhang<br />
zwischen Ozonierung,<br />
Schadstoffgehalt und dem Fressverhalten<br />
der Gammariden. In <strong>Wasser</strong>,<br />
das nicht mit Ozon behandelt war<br />
und somit eine erhöhte Schadstoffbelastung<br />
aufwies, war die Laubfraßrate<br />
träge, wohingegen die<br />
Gammariden in ozoniertem <strong>Wasser</strong><br />
eifrig fraßen. Andere Einflussgrößen<br />
auf das Fressverhalten wie veränderter<br />
Geschmack der Blätter oder<br />
der Anteil von gelöstem Kohlenstoff<br />
im Gewässer konnten die Wissenschaftler<br />
als Ursache ausschließen.<br />
Mit diesem Testsystem zeigt <strong>sich</strong><br />
darüber hinaus deutlich: „Mikroverunreinigungen<br />
können die chemische<br />
und ökologische Beschaffenheit<br />
von Gewässern stark beeinflussen“,<br />
unterstreicht Dr. Mirco<br />
Bundschuh, Leiter der Studie am<br />
Landauer Institut für Umweltwissenschaften.<br />
Damit die Vorgaben der<br />
europäischen <strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
eingehalten werden können, die<br />
bis 2015 eine gute chemische und<br />
ökologische Qualität in Gewässern<br />
vorsieht, sollten die Einträge von<br />
Mikroverunreinigungen durch Kläranlagen<br />
dringend reduziert werden,<br />
so Bundschuh weiter. Mit den derzeitigen<br />
Reinigungstechnologien in<br />
Kläranlagen könne nicht ausreichend<br />
<strong>sich</strong>ergestellt werden, dass<br />
das <strong>Abwasser</strong> hinreichend sauber<br />
und frei von Schadstoffen werde.<br />
„Die effiziente Reinigung von<br />
<strong>Abwasser</strong>n ist ein Zukunftsthema“,<br />
betont Bundschuh. Denn aufgrund<br />
des Klimawandels wird es künftig<br />
teilweise weniger Niederschlag im<br />
Sommer geben, so dass der Anteil<br />
an <strong>Abwasser</strong> in Oberflächengewässern<br />
aufgrund der mangelnden Verdünnung<br />
durch Regenwasser prozentual,<br />
zumindest lokal, zunehmen<br />
wird.<br />
Die Studie ist nachzulesen in<br />
„Water Research“ unter http://www.<br />
elsevier.com/locate/watres oder<br />
direkt bei den Autoren zu beziehen<br />
unter bundschuh@uni-landau.de<br />
oder r.schulz@uni-landau.de<br />
November 2011<br />
1050 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
318. <strong>Wasser</strong>rechtliches Kolloquium<br />
09. Dezember 2011, Curtius-Konfernzaum des Bonner Universitätsclubs, Bonn<br />
Dr. Katharina Kern, Helmholtz-<br />
Zentrum für Umweltforschung<br />
Leipzig, Department Umwelt- und<br />
Planungsrecht, hält einen Vortrag<br />
zum Thema: Arzneimittel als potenzielle<br />
Umweltschadstoffe – Wie geht<br />
das Recht mit dieser Gefährdungslage<br />
um?<br />
Arzneimittelwirkstoffe werden<br />
zunehmend in der Umwelt (Flüsse,<br />
Seen, Grundwasser, Boden) und<br />
sogar im Trinkwasser gefunden. Sie<br />
gelten heute als potenzielle Umweltschadstoffe,<br />
denn sie können durch<br />
Persistenz und Akkumulation nachhaltig<br />
Tiere schädigen und möglicherweise<br />
auch den Menschen<br />
gefährden.<br />
In diesem Vortrag wird skizziert,<br />
wie das ursprünglich als reines<br />
Gesundheitsrecht konzipierte Arzneimittelrecht<br />
mit dieser Gefährdungslage<br />
der Umwelt durch Arzneistoffe<br />
umgeht. Wie wird das<br />
Umweltrisiko von Arzneimitteln<br />
bestimmt und in welchem Ausmaß<br />
und mit welchen Folgewirkungen<br />
wird es in den arzneimittelrechtlichen<br />
Instrumenten der Vormarktund<br />
der Nachmarktkontrolle be -<br />
rück<strong>sich</strong>tigt? Welche Probleme er -<br />
geben <strong>sich</strong> aufgrund der Eigenart<br />
der Umweltrisiken in der Regulierung<br />
und im Vollzug? An welchen<br />
Stellen und warum werden Humanund<br />
Tierarzneimittel unterschiedlich<br />
vom Gesetz behandelt?<br />
Diesen Fragen geht der Vortrag<br />
nach. Daneben soll ein Blick in sektorale<br />
Umweltgesetze (Chemikalien-,<br />
<strong>Wasser</strong>- und Agrarrecht) und<br />
deren Reaktion auf den Eintrag von<br />
umweltgefährlichen Arzneistoffen<br />
in die Umwelt geworfen werden.<br />
Außerdem werden rechtliche und<br />
gesellschaftspolitische Handlungsstrategien<br />
zur Reduzierung der<br />
Umweltrisiken von Arzneistoffen<br />
aufgezeigt.<br />
Dr. Katharina Kern ist wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum<br />
für Umweltforschung<br />
in Leipzig, im Department<br />
Umwelt- und Planungsrecht. Ein<br />
Arbeitsschwerpunkt von Dr. Kern<br />
umfasst Fragen der Regulierung von<br />
gesundheits- und umweltschädlichen<br />
Risiken von Stoffen (Arzneimittel,<br />
Biozide, Pestizide, Kosmetika,<br />
Chemikalien) durch das europäische<br />
und nationale Stoffrecht sowie<br />
durch angrenzende Rechtsgebiete<br />
wie z. B. das <strong>Wasser</strong>recht. Die Dissertation<br />
„Rechtliche Regulierung der<br />
Umweltrisiken von Human- und<br />
Tierarzneimitteln“, die diesem Vortrag<br />
zu Grunde liegt, wurde mit drei<br />
Preisen ausgezeichnet.<br />
Anmeldung bis zum 01.12.2011<br />
per E-Mail an irwe@uni-bonn.de<br />
Weitere Informationen:<br />
www.jura.uni-bonn.de<br />
BDEW Bundesverband der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e.V.<br />
Aktuelle Veranstaltungen<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>hausanschlüsse<br />
15. November 2011, Düsseldorf<br />
<strong>Wasser</strong>entgelte – so kalkulieren Sie richtig<br />
22. November 2011, Düsseldorf<br />
Streitpunkt <strong>Wasser</strong>zähler<br />
8. Dezember 2011, Erfurt<br />
Jetzt informieren und anmelden:<br />
www.ew-online.de<br />
BDEW_AZ_86x59_<strong>Wasser</strong>.indd 1 November 2011<br />
13.10.11 10:15<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1051
Nachrichten<br />
Vereine, Verbände und Organsisationen<br />
Technisches Sicherheitsmanagement in China –<br />
Eine euro-asiatische Erfolgsstory<br />
Gespräche<br />
zum TSM im<br />
<strong>Wasser</strong>werk<br />
Shenzhen<br />
(Liming Zhou,<br />
stellv.<br />
Geschäftsführer<br />
WW<br />
Shenzhen<br />
(2. v. l.),<br />
Thomas Zenz,<br />
DVGW<br />
(3. v. l.)).<br />
Quelle: DVGW<br />
Der DVGW Deutscher Verein des<br />
Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V. hat<br />
mit Förderung durch das Bundesministerium<br />
für Umwelt, Naturschutz<br />
und Reaktor<strong>sich</strong>erheit (BMU) einen<br />
Meilenstein bei Aufbau und Im -<br />
plementierung des Technischen<br />
Sicherheitsmanagements (TSM) für<br />
die <strong>Wasser</strong>versorgung in China<br />
gelegt [1]. Nach vor<strong>sich</strong>tigen Schätzungen<br />
der chinesischen Vereinigung<br />
für die städtische <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
CUWA (Chinese Urban<br />
Water Association) haben bereits<br />
über 200 <strong>Wasser</strong>werke eine interne<br />
TSM-Selbstüberprüfung vorgenommen.<br />
Hintergrund<br />
Seit über vier Jahren unterstützt der<br />
DVGW die CUWA beim Aufbau eines<br />
eigenen TSM auf der Grundlage des<br />
DVGW TSM [2, 3, 4]. Diese Entwicklungen<br />
basieren auf einer Kooperation<br />
zwischen CUWA und DVGW<br />
einschließlich der Übernahme und<br />
Anpassung einiger zentraler Regelwerke<br />
des DVGW. China hat <strong>sich</strong><br />
bewusst nach einem globalen Ranking<br />
dafür entschieden, Elemente<br />
der <strong>Wasser</strong>versorgung nach deutschem<br />
Vorbild zu übernehmen. Dies<br />
gilt insbesondere für das Technische<br />
Sicherheitsmanagement TSM des<br />
DVGW.<br />
Die Tatsache, dass die chinesische<br />
<strong>Wasser</strong>behörde bereits im Jahr<br />
2008 vier TSM-Pilotprojekte durchgeführt<br />
hat, unterstreicht den Willen<br />
Chinas, das deutsche TSM flächendeckend<br />
einzuführen.<br />
Die viel versprechende Entwicklung<br />
des TSM in China hat das BMU<br />
veranlasst, das DVGW Projekt<br />
„Aufbau und Implementierung<br />
eines technischen Sicherheitsmanagementsystems<br />
für die <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
in der Volksrepublik<br />
China auf Basis des DVGW-Regelwerkes<br />
W 1000 (DVGW-TSM)“ für<br />
das Jahr 2009 zu fördern.<br />
Erfolgsbilanz<br />
Das TSM-Verfahren ist auf eine<br />
breite Zustimmung bei den chinesischen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgern und Behörden<br />
gestoßen. Folgendes Ergebnis<br />
ist Beleg für den Gesamterfolg der<br />
Projektarbeit:<br />
""<br />
Nach zurückhaltenden Schätzungen<br />
der CUWA haben bereits<br />
über 200 <strong>Wasser</strong>versorger aus<br />
etwa acht Provinzen eine interne<br />
TSM-Selbstüberprüfung vollzogen.<br />
Dabei haben die <strong>Wasser</strong>versorger<br />
anhand eines Fragebogens<br />
ihr eigenes Unternehmen<br />
auf freiwilliger Basis überprüft.<br />
Die Erwartungen von DVGW und<br />
CUWA wurden bei Weitem übertroffen.<br />
Dieser Gesamterfolg ist das Ergebnis<br />
einer Reihe von Einzelelementen.<br />
Hier sind u. a. folgende Aspekte<br />
hervorzuheben:<br />
""<br />
Das einheitliche Verständnis von<br />
Prozessen und Randbedingungen<br />
des TSM-Verfahrens konnte<br />
wesentlich verbessert werden,<br />
insbesondere vor dem Hintergrund<br />
unterschiedlicher Sprachen<br />
und Mentalitäten. Gute<br />
Voraussetzungen für diese<br />
erfolgreiche Kommunikation<br />
haben vor allem die direkten,<br />
persönlichen Gespräche im Rahmen<br />
von gemeinsamen Arbeitstreffen<br />
geboten.<br />
""<br />
Grundlage für die Zusammenarbeit<br />
von CUWA und DVGW sind<br />
bislang drei aufeinander aufbauende<br />
Kooperationsvereinbarungen.<br />
Diese beziehen <strong>sich</strong> u. a. auf<br />
die Randbedingungen, Strukturen<br />
und Prozesse des TSM-Verfahrens.<br />
""<br />
Aufgrund der im Rahmen von<br />
TSM-Pilotprojekten erzielten Er -<br />
gebnisse haben die beteiligten<br />
<strong>Wasser</strong>versorger unmittelbar Verbesserungsmaßnahmen<br />
eingeleitet.<br />
TSM-Experten wurden<br />
nach ihren Erfahrungen zur verfahrenstechnischen<br />
Abwicklung<br />
der TSM-Vor-Ort-Überprüfungen<br />
bei jenen Pilotprojekten befragt.<br />
Diese wurden zur Fortentwicklung<br />
des TSM-Verfahrens genutzt.<br />
""<br />
DVGW und CUWA haben den<br />
Trinkwasserversorgungsunternehmen<br />
TSM u. a. im Rahmen<br />
mehrerer Veranstaltungen erläutert<br />
und die Vorteile bekannt<br />
gemacht.<br />
""<br />
Das Feedback aus den chinesischen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgungsunter-<br />
November 2011<br />
1052 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Vereine, Verbände und Organsisationen<br />
Nachrichten<br />
nehmen zum TSM-Leitfaden ist<br />
durchweg positiv. Die Tatsache,<br />
dass einige große <strong>Wasser</strong>versorger<br />
bei der Erarbeitung des TSM-<br />
Leitfadens beteiligt wurden, hat<br />
den Imagetransfer wesentlich<br />
unterstützt.<br />
""<br />
CUWA hat den TSM-Leitfaden,<br />
der die Grundlage der internen,<br />
sowie externen TSM-Überprüfungen<br />
bildet, mit den Erfahrungen<br />
aus den Pilotprojekten fortgeschrieben<br />
und als offizielle<br />
Fassung veröffentlicht.<br />
""<br />
Das TSM-Verfahren ist mittlerweile<br />
weithin anerkannt und wird<br />
durch das zuständige Bauministerium<br />
zunehmend unterstützt.<br />
Dies wird z. B. durch die Art der<br />
Veröffentlichung des TSM-Leitfadens<br />
er<strong>sich</strong>tlich. So ordnete das<br />
Bauministerium offiziell an, den<br />
Leitfaden nicht nur an die CUWA-<br />
Mitgliedsunternehmen, sondern<br />
an alle städtischen <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
zu versenden.<br />
Ein weiteres Beispiel für die<br />
Unterstützung durch das Bauministerium<br />
bestand in der besonderen<br />
Art der Bekanntmachung<br />
des TSM-Leitfadens in der zu<br />
CUWA gehörenden „Zeitung für<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung und -Sparen“,<br />
die einer „Werbung“ für dieses<br />
Verfahren gleich kam. Beide Aktionen<br />
sind für chinesische Verhältnisse<br />
außergewöhnlich und ein<br />
deutliches Zeichen für die <strong>Wasser</strong>versorger,<br />
dass das TSM staatliche<br />
Unterstützung findet.<br />
""<br />
Von grundsätzlicher und wesentlicher<br />
Bedeutung wird seitens<br />
CUWA und den chinesischen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgern die neue Art<br />
der technischen Regelwerksentwicklung<br />
herausgestellt, die mit<br />
dem TSM verbunden ist. Bisher<br />
wurden ähnliche Prozesse oder<br />
Dokumente seitens der chinesischen<br />
Regierung „Top-Down“<br />
eingeführt. Der TSM-Leitfaden<br />
und das TSM-Verfahren wurden<br />
aber „von unten nach oben“<br />
nach dem „Bottom-Up Prinzip“<br />
erstellt. Damit ist es dem DVGW<br />
gelungen, in China Grundlagen<br />
Die Erfolge auf einen Blick:<br />
Interne TSM-Selbstüberprüfungen bei über 200 chinesischen <strong>Wasser</strong>versorgern<br />
Überaus positives Feedback aus den chinesischen <strong>Wasser</strong>versorgungsunternehmen<br />
zum TSM<br />
Fortschritte hin zu einem einheitlichen Verständnis des TSM-Verfahrens<br />
Verbesserungsmaßnahmen bei den <strong>Wasser</strong>versorgern durch TSM-Pilotprojekte<br />
Wachsende Zustimmung zur DVGW/CUWA Kooperation in China und Deutschland<br />
Veranstaltungen zur Bekanntmachung des TSM in vielen chinesischen Provinzen<br />
Offizielle Fassung des TSM-Leitfadens im April 2009 von CUWA veröffentlicht<br />
Anerkennung und Unterstützung des TSM durch das zuständige Bauministerium<br />
Stärkung der technischen Selbstverwaltung international<br />
Etablierung des DVGW als internationaler „Systemgarant“ für TSM<br />
für die Entstehung einer technischen<br />
Selbstverwaltung zu<br />
legen, ein Prinzip, das für<br />
Deutschland und nur wenige<br />
andere Länder die entscheidende<br />
Basis für eigenverantwortliches<br />
wirtschaftliches Handeln<br />
bildet.<br />
""<br />
TSM wurde 2011 in das so<br />
genannte „Chinesische <strong>Wasser</strong>projekt“<br />
aufgenommen, ein Forschungsprojekt,<br />
das mit mehreren<br />
Mrd. Euro ausgestattet ist.<br />
Auch in Deutschland hat die Kooperation<br />
zwischen DVGW und CUWA<br />
bei den Mitgliedern des DVGW und<br />
der <strong>Wasser</strong>wirtschaft insgesamt<br />
eine neue Akzeptanz erfahren. Dies<br />
wurde durch die CUWA/DVGW<br />
Arbeitstreffen zum 150-Jahre-Jubiläumskongress<br />
des DVGW deutlich.<br />
Als öffentliche Demonstration der<br />
Bedeutung der CUWA-DVGW<br />
Kooperation wurde der CUWA-Präsident<br />
Zhengdong Li als Ehrenmitglied<br />
in den DVGW aufgenommen.<br />
Nächste Schritte<br />
Wesentliche nächste Schritte zur<br />
weiteren Einrichtung und dauerhaften<br />
Etablierung des TSM-Verfahrens<br />
in China sind:<br />
""<br />
das TSM-Verfahren innerhalb<br />
des institutionellen Rahmens in<br />
China zu implementieren und zu<br />
stabilisieren<br />
""<br />
eine Gremienstruktur in der<br />
CUWA zur Abwicklung und<br />
Fortentwicklung des TSM aufzubauen<br />
""<br />
ein System und eine geregelte<br />
Verfahrensweise zur externen<br />
Überprüfung der <strong>Wasser</strong>versorger<br />
auf der Grundlage des TSM-<br />
Leitfadens zu entwickeln<br />
""<br />
Prozesse zur Fortschreibung der<br />
chinesischen technischen Regeln<br />
und Anforderungen aufgrund<br />
der gewonnenen Erfahrungen<br />
Gespräche mit der chinesischen Delegation im Rahmen des 150 Jahre-<br />
Jubiläums-Kongresses des DVGW (v.r.n.l.: Dr. Thielen, Prof. Mehlhorn, Dr.<br />
Hörsgen, Dr. Hames, Prof. Li, Wenxing Ma, Thomas Zenz). Quelle: DVGW<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1053
Nachrichten<br />
Vereine, Verbände und Organsisationen<br />
im Rahmen des TSM-Verfahrens<br />
zu implementieren<br />
""<br />
einen unterstützenden fachlichen<br />
Rahmen für die <strong>Wasser</strong>versorger<br />
zur Verbesserung ihrer<br />
Leistungsfähigkeit zu schaffen.<br />
Dazu gehören beispielsweise<br />
Schulungsmaßnahmen für Personal,<br />
Bereitstellung einer In -<br />
formationsplattform für die verschiedensten<br />
technischen Be -<br />
lange, einschließlich Forschungsvorhaben,<br />
Organisation von Veranstaltungen<br />
zum fach lichen<br />
Erfahrungsaustausch.<br />
Zur Umsetzung der nächsten<br />
Schritte ist ein TSM Workshop in<br />
China geplant. Dabei soll auch der<br />
mögliche Aufbau eines TSM-Verfahrens<br />
in China für Gas einbezogen<br />
werden.<br />
Zusammenfassung<br />
Das CUWA TSM-Verfahren hat mit<br />
Hilfe des DVGW die angestrebte<br />
breite Zustimmung bei den chinesischen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgern und Behörden<br />
gefunden. Die finanzielle Förderung<br />
durch das BMU war sehr<br />
hilfreich.<br />
Deutlicher Beleg für den Gesamterfolg<br />
der Projektarbeit ist die Tatsache,<br />
dass bereits eine große Anzahl<br />
von <strong>Wasser</strong>versorgern aus unterschiedlichen<br />
Gebieten Chinas auf<br />
freiwilliger Basis eine interne TSM-<br />
Selbstüberprüfung durchgeführt<br />
hat.<br />
Die neue Art der technischen<br />
Regelwerksentwicklung, die mit<br />
dem TSM verbunden ist, wird auch<br />
auf chinesischer Seite als eine<br />
erfolgreiche Entwicklung von<br />
grundsätzlicher Bedeutung gewertet.<br />
Bisher wurden ähnliche Prozesse<br />
oder Dokumente seitens der<br />
chinesischen Regierung „Top-Down“<br />
eingeführt. Der TSM-Leitfaden und<br />
das TSM-Verfahren wurden aber<br />
„von unten nach oben“ nach dem<br />
„Bottom-Up Prinzip“ erstellt. Dieses<br />
Prinzip ist auch grundlegendes Element<br />
der technischen Selbstverwaltung<br />
in Deutschland.<br />
CUWA Präsident Zhendong Li<br />
dankte dem DVGW und dem BMU<br />
für die Unterstützung: „Dies ist eine<br />
wertvolle Hilfe für die künftige Verbreitung<br />
und Zustimmung zum<br />
CUWA TSM. Ich schätze das TSM als<br />
besonders wertvoll und bedanke<br />
mich ausdrücklich beim DVGW als<br />
dessen Systementwickler sowie bei<br />
den dafür zuständigen internationalen<br />
Systemgaranten“, erklärte Li.<br />
Literatur<br />
[1] Abschluss zum Fördervorhaben des<br />
Bundesministeriums für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktor<strong>sich</strong>erheit<br />
„Aufbau und Implementierung eines<br />
technischen Sicherheitsmanagementsystems<br />
für die <strong>Wasser</strong> versorgung in<br />
der Volksrepublik China auf Basis des<br />
DVGW-Regelwerkes W 1000 (DVGW-<br />
TSM)“ des DVGW, Ansprechpartner:<br />
Dipl.-Ing. Thomas Zenz, Internetseite<br />
des DVGW www.dvgw/angeboteleistungen/<br />
technisches<strong>sich</strong>erheitsmangement-tsm/<br />
[2] DVGW Internet „Zusammenarbeit<br />
zwischen DVGW und CUWA besiegelt<br />
– Chinesischer <strong>Wasser</strong>verband CUWA<br />
baut mit Unterstützung des DVGW<br />
ein Technisches Sicherheitsmanagement<br />
TSM in China auf „http://www.<br />
dvgw.de/dvgw/dvgw-international/<br />
meldungsdetails/meldung/8531/<br />
liste/11631/link//4937cc4a6dbe1d29<br />
d03cac5ad2665afb/“<br />
[3] Dipl.-Ing. Thomas Zenz, Wenxing Ma:<br />
Kooperation mit dem chinesischen<br />
<strong>Wasser</strong>verband. DVGW energie|<br />
wasser- praxis (2009) Nr. 3, S. 94-95.<br />
[4] Dipl.-Ing. Thomas Zenz, Wenxing Ma<br />
„Die Trinkwasserversorgung in<br />
China“, DVGW energie|wasser-praxis,<br />
Jahresrevue 2007/2008, S. 94–97.<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Li Zehndong<br />
„Zusammenkommen ist ein<br />
Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt,<br />
zusammenarbeiten ein<br />
Erfolg“, Geleitwort zur Jahresausgabe<br />
2007 /2008, S. 3.<br />
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank<br />
Gröschl „Kooperationsvereinbarung<br />
mit CWSA“, DVGW energie|wasserpraxis,<br />
Nr. 7/2005, S. 63.<br />
Autor:<br />
Dipl.-Ing. Thomas Zenz,<br />
DVGW Deutscher Verein des Gas- und<br />
<strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch wissenschaftlicher Verein,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3-6,<br />
D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9188- 858,<br />
Fax (0228) 9188-990,<br />
E-Mail: zenz@dvgw.de,<br />
www.dvgw.de<br />
Ihre Hotlines für <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Redaktion<br />
Mediaberatung<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, München<br />
Inge Matos Feliz, München<br />
Telefon (089) 45051-318 Telefon (089) 45051-228<br />
Telefax (089) 45051-323 Telefax (089) 45051-207<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Leserservice <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Brigitte Krawczyk, München<br />
Postfach 9161, 97091 Würzburg Telefon (089) 45051-226<br />
Telefon +49 (0) 931/4170-1615 Telefax (089) 45051-300<br />
Telefax +49 (0) 931/4170-492<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
e-mail: leserservice@oldenbourg.de<br />
Wenn Sie spezielle Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne.<br />
November 2011<br />
1054 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Recht und Regelwerk<br />
Regelwerk <strong>Wasser</strong><br />
W 213-5 Entwurf: Filtrationsverfahren zur Partikelentfernung –<br />
Teil 5: Membranfiltration<br />
Einspruchsfrist: Die Einspruchsfrist<br />
endet am 31. Januar 2012<br />
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis<br />
„Membran- und Feinfiltration“<br />
im Technischen Komitee „<strong>Wasser</strong>aufbereitungsverfahren“<br />
überarbeitet<br />
und um ein Kapitel zur<br />
Durchführung von Integritätstests<br />
erweitert. Es gilt für die Entfernung<br />
von Partikeln bei der Aufbereitung<br />
von <strong>Wasser</strong> zu Trinkwasser mittels<br />
Membranfiltration (Ultra- und Mikrofiltration).<br />
Es erläutert die spezifischen<br />
Begriffe, die Spül- und Reinigungsverfahren<br />
sowie die Einflussgrößen<br />
auf den Betrieb, deren<br />
Kenntnisse für Planung, Betrieb,<br />
Überwachung und Instandhaltung<br />
von Membranfiltrationsanlagen in<br />
der Trinkwasseraufbereitung erforderlich<br />
sind.<br />
Anlagentechnische Details, die<br />
auf den Verfahrensschritt Membranfiltration<br />
keinen Einfluss haben,<br />
sind nicht Gegenstand dieses<br />
Arbeitsblattes.<br />
Einsprüche an die DVGW-Hauptgeschäftsführung,<br />
Postfach 140362,<br />
D-53058 Bonn.<br />
Preis:<br />
€ 27,61 für Mitglieder,<br />
€ 36,82 für Nichtmitglieder.<br />
W 235-3 Entwurf: Zentrale Enthärtung in der Trinkwasserversorgung –<br />
Teil 3: Ionenaustauschverfahren, 9/2011<br />
Einspruchsfrist: Die Einspruchsfrist<br />
endet am 31. Dezember 2011<br />
Bezüglich der Härte des Trinkwassers<br />
stellt auch die im November<br />
inkrafttretende Trinkwasserverordnung<br />
keine Anforderung. Aufgrund<br />
der mit hohen Härtegraden verbundenen<br />
technischen Nachteile, wie<br />
beispielsweise störende Kalkablagerungen<br />
in Warmwasserbereitern,<br />
ist es jedoch Aufgabe des <strong>Wasser</strong>versorgers,<br />
die Notwendigkeit einer<br />
zentralen Enthärtung zu prüfen. Die<br />
dazu in Frage kommenden zentralen<br />
Enthärtungsverfahren und ihre<br />
Vor- und Nachteile sind in W 235-1<br />
„Grundlagen und Verfahren“ be -<br />
schrieben. Darauf aufbauend geht<br />
der nun erschienene Teil 3 auf die<br />
verfahrenstechnischen Eigenheiten<br />
von Ionenaustauschanlagen in<br />
einer Variante ein, wie sie zur zentralen<br />
Enthärtung in der Trinkwasseraufbereitung<br />
eingesetzt werden.<br />
Zudem werden Hinweise zu Planung<br />
und Betrieb dieser Ionenaustauschanlagen<br />
und Anforderungen<br />
an die erforderlichen Aufbereitungsstoffe<br />
benannt. Da bei dieser Verfahrensvariante<br />
auch Neutralsalzanionen<br />
entfernt werden können,<br />
wird deren Konzentrations ver minderung<br />
als Nebenziel im Arbeitsblatt<br />
mitbehandelt. Als informativen<br />
Anhang enthält das Arbeitsblatt<br />
Fallbeispiele zur orientierenden<br />
Ableitung der mittleren<br />
Beschaffenheit eines durch Ionenaustausch<br />
enthärteten <strong>Wasser</strong>s.<br />
Besonderheiten der Trinkwasserenthärtung<br />
für industrielle Sonderanwendungen<br />
und dezentrale Enthärtung<br />
mittels stark saurer Kationenaustauscher<br />
sind nicht Gegenstand<br />
des Arbeitsblattes.<br />
Teil 2 des Arbeitsblattes zu<br />
Fällungsverfahren wird derzeit im<br />
Projektkreis erarbeitet.<br />
Preis:<br />
€ 27,61 für Mitglieder,<br />
€ 36,82 für Nichtmitglieder.<br />
W 112: Grundsätze der Grundwasserprobennahme aus Grundwassermessstellen, 9/2011<br />
Der<br />
Grundwasserprobennahme<br />
kommt im Zusammenhang mit<br />
der Überwachung und dem Schutz<br />
des Grundwassers sowie als Grundlage<br />
für ein hydrogeochemisches<br />
System- und Prozessverständnis<br />
eine zentrale Bedeutung zu. Repräsentative<br />
und qualitätsge<strong>sich</strong>erte<br />
Grundwasserproben sind nur als<br />
Ergebnis zahlreicher ineinandergreifende<br />
Arbeitsabläufe zu erhalten.<br />
Das Arbeitsblatt behandelt die<br />
Arbeitsschritte der Grundwasserprobennahme<br />
beginnend mit einer<br />
fachlich fundierten Planung über<br />
die Durchführung einschließlich<br />
der Probenübergabe an ein Laboratorium<br />
bis hin zur Auswertung und<br />
Dokumentation. Für den gesamten<br />
Arbeitsablauf werden durchgängig<br />
qualitäts<strong>sich</strong>ernde Maßnahmen be -<br />
schrieben.<br />
Die qualitätsge<strong>sich</strong>erte Grundwasserprobennahme<br />
verursacht<br />
zwangsläufig höhere finanzielle<br />
Aufwendungen. Sie sind jedoch<br />
angemessen und verhältnismäßig,<br />
weil bei der Probennahme begangene<br />
Fehler im Labor nicht mehr<br />
korrigiert werden können und weil<br />
häufig weitreichende Entscheidungen<br />
auf der Grundlage der Analysenergebnisse<br />
getroffen werden<br />
<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1055
Recht und Regelwerk<br />
müssen. Bei der Grundwasserüberwachung<br />
sind Einsparpotenziale<br />
nicht durch Qualitätsabstriche, sondern<br />
in erster Linie durch die Optimierung<br />
des Messnetzbetriebes,<br />
z. B. bei der Anzahl der zu beprobenden<br />
Messstellen, der Probennahmeintervalle<br />
und des Parameterumfangs<br />
gegeben.<br />
Das Arbeitsblatt ersetzt das<br />
Merkblatt W 112 „Entnahme von<br />
<strong>Wasser</strong>proben bei der Erschließung,<br />
Gewinnung und Überwachung von<br />
Grundwasser“ vom Juli 2001.<br />
Zudem integriert es die DVWK-<br />
Regel 128/1992 „Entnahme und<br />
Untersuchungsumfang von Grundwasserproben“<br />
sowie das DVWK-<br />
Merkblatt 245/1997 „Tiefenorientierte<br />
Probennahme aus Grundwassermessstellen“.<br />
Dieses Arbeitsblatt erscheint<br />
inhaltlich gleich im DWA-Regelwerk<br />
als DWA-A 909.<br />
Preis:<br />
€ 20,59 für Mitglieder,<br />
€ 27,45 für Nichtmitglieder.<br />
Bezugsquelle:<br />
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft<br />
Gas und <strong>Wasser</strong> mbH,<br />
Josef-Wirmer-Straße 3, D-53123 Bonn,<br />
Tel. (0228) 9191-40, Fax (0228) 9191-499,<br />
www.wvgw.de<br />
Ankündigung zur Fortschreibung der<br />
DVGW-Regelwerke gemäß GW 100<br />
Folgende Regelwerke werden erarbeitet:<br />
""<br />
DVGW-Merkblattes GW 13:<br />
Durch den kathodischen Korrosionsschutz<br />
(KKS) gestützte<br />
zustandsorientierte Instandhaltung<br />
von Gas- und <strong>Wasser</strong>verteilungsnetzen<br />
Das technische Komitee G-TK-1-10<br />
Außenkorrosion hat die Erarbeitung<br />
des DVGW-Merkblattes „Durch den<br />
kathodischen Korrosionsschutz<br />
(KKS) gestützte zustandsorientierte<br />
Instandhaltung von Gas- und <strong>Wasser</strong>verteilungsnetzen“<br />
beschlossen.<br />
Dazu wurde ein entsprechender<br />
Projektkreis einberufen.<br />
""<br />
DVGW-Merkblatt GW 17: Kathodischer<br />
Korrosionsschutz (KKS) –<br />
Praxishinweise zum Umgang mit<br />
der Referenzwertmethode<br />
Das technische Komitee G-TK-1-10<br />
Außenkorrosion hat die Erarbeitung<br />
des DVGW-Merkblattes GW 17<br />
„Kathodischer Korrosionsschutz<br />
(KKS) – Praxishinweise zum Umgang<br />
mit der Referenzwertmethode“<br />
beschlossen. Dazu wurde ein entsprechender<br />
Projektkreis einberufen.<br />
Folgende Regelwerke werden überarbeitet:<br />
""<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 306: Verbinden<br />
von Blitzschutzanlagen<br />
mit metallenen Gas- und <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
in Verbrauchsanlagen<br />
Das technische Komitee G-TK-1-10<br />
Außenkorrosion hat die Überarbeitung<br />
des DVGW-Arbeitsblattes GW<br />
306 „Verbinden von Blitzschutzanlagen<br />
mit metallenen Gas- und <strong>Wasser</strong>leitungen<br />
in Verbrauchsanlagen“<br />
beschlossen. Dazu wurde ein entsprechender<br />
Projektkreis einberufen.<br />
""<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 316<br />
Instandsetzung von Trinkwasserbehältern–<br />
Qualifikationskriterien<br />
für Fachunternehmen –<br />
Fachauf<strong>sich</strong>t und Fachpersonal<br />
für die Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern; Lehr- und<br />
Prüfungsplan<br />
Das technische Komitee W-TK-2-2<br />
<strong>Wasser</strong>speicherung hat die Überarbeitung<br />
des DVGW-Arbeitsblattes W<br />
316:2004-03 „Instandsetzung von<br />
Trinkwasserbehältern – Qualifikationskriterien<br />
für Fachunternehmen –<br />
Fachauf<strong>sich</strong>t und Fachpersonal für<br />
die Instandsetzung von Trinkwasserbehältern;<br />
Lehr- und Prüfungsplan“<br />
beschlossen. Dazu wurde ein entsprechender<br />
Projektkreis einberufen.<br />
Bei Interesse und Rückfragen:<br />
Dipl.-Ing. Peter Frenz,<br />
Referent Korrosionsschutz &<br />
<strong>Wasser</strong> speicherung, <strong>Wasser</strong>bereich<br />
Tel. (0228) 9188-654, Fax (0228) 9188-988,<br />
E-Mail: frenz@dvgw.de<br />
November 2011<br />
1056 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Recht und Regelwerk<br />
Neue Merkblätter erschienen<br />
Entwurf Merkblatt DWA-M 366: Maschinelle Schlammentwässerung<br />
Die Entwässerung von Klärschlämmen<br />
gehört zu den<br />
wichtigsten Grundoperationen der<br />
gesamten Klärschlammbehandlung.<br />
Seit Jahrzehnten werden auf Kläranlagen<br />
zur Entwässerung verschiedene<br />
maschinelle Verfahren eingesetzt<br />
und betrieben. Das Merkblatt<br />
DWA-M 366 stellt die verschiedenen<br />
Verfahren sowie deren Leistungsfähigkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit dar.<br />
Darüber hinaus gibt es Hinweise zu<br />
den betrieblichen Anforderungen,<br />
insbesondere zu der beim Einsatz<br />
maschineller Entwässerungsaggregate<br />
erforder lichen Konditionierung<br />
des Schlamms. Über die Vorstellung<br />
der unterschiedlichen Verfahrenstechniken<br />
wie Zentrifugen oder Filterpressen<br />
hinaus – gibt das Merkblatt<br />
Hinweise zu langfristigen<br />
Betriebserfahrungen und widmet<br />
<strong>sich</strong> auch der Frage der Optimierung<br />
des Energieverbrauchs. Das Merkblatt<br />
richtet <strong>sich</strong> damit vor allem an<br />
den Praktiker auf der Kläranlage<br />
sowie an planende und ausführende<br />
Ingenieure und Techniker.<br />
Das Merkblatt DWA-M 366 basiert<br />
auf dem gleichnamigen Merkblatt<br />
DVWK-M 366 aus dem Jahr 2000.<br />
Dieses wurde grundlegend bearbeitet,<br />
um den technischen Weiterentwicklungen<br />
und den veränderten<br />
rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
Rechnung zu tragen, und wird jetzt<br />
zur Diskussion gestellt.<br />
Frist zur Stellungnahme<br />
Hinweise und Anregungen zu dieser<br />
Thematik nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle<br />
gerne entgegen.<br />
Das Merkblatt DWA-M 366 wird bis<br />
zum 31. Dezember 2011 öffentlich<br />
zur Diskussion gestellt. Stellungnahmen<br />
nach Möglichkeit in digitaler<br />
Form an die DWA-Bundesgeschäftsstelle,<br />
Dipl.-Ing. Reinhard<br />
Reifenstuhl, Theodor-Heuss-Allee<br />
17, D-53773 Hennef, Tel. (02242)<br />
872-106, Fax (02242) 872-200,<br />
E-Mail: reifenstuhl@dwa.de<br />
Information:<br />
Oktober 2011, 54 Seiten,<br />
ISBN 978-3-942964-05-0,<br />
Ladenpreis: 59,00 Euro,<br />
fördernde DWA-Mitglieder: 47,20 Euro.<br />
Merkblatt DWA-M 361: Aufbereitung von Biogas<br />
Aus der Vergärung organischer<br />
Stoffe gewonnenes Biogas wird<br />
beim Ausbau erneuerbarer Energien<br />
auch künftig eine wesentliche<br />
Rolle spielen. Das Biogas, welches<br />
unter anderem auf Kläranlagen,<br />
landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
oder Abfallvergärungsanlagen an -<br />
fällt, kann direkt auf den jeweiligen<br />
Anlagen z. B. zu Heizzwecken oder<br />
zur Stromerzeugung genutzt werden.<br />
Alternativ kann das Biogas nach<br />
entsprechender Aufbereitung als<br />
Biomethan in das Gasnetz eingespeist<br />
werden, sodass es ortsunabhängig<br />
einer weiteren Verwendung<br />
zugeführt werden kann. Die Einspeisung<br />
ins Gasnetz bietet den<br />
Vorteil, dass die energetische Nutzung<br />
an einem Ort erfolgen kann,<br />
an dem sowohl der Strom als auch<br />
die entstehende Wärme mit hoher<br />
Effizienz eingesetzt werden können.<br />
Voraussetzung für diesen Weg ist<br />
jedoch eine besonders hochwertige<br />
Aufbereitung des Biogases. Aber<br />
auch jede andere Nutzung von<br />
Biogas erfordert die Aufbereitung<br />
des Rohgases. In jüngerer Vergangenheit<br />
sind hierzu vielfältige<br />
neue Techniken und Verfahren entwickelt<br />
und auf den Markt gebracht<br />
worden.<br />
Das neue Merkblatt gibt eine<br />
Über<strong>sich</strong>t der für die jeweilige<br />
Aufbereitung des Biogases nötigen<br />
und möglichen Verfahrenstechniken<br />
und deren sinnvoller Kombinationen.<br />
Für die Planung und den wirtschaftlichen<br />
Betrieb von Aufbereitungsanlagen<br />
werden Empfehlungen<br />
und Informationen gegeben,<br />
sowohl hin<strong>sich</strong>tlich einer Einspeisung<br />
ins Gasnetz als auch für anderweitige<br />
Nutzungen von Biogas, z. B.<br />
in Gasmotoren oder Brennstoffzellen.<br />
Information:<br />
Oktober 2011, 37 Seiten,<br />
ISBN 978-3-942964-06-7,<br />
Ladenpreis 45,00 Euro,<br />
fördernde DWA-Mitglieder 36,00 Euro.<br />
Bezug:<br />
DWA Deutsche Vereinigung für<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V.,<br />
Theodor-Heuss-Allee 17,<br />
D-53773 Hennef,<br />
Tel. (02242) 872-333,<br />
Fax (02242) 872-100,<br />
E-Mail: info@dwa.de,<br />
DWA-Shop: www.dwa.de/shop<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1057
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bewertung des Rückhaltevermögens<br />
von tertiären Sandschichten gegenüber<br />
mikrobiologischen Einträgen in<br />
Filterrohrsträngen eines Horizontalfilterbrunnens<br />
Modellversuche mit Säulen aus in-situ-Material<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, WHO-Water-Safety-Plan, Horizontalfilterbrunnen, Rückhaltevermögen,<br />
eliminationseffektivität, mikrobiologische Belastungen, Rohwasser<br />
Christoph Treskatis, Martin Exner, Christoph Koch und Jürgen Gebel<br />
Zur Abschätzung der Eliminationseffektivität der<br />
oberflächennahen tertiären Sandschichten an einem<br />
Brunnenstandort im Lechtal im Sinne des WHO<br />
Water-Safety-Plans wurden Modellversuche mit verschiedenen<br />
Mikroorganismen durchgeführt. Der<br />
Modellaufbau wurde so gewählt, dass die obersten<br />
vier Meter des am Standort anstehenden Sediments<br />
im Maßstab 1:1 in Säulen eingebaut wurden. Um<br />
lokale Inhomogenitäten des Untergrundes nachzubilden,<br />
wurden zwei Säulen aufgebaut, die Material aus<br />
zwei Bohrungen enthielten. Es konnte durch begleitende<br />
Tracerversuche gezeigt werden, dass die im<br />
Modell erreichten vertikalen Durchflussverhältnisse<br />
den natürlichen heterogenen Bedingungen gut entsprechen.<br />
Innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten<br />
wurden beide Säulen zweimal mit Suspensionen<br />
von Escherichia coli, Bacillus subtilis-Sporen und<br />
Coliphagen beschickt. Verwendet wurden pro Organismus<br />
jeweils 500 mL Suspension mit Organismengehalten<br />
von etwa 10 10 /100 mL. Diese Konzentrationen<br />
lagen bewusst über den höchsten in der Natur<br />
bzw. im Einzugsgebiet des Brunnens zu erwartenden<br />
Eintragsmengen. Durch Probenahmen konnte gezeigt<br />
werden, dass die Organismen unterschiedlich tief in<br />
die Säulen eingedrungen waren: E. coli konnte nie<br />
tiefer als 75 cm eindringen, die Coliphagen drangen<br />
nur in Einzelnachweisen bis in 3,25 Meter Tiefe vor<br />
und nur die Sporen von Bacillus subtilis wurden an<br />
beiden Säulen bis in 3,75 Meter Tiefe in Konzentrationen<br />
von bis zu 20 KBE/100 mL nachgewiesen. Bezogen<br />
auf die Ausgangskonzentrationen ergibt <strong>sich</strong> eine<br />
Eliminierungseffektivität von neun bzw. zehn Zehnerpotenzen<br />
für die verwendeten Mikroorganismen<br />
durch die im Modell verbauten Sande. Auf diese<br />
Weise übertrifft die Reduktion die für Bewertungen<br />
von Desinfektionsverfahren angelegten Maßstäbe um<br />
mehrere Zehnerpotenzen. Ange<strong>sich</strong>ts der Tatsachen,<br />
dass die im Modellversuch eingesetzten Konzentrationen<br />
von Mikroorganismen nicht in der Natur vorkommen,<br />
der geplante Brunnen in einem gut geschützten<br />
Gebiet liegt und die Mächtigkeit der Sandschichten<br />
über den Filtersträngen des geplanten Brunnens zehn<br />
Meter statt der vier Meter im Modell betragen wird,<br />
erscheinen die Sandschichten aus mikrobiologischhygienischer<br />
Sicht ausreichend <strong>sich</strong>er: Beim Bau des<br />
Brunnens muss Sorge getragen werden, dass durch<br />
das Bohrverfahren die natürliche dichte Lagerung der<br />
Sandschichten nicht gestört wird.<br />
Evaluation of the Retention-Potential of tertiary Sands Towards Microbiological Contaminations into the Filter<br />
Drains of a Horizontal Filter Well – Model Experiment with Columns Filled with in-situ-Material<br />
For the assessment of the elimination efficiency of the<br />
tertiary sands near to the surface at a well location in<br />
the Lech valley according to the water safety plan<br />
concept of the WHO model experiments have been<br />
made with several microorganisms. In the model<br />
design chosen the upper four meters of the filtering<br />
tertiary sand layers from the well location were emulated<br />
in a 1:1 scale. To incorporate local variations,<br />
two columns were built up, that contained material<br />
from two different boreholes. Through accompanying<br />
tracer tests it could be shown, that the vertical flow<br />
conditions in the model columns meet very good with<br />
the heterogeneous natural conditions. Within a two<br />
months period both columns were charged two times<br />
November 2011<br />
1058 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
with suspensions with Escherichia coli, spores of<br />
Bacillus subtilis and MS2-Coliphages. There were<br />
500 mL suspensions of every organism with concentrations<br />
around 10 10 /100 mL respectively. These concentrations<br />
were intentionally above the highest values<br />
to be expected under natural conditions or in the<br />
catchment of the well, even under worst-case scenarios.<br />
By taking water samples over the hole time it was<br />
to show that the three different organisms entered<br />
different depths of the column: E. coli never came<br />
deeper than 0,75 m, MS2-Coliphages only in particular<br />
cases reached up to 3,25 m and only the spores of<br />
B. subtilis could be detected at the last sampling<br />
point at 3,75 m in concentrations up to 20 CFU/<br />
100 mL. Related to the starting concentrations follows<br />
an elimination-efficiency of nine to ten orders of<br />
magnitude from the built-in sand-layers for the<br />
microorganisms tested. Because of these results the<br />
reduction exceeds the demands for disinfectionmethods<br />
by several orders of magnitude. Seeing the<br />
facts that the concentrations of microorganisms used<br />
in the model exceed natural concentrations by far,<br />
that the well is situated in a well protected piece of<br />
land and that the depth of the sand layers above the<br />
planned well will amount to more than ten meters<br />
instead of the four meters in the model, the conclusion<br />
is, that the tertiary sand layers are sufficiently<br />
save from a microbiological and hygienic point of<br />
view. During the construction of the well great care<br />
has to be taken about not to disturb the naturally<br />
dense bedding of the sand layers.<br />
Die Grundwasserleiter des Lechtales sind ergiebige<br />
<strong>Wasser</strong>vorkommen, die bereits seit langem für die Trinkwasserversorgung<br />
der Stadt Augsburg genutzt werden.<br />
Die Grundwasserleiter gliedern <strong>sich</strong> in zwei hydraulisch<br />
eigenständige Stockwerke, von denen die quartären<br />
Schotter des Lechs und die darunter anstehenden<br />
Sande der Oberen Süßwassermolasse (OSM) das erste<br />
Hauptgrundwasserstockwerk bilden und von regionaler<br />
wasserwirtschaftlicher Bedeutung sind. Der zu diesem<br />
ersten Stockwerk gehörende, oberflächennahe tertiäre<br />
Grundwasserleiter beginnt mit seiner sandigen Fazies<br />
ab etwa 7 bis 8 m unter Gelände und reicht in den Fassungsanlagen<br />
der Stadtwerke Augsburg GmbH südlich<br />
der Stadt bis etwa 25 m unter Gelände. Darunter beginnt<br />
der regionale Stauer mit einem Tonhorizont, der das<br />
zweite Hauptgrundwasserstockwerk vom oberflächennahen<br />
Aquifersystem abtrennt.<br />
Die Quartärfassungen (flache Vertikalfilterbrunnen)<br />
sind nach stärkeren Niederschlägen vereinzelt von bakteriologischen<br />
Einträgen betroffen. Dabei handelt es <strong>sich</strong><br />
aber meist um sehr wenige coliforme Keime (i. d. R.<br />
1 Keim/100 mL), die in den sehr gut wasserdurchlässigen<br />
Schottern nicht oder nur ungenügend retardiert werden.<br />
Die mikrobiologischen Befunde treten unregelmäßig auf<br />
und können aufgrund der großen Abstandsgeschwindigkeiten<br />
im quartären Grundwasserleiter und der sehr<br />
gut wasserdurchlässigen Deckschichten rasch in die<br />
flachgründigen, rund 8 m tiefen Fassungen gelangen.<br />
Eine geologische Barriere gegenüber diesen Einträgen ist<br />
für den quartären Grundwasserleiter nicht vorhanden.<br />
Ein Ausweichen in den tertiären Grundwasserleiter<br />
unterhalb des Stockwerkstrenners innerhalb der OSM<br />
ist aus hydrochemischen Gründen nicht möglich, da die<br />
Stadtwerke Augsburg <strong>Wasser</strong> GmbH das gewonnene<br />
Grundwasser ohne weitere Aufbereitung in das Versorgungsgebiet<br />
abgeben können. Im tieferen Tertiär werden<br />
eisen- und manganhaltige, reduzierte Wässer an -<br />
getroffen und die betriebenen Tiefbrunnen zeigen<br />
starke Alterungserscheinungen, so dass diese Gewinnungsoption<br />
derzeit nicht zur Diskussion steht.<br />
Daher betreiben die Stadtwerke ein neues Gewinnungskonzept,<br />
das vermehrt die Nutzung des sandig<br />
ausgebildeten, oberflächennahen Grundwasserleiters<br />
unter dem hochpermeablen quartären Lechkies<br />
anstrebt. Die Sandschicht der OSM soll dabei die Rolle<br />
einer natürlichen Langsamsandfiltration übernehmen<br />
und als Barriere gegenüber dem periodisch belasteten<br />
Quartärwasser fungieren. Die für diesen Fassungshorizont<br />
konzipierten Horizontalfilterbrunnen (HFB)<br />
sollen innerhalb der oberflächennahen Tertiärschichten<br />
ver filtert werden (Bild 1).<br />
Dabei sollten im Rahmen von Modellversuchen mit<br />
in-situ-Material folgende Fragestellungen untersucht<br />
werden:<br />
HFB-<br />
Zentralschacht<br />
H(Sand) = ca. 13,5 bis<br />
14,5 m Retentionspassage<br />
H gesamt inkl. Q = ca.<br />
20 bis 21 m<br />
Grundwasseroberfläche ca. 3,3 m u.<br />
Glände e<br />
Oberkante OSM ca. 6,5 m u. Gelände<br />
Strangniveau ca. 20 bis 21 m u. Gelände<br />
Oberkante Ton ca. 24 bis 26 m u. Gelände<br />
Bild 1. Konzeptionelle Darstellung des HFB-Ausbaus in den<br />
oberflächennahen Tertiärschichten im Lechtal.<br />
© für alle Abbildungen: Autorengruppe<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1059
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 2.<br />
Materialgewinnung<br />
aus<br />
der Aufweitungsbohrung.<br />
In der Überbohrkrone<br />
ist<br />
die Gesteinsausbildung<br />
im<br />
Grenzbereich<br />
Quartär/OSM<br />
gut erkennbar.<br />
Teufe [m] u. GOK<br />
SW Augsburg <strong>Wasser</strong> GmbH<br />
1,0 10,0 100,0 K-Wert [m/s] 10E-05 1000,0<br />
5,0 bis 5,5<br />
5,5 bis 6,0<br />
6,0 bis 6,4<br />
6,4 bis 6,5<br />
6,5 bis 7,0<br />
7,0 bis 7,5<br />
7,5 bis 8,0<br />
8,0 bis 8,5<br />
8,5 bis 9,0<br />
9,0 bis 9,5<br />
9,5 bis 10,0<br />
Bild 3.<br />
Vertikale<br />
Abfolge der<br />
Durchlässigkeiten<br />
nach<br />
Siebanalysen<br />
der Schichten<br />
aus der Kernbohrung<br />
am<br />
Zentralschacht<br />
des geplanten<br />
HFB.<br />
Bild 4.<br />
Versuchssäulen<br />
mit Probennahmehähnen<br />
und<br />
Ablaufschläuchen<br />
bei der Inbetriebnahme.<br />
<br />
K-Werte Säule 1 2 Periode gleit. Durchschn. (K-Werte Säule 1)<br />
""<br />
Bestimmung der granulometrischen Zusammensetzung<br />
des oberflächennahen Tertiärs im Bereich der<br />
geplanten Strangtrassen ab dem Übergang Quartär/<br />
OSM.<br />
""<br />
Analyse der Mächtigkeiten und Durchlässigkeiten<br />
der geologischen Schichten.<br />
""<br />
Ermittlung der Relation der horizontalen zur<br />
vertikalen Durchlässigkeit des Schichtenpaketes am<br />
Übergang Q/T (k fh /k fv ) über Tracerversuche.<br />
""<br />
Fließweg-Fleißzeit-Abschätzung im in-situ-Material.<br />
""<br />
Analyse der möglichen natürlichen Kurzschlussmöglichkeiten<br />
zwischen dem Quartär und Tertiär<br />
durch präferentielle Fließwege.<br />
""<br />
Nachbildung der örtlichen geologischen<br />
Barriere bedingungen in einem maßstäblichen<br />
Modellversuch mit in-situ-Material.<br />
""<br />
Dotierungsversuche mit Impfung der Säulen mit<br />
Indikatorkeimen unter definierten Eintragsrandbedingungen.<br />
""<br />
Ermittlung der Abbauraten für die eingesetzten<br />
Indikatorkeime.<br />
""<br />
Ermittlung der Einflussfaktoren für die Rückhaltung<br />
bzw. Elimination der Keime.<br />
Die Sandschichten des oberflächennah anstehenden<br />
Tertiärs sollen bei diesem Brunnenkonzept die periodischen<br />
Keimbelastungen <strong>sich</strong>er unterbinden, um weiterhin<br />
ein Trinkwasser ohne vorherige Aufbereitung<br />
abgeben zu können.<br />
1. Vorbereitung der Säulenversuche<br />
1.1 Materialgewinnung und Materialeigenschaften<br />
Für die Bestimmung der Eliminationsraten, der vertikalen<br />
Fließwege bzw. -geschwindigkeiten und der Stabilität<br />
der Sandüberdeckung über den geplanten<br />
horizontalen Fassungssträngen des neues Brunnenkonzeptes<br />
wurden Säulenversuche im Maßstab 1:1<br />
durchgeführt. Für die Materialgewinnung wurden zwei<br />
Inliner-Kernbohrungen am Standort des Zentralschachtes<br />
des geplanten HFB bis rund 10 m unter Gelände<br />
abgeteuft. Die Materialgewinnung für den Bereich des<br />
Übergangs vom Quartär zum Tertiär erfolgte einerseits<br />
aus ungestörten Bohrproben (für Siebanalysen) und<br />
andererseits aus den gestörten Bohrproben der Aufweitungsbohrungen<br />
(Bild 2). Die Sedimentproben aus<br />
den In linerkernen wurden alle 50 cm einer Siebanalyse<br />
unterzogen. Diese Siebanalysen dienten der Ermittlung<br />
der Kornverteilung und der Durchlässigkeit des Sedimentes.<br />
Hinzu kam eine Bestimmung des Kennkorndurchmessers<br />
d k und Schüttkorndurchmessers nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 113. Für die Säulen selber wurden<br />
die Schichten von 6,0 bis 10,0 m maßstäblich eingebaut.<br />
Die obere Schicht aus den quartären Schottern<br />
schließt die tertiäre Folge in der Säule ab und wurde<br />
aus Platzgründen mit reduzierter Mächtigkeit eingebaut.<br />
November 2011<br />
1060 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
In der Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Siebanalysenauswertung<br />
zusammengefasst. Blau gefärbt sind die<br />
Zeilen und Spalten mit den Ergebnissen der quartären<br />
Schichten, gelb ist die Übergangsschicht Quartär/OSM<br />
und orange gefärbt sind die Ergebnisse der Schichten<br />
der oberflächennahen OSM-Sande. Die Untergrunddurchlässigkeit<br />
des Schichtenprofils von Gelände bis<br />
10 m Teufe nimmt vom Hangenden zum Liegenden um<br />
etwa zwei Zehnerpotenzen ab (Bild 3). In den quartären<br />
Schichten werden Durchlässigkeiten der Schichten aus<br />
den Siebanalysen von bis zu 5,5 ∙ 10 –3 m/s be<strong>rechnet</strong>. In<br />
den tertiären Sanden werden im Minimum 3,2 ∙ 10 –5 m/s<br />
be<strong>rechnet</strong>. Der größte Durchlässigkeitskontrast ist<br />
erwartungsgemäß an der Faziesgrenze Quartär/OSM<br />
ausgebildet. Er beträgt Faktor 2,1. Innerhalb der tertiären<br />
Schichten schwanken die Durchlässigkeiten aus<br />
den Siebanalysen zwischen 3,2 ∙ 10 –5 m/s bei 7,0 bis<br />
7,5 m und 3,6 ∙ 10 –4 m/s bei 8,0 bis 8,5 m unter Gelände.<br />
Im Rahmen von hydrogeologischen Voruntersuchungen<br />
wurden für die oberflächennahen Tertiärschichten<br />
folgende Randbedingungen definiert:<br />
""<br />
Die tertiären Sande des 1. Hauptgrundwasserleiters<br />
können lokal vertont oder zum Liegenden hin mit<br />
hohen Schluffanteilen durchsetzt sein.<br />
""<br />
Die prognostizierten resultierenden Durchlässigkeiten<br />
für den Zustrom zum Brunnen HFB 121 aus<br />
dem ungespannten Quartär und den gespannten<br />
ter tiären Sanden liegen bei 0,8 bis 0,9 ∙ 10 –5 m/s<br />
(k fv,h ).<br />
""<br />
Die vertikalen Durchlässigkeiten innerhalb der<br />
Sandschichten liegen bei 2,5 bis 6,0 ∙ 10 –6 m/s (k fv ).<br />
Der Durchlässigkeitskontrast zwischen der vertikalen<br />
und horizontalen Durchlässigkeit beträgt 0,5; die vertikale<br />
Durchlässigkeit ist halb so hoch wie die resultierende<br />
Durchlässigkeit aus vertikaler und horizontaler<br />
Zustromkomponente zum Brunnenstrang.<br />
Tabelle 1. Ergebnisse der Siebanalysenauswertung der Inlinerkerne aus der<br />
Bohrung am Standort des Zentralschachtes für den geplanten HFB 121.<br />
Teufe<br />
[m. u. GOK]<br />
Bodenart<br />
nach DIN<br />
4022<br />
kf-Wert<br />
nach Beyer<br />
[m/s] ∙ 10 –5<br />
dk<br />
[mm]<br />
U / Fg<br />
Schüttkorn nach<br />
DVGW W 113<br />
(Schüttung)<br />
5,0 bis 5,5 G, s, u‘ 550 n.b. 15,6 / 10 n.b.<br />
5,5 bis 6,0 G, s‘, u 47 n.b. 66,6 / 10 n.b.<br />
6,0 bis 6,4 G, s, u 19 n.b. 2–3,15 n.b.<br />
6,4 bis 6,5 S, g, u‘ 9,0 n.b. 4,2 / 9,2 n.b.<br />
6,5 bis 7,0 S, u‘ 9,8 0,29 2,6 / 7,6 2,2 (2–3,15 mm)<br />
7,0 bis 7,5 S, u‘ 3,2 0,34 1,9 / 6,9 2,3 (2–3,15 mm)<br />
7,5 bis 8,0 S, u‘ 10 0,23 2,4 / 7,4 1,7 (1–2 mm)<br />
8,0 bis 8,5 S, u‘ 36 0,23 3,9 / 8,9 2,0 (1–2 mm)<br />
8,5 bis 9,0 S, u‘ 7,1 0,19 2,5 / 7,5 1,4 (1–2 mm]<br />
9,0 bis 9,5 S, u‘ 7,4 0,18 2,2 / 7,2 1,3 (1–2 mm)<br />
9,5 bis 10,0 S, u‘ 4,0 0,16 2,1 / 7,1 1,1 (1–2 mm)<br />
± 0,00<br />
- 0,10<br />
- 0,15<br />
1/1<br />
- 0,35<br />
Säule 1 / V1<br />
Glaskugeln Ø 1,55 - 1,85 mm<br />
fG - gG, gs, ms'-fs', x', u'<br />
(Übergang Q/T: 6,0 - 6,5 m)<br />
± 0,00<br />
- 0,10<br />
1/2<br />
- 0,30<br />
Säule 2 / V2<br />
mG - gG, x, fs'<br />
(5,5 - 6,0 m aus B1)<br />
Bild 5.<br />
Verlängerung<br />
des Probenahmehahns<br />
(unterste<br />
Entnahmetiefe<br />
über der Glaskugelschicht<br />
über dem<br />
Auslauf) mit<br />
Mikrovliesummantelung.<br />
1.2 Konzeption und Aufbau des Säulenmodells<br />
Zur Überprüfung des Rückhaltevermögens der sandigen<br />
Tertiärschichten wurden vom Institut für Hygiene und<br />
Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn zwei<br />
Modellsäulen zur Aufnahme des in-situ-Materials aus<br />
den Bohrungen am geplanten Standort des HFB hergestellt.<br />
Als Grundmaterial für die Modellsäulen wurden für<br />
Trinkwasser zugelassene PP-Rohre Nennweite 200 mm<br />
verwendet, aus denen mit Flanschen versehene Stücke<br />
à 1 Meter Länge erstellt wurden (Bild 4). Jedes dieser<br />
Stücke erhielt zwei Probenahmeöffnungen, die jeweils<br />
25 cm von den Enden entfernt waren. Die Bodenstücke<br />
der beiden Modellsäulen wurden auf eine Platte aus gleichem<br />
Material montiert, die einen Bodenablass erhielt.<br />
Die 4 m hohen Säulen werden von einem Untergestell<br />
getragen. In die Probenahmeöffnungen wurden für<br />
Trinkwasser zugelassene Zapfhähne eingesetzt. Je Säule<br />
wurden acht Zapfhähne eingebaut. Um bei der Probe-<br />
2/1<br />
- 0,83<br />
3/1<br />
- 1,35<br />
4/1<br />
- 1,82<br />
5/1<br />
- 2,35<br />
6/1<br />
- 2,82<br />
7/1<br />
- 3,35<br />
8/1<br />
- 3,85<br />
- 4,00<br />
mS, gs', fs', fg' - gg'<br />
(6,5 - 7,0 m)<br />
gS, ms, fs', fg'<br />
(7,0 - 7,5 m)<br />
mS - gS, fs', u'<br />
(7,5 - 8,0 m)<br />
mS, fs, u'<br />
(8,0 - 8,5 m)<br />
fS - mS, u'<br />
(8,5 - 9,0 m)<br />
mS, fs, u'<br />
(9,0 - 9,5 m)<br />
fS, U-Bänder<br />
(9,5 - 10,0 m)<br />
Glaskugeln<br />
Ø 1,55 - 1,85 mm<br />
2/2<br />
- 0,80<br />
3/2<br />
- 1,30<br />
4/2<br />
- 1,80<br />
5/2<br />
- 2,30<br />
6/2<br />
- 2,80<br />
- 3,20<br />
7/2<br />
8/2<br />
- 3,80<br />
- 4,00<br />
fG - gG, ms, fs, u', x'<br />
(Übergang Q/T: 6,2 - 6,7 m aus B2)<br />
mS - gS, fs', u'<br />
(6,7 - 7,2 m)<br />
mS, fs, gs', u'<br />
(7,2 - 7,7 m)<br />
fS - mS, u'<br />
(7,7 - 8,7 m)<br />
(reduzierte Mächtigkeit eingebaut)<br />
mS, fs, u'<br />
(8,7 - 9,2 m)<br />
fS, u'<br />
(9,2 - 9,7 m)<br />
fS, ms', u'<br />
(9,7 - 10,2 m)<br />
Glaskugeln<br />
1,55 - 1,85 mm<br />
Bild 6.<br />
Aufbau und<br />
Schichtenfolge<br />
in den Säulen<br />
mit dem<br />
Grundwasserleitermaterial<br />
am Standort<br />
des HFB.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1061
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Leitfähigkeit [Tsd. µS/cm]<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
nahme Artefakte durch eventuell innen an der Säulenwand<br />
entlang sickerndes <strong>Wasser</strong> zu vermeiden, wurden<br />
die Zapfhähne in das Innere der Säule hinein durch<br />
Edelstahl-Rohre verlängert, die am Ende verschlossen<br />
und im zentralen Bereich der Säule perforiert waren. Die<br />
Perforation wurde durch ein Siebgewebe mit 10 µm<br />
Maschenweite abgedeckt, um Auswaschung von<br />
Bodenpartikeln in die Probenahmeflaschen zu vermeiden<br />
(s. Bild 5).<br />
4. und 5. Tracerversuch 28.04. bis 20.05.2011 in den Modellsäulen<br />
(Ausgangssalzkonzentration 5.500 bzw. 4.900 µS/cm)<br />
Säule 1 Säule 2<br />
0,0<br />
27.04.11 02.05.11 07.05.11 12.05.11 17.05.11 22.05.11<br />
Bild 7. Durchbruchskurven der Salzlösung im Verlauf<br />
des 4. und 5. Tracerversuches charakterisieren die<br />
unterschied lichen Transportmechanismen in den Säulen.<br />
Tabelle 2. Vertikale Fließgeschwindigkeiten in den Säulen.<br />
Versuchsnummer Säule 1<br />
Fließgeschwindigkeiten<br />
Tracer 1<br />
Tracer 2<br />
Tracer 3<br />
Tracer 4<br />
Tracer 5<br />
0,0093 m/h<br />
2,2 m/d<br />
0,082 m/h<br />
1,97 m/d<br />
0,011 m/h<br />
0,26 m/d<br />
0,045 m/h<br />
1,07 m/d<br />
0,049 m/h<br />
1,17 m/d<br />
Säule 2<br />
Fließgeschwindigkeiten<br />
0,14 m/h<br />
3,36 m/d<br />
0,057 m/h<br />
1,37 m/d<br />
0,008 m/h<br />
0,20 m/d<br />
0,136 m/h<br />
3,30 m/d<br />
0,154 m/h<br />
3,70 m/d<br />
Säule 2<br />
Tabelle 3. Vertikale Durchlässigkeiten der Gesamtsäule in Funktion<br />
des Versuchszeitpunktes.<br />
Versuchsnummer Säule 1<br />
k f -Wert [m/s] ∙ 10 –5 k f -Wert [m/s] ∙ 10 –5<br />
Tracer 1 2,58 3,96<br />
Tracer 2 2,26 1,58<br />
Tracer 3 0,31 0,23<br />
Tracer 4 1,25 3,78<br />
Tracer 5 1,36 4,28<br />
Die Gesamthöhe des Aufbaus beträgt etwa<br />
4,50 Meter, wobei die Höhe des Untergestells rund<br />
0,50 Meter ausmacht. Dabei wurde der Bodenablass<br />
mit einer Siebplatte und einem 10 µm-Netzgewebe<br />
abgedeckt. Darüber wurden über einer Schicht Glaskugeln<br />
(∅ 1,55 bis 1,85 mm) die frisch am geplanten<br />
Standort des HFB erbohrten Sedimente in die Säulen<br />
eingebracht. Die schichtgerecht befüllten Säulen<br />
(Bild 6) wurden anschließend drucklos im freien Auslauf<br />
mit <strong>Wasser</strong> aus der Förderung des <strong>Wasser</strong>werks so<br />
beaufschlagt, dass ständig ein Überstand über der<br />
obersten Sedimentschicht erhalten blieb, während die<br />
Bodenabläufe der Säulen ständig vollständig geöffnet<br />
waren.<br />
2. Tracerversuche<br />
Im Verlauf der Versuchsreihen wurden insgesamt fünf<br />
Tracerversuche durchgeführt. Dazu wurde eine hoch<br />
mit Salz aufkonzentrierte Lösung (Leitfähigkeit etwa<br />
5000 µS/cm) auf die Säule beaufschlagt und zur Versickerung<br />
gebracht. Am zentralen Auslauf der beiden<br />
Säulen im Boden der PE-Säulen wurde eine kontinuierliche<br />
Leitfähigkeitsmessung installiert. Damit konnten<br />
die Salzdurchbrüche in den Säulen im Halbstundentakt<br />
oder Stundentakt durchgehend gemessen werden. Eine<br />
Messung an den einzelnen Schichtausläufen wurde<br />
nicht durchgeführt, da die <strong>Wasser</strong>mengen zu Beginn<br />
und im Verlauf der Versuche sehr gering waren und vollständig<br />
für die mikrobiologischen Beprobungen zur<br />
Verfügung stehen sollten.<br />
Bild 7 zeigt beispielhaft die Tracerdurchgangskurven<br />
für den 4. und 5. Tracerversuch. Bei den Tracerversuchen<br />
wurden Salzlösungen mit im Mittel rund<br />
5000 µS/cm Ausgangskonzentration eingegeben. Die<br />
Eingabe erfolgte simultan in den beiden Säulen durch<br />
Zugabe der Lösung in den Freibordbereich der Säule 1<br />
über der Glaskugelschicht bzw. über der Schotterschicht<br />
in der Säule 2 (s. Bild 6). Die vertikale Fließstrecke<br />
des <strong>Wasser</strong>s betrug etwa 3,85 m. Tabelle 2 fasst<br />
die vertikalen Fließgeschwindigkeiten, Tabelle 3 die<br />
vertikalen Durchlässigkeiten der Säulenschichtenfolge<br />
zusammen.<br />
Vergleicht man die Abstandgeschwindigkeiten der<br />
letzten beiden Versuche in den Säulen, dann ergeben<br />
<strong>sich</strong> durchschnittliche Werte von 1,12 m/d für Säule 1<br />
und 3,50 m/d für Säule 2. Der Geschwindigkeitskontrast<br />
zwischen der Säule 2 und 1 beträgt somit 1,8 für alle<br />
Versuche und 3,1 für die Versuche 4 und 5. Im Vergleich<br />
dazu betrug die horizontale Fließgeschwindigkeit aus<br />
den Pumptests in einem bereits realisierten HFB rund<br />
1,1 bis 1,6 m/d. Aus Tabelle 3 ergibt <strong>sich</strong> ein durchschnittlicher<br />
Durchlässigkeitsbeiwert für die vertikale<br />
Durchströmung der 3,85 m langen Sandsäule von<br />
1,55 ∙ 10 –5 m/s für die Säule 1 und von 2,78 ∙ 10 –5 m/s für<br />
die Säule 2. Aufgrund der vereinfachten Gradientenannahme<br />
ergeben <strong>sich</strong> im Vergleich die gleichen Faktoren<br />
November 2011<br />
1062 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
zwischen den Säulen wie bei der Abstandsgeschwindigkeit.<br />
Im Rahmen der Erkundungen wurde für den<br />
Brunnenstandort eine vertikale Durchlässigkeit von<br />
0,375 ∙ 10 –5 m/s bestimmt. Bezogen auf die Säule 1 liegt<br />
deren vertikale Durchlässigkeit um den Faktor 4,1 höher,<br />
bezogen auf die Säule 2 um den Faktor 7,4 höher als der<br />
Wert aus den in-situ-Pumptests.<br />
Anhand der ersten drei Versuche wird angenommen,<br />
dass es zu einer Kompaktion und Setzung des Säuleninhaltes<br />
im Versuchsablauf bei Durchströmung der Säule<br />
gekommen ist; in den Versuchen 4 und 5 wurde die<br />
Säule nach Einstau bzw. Leerlaufen wieder in Betrieb<br />
genommen, daher entspricht das Ergebnis dieser Versuche<br />
den Anfangsrandbedingungen. Mittlerer k f -Wert<br />
(vertikal) beträgt im Mittel der Versuchszeit für beide<br />
Säulen ca. 2 ∙ 10 –5 m/s. Die Relation k v /k fh,v beträgt in<br />
den Säulen rund 0,03; die Schichten in den Säulen sind<br />
somit in der resultierenden Durchlässigkeit um ca. eine<br />
Zehnerpotenz geringer durchlässig als bei den in-situ-<br />
Pumptests. Die horizontale Durchlässigkeit ist unter<br />
Annahme der Versuchsrandbedingungen etwa 30-mal<br />
höher als die vertikale Durchlässigkeit. Nach dem dritten<br />
Tracerversuch erreicht der Durch lässigkeitsbeiwert<br />
der Säulen den Prognosewert für den vertikalen Durchlässigkeitsbeiwert<br />
aus der Erkundung.<br />
3. Verwendete Testorganismen<br />
3.1 Escherichia coli<br />
Escherichia coli ist ein bewegliches, gram-negatives,<br />
stäbchenförmiges Bakterium, das keine Sporen bildet<br />
und peritrich begeißelt ist. Seine Größe beträgt rund<br />
1,3 · 4 µm. Es ist fakultativ anaerob, d. h., es ist in der<br />
Lage, Energie sowohl durch die Atmungskette als auch<br />
durch „Gemischte Säuregärung“ zu gewinnen.<br />
Escherichia coli kommt in hohen Konzentrationen in<br />
der Intestinalflora bei Mensch und Tier vor und löst dort<br />
in der Regel keine Erkrankung aus. In anderen Teilen des<br />
Körpers kann E. coli jedoch ernsthafte Erkrankungen wie<br />
Harnwegsinfektionen, Bakteriämien und Meningitis<br />
auslösen. Eine begrenzte Anzahl enteropathogener<br />
Stämme von E. coli kann eine akute Diarrhö auslösen.<br />
Unterschiedliche enteropathogene E. coli konnten auf<br />
der Basis unterschiedlicher Virulenzfaktoren einschließlich<br />
enterohämorrhagischen E. coli (EHEC), enterotoxigenen<br />
E. coli (ETEC), enteropathogene E. coli (EPEC),<br />
enteroinvasiven E. coli (EIEC), enteroaggregativen E. coli<br />
(EAEC) und diffus adhärente E. coli (DAEC) [1] unterschieden<br />
werden.<br />
E. coli gilt seit über 100 Jahren als der klassische Indikator<br />
für fäkale Verunreinigungen im <strong>Wasser</strong>. Aufgrund<br />
seines natürlichen Habitats ist er wenig resistent gegen<br />
Umwelteinflüsse und Chemikalien. Zum Überleben in<br />
Sedimenten und vor allem zur Vermehrung ist E. coli auf<br />
eine gute Versorgung mit Nährstoffen angewiesen [2].<br />
Der Nachweis von Escherichia coli erfolgte im Labor<br />
Dr. Schell, Augsburg, mit dem Colilert®-2000-System.<br />
Zu Beginn der zweiten Beprobungsserie wurde eine<br />
Parallel-Probe im Institut für Hygiene und Öffentliche<br />
Gesundheit in Bonn mittels Merck CC-Agar ® untersucht.<br />
3.2 MS2-Coliphagen<br />
(Bakterio)-Phagen sind Viren, die Bakterien befallen.<br />
Unter Coliphagen versteht man Phagen, die auf Bakterien<br />
der Art E. coli spezialisiert sind. Die als MS2-Coliphagen<br />
bezeichneten Phagen gehören taxonomisch zur<br />
Gattung Levivirus. Es handelt <strong>sich</strong> dabei um ikosaedrische,<br />
rund 30 Nanometer große RNA-Phagen, die in der<br />
Lage sind, bestimmte Wirtsstämme mit so genanntem<br />
F-Pile zu infizieren und in geschlossenen Bakterienrasen<br />
unter entsprechenden Kulturbedingungen <strong>sich</strong>tbare<br />
Plaques (klare Zonen) zu produzieren.<br />
Coliphagen gelten in Rohwasser als Indikatoren für<br />
Viren aus fäkalen Kontaminationen und als Anzeiger für<br />
unzureichende Filterkapazitäten gegenüber viralen<br />
Krankheitserregern. Sie sind nicht humanpathogen,<br />
wodurch sie <strong>sich</strong> als Modellorganismen für den Transport<br />
von Viren, aber auch von anderen kolloidalen Kontaminationen<br />
(Bales, Gerba et al. 1989) besonders anbieten.<br />
Der Nachweis der MS2-Coliphagen erfolgte im Institut<br />
für Hygiene und Öffentliche Gesundheit nach den<br />
Vorgaben der DIN EN 10705-2 von 2001.<br />
3.3 Bacillus subtilis–Sporen<br />
Das Bacillus subtilis, auch Heubazillus genannt, ist ein<br />
fakultativ anaerobes, peritrich begeißeltes Bodenbakterium.<br />
Die Größe der stäbchenförmigen Bakterien<br />
beträgt va. 0,6 · 2 µm.<br />
Obwohl ubiquitär verbreitet, ist er am häufigsten zu<br />
isolieren aus den oberen Schichten des Bodens. Dort ist<br />
er aufgrund häufig wechselnder Umgebungsbedingungen<br />
fast ständig Stress- und Hungersituationen ausgesetzt,<br />
die er durch die Bildung von Endosporen überdauern<br />
kann. Aufgrund der hohen Hitzeresistenz der<br />
Sporen werden diese auch als Indikator bei entsprechenden<br />
Sterilisationsprozessen in Pharmazie, Medizin<br />
und Lebensmittelindustrie eingesetzt. B. subtilis ist im<br />
Gegensatz zu anderen Bacillaceae (z. B. B. anthracis oder<br />
B. cereus) nicht humanpathogen, was ihn zu einem<br />
idealen Testkeim für Laborarbeiten macht.<br />
4. Versuchsablauf<br />
Um den Systemen etwas Zeit zu geben, <strong>sich</strong> einzuregeln,<br />
wurden beide Säulen rund drei Wochen lang mit<br />
<strong>Wasser</strong> aus dem <strong>Wasser</strong>werk durchspült. Zu Beginn der<br />
eigentlichen Dotierungsversuche wurden jeweils<br />
500 mL von Suspensionen der drei Testorganismen als<br />
Stoßbelastung auf jede Säule gegeben. Die Konzentrationen<br />
der eingesetzten Organismen betrugen jeweils<br />
etwa 10 10 Organismen/100 mL.<br />
Jeweils ab zwei Tage nach Dotierung wurden nacheinander<br />
an allen Entnahmehähnen beider Säulen alle<br />
24 Stunden Proben entnommen. Der ursprüngliche<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1063
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils im zeitlichen Verlauf<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils imzeitlichen Verlauf<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils imzeitlichen Verlauf<br />
Hahn 1/1<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/1<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/1<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/1<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/1<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/1<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/1<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/1<br />
3,75 m<br />
Hahn 1/2<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/2<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/2<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/2<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/2<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/2<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/2<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/2<br />
3,75 m<br />
Hahn 1/1<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/1<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/1<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/1<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/1<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/1<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/1<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/1<br />
3,75 m<br />
Modellsäule 1<br />
MS2-Phagen, Eingesetzte Konzentration 5,2 x10 9 /10mL<br />
07.02.2011<br />
08.02.2011<br />
09.02.2011<br />
10.02.2011<br />
11.02.2011<br />
12.02.2011<br />
13.02.2011<br />
14.02.2011<br />
15.02.2011<br />
16.02.2011<br />
09.03.2011<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000<br />
PFU /10 mL<br />
Bild 8. Ergebnisse MS2-Phagen, Erste Probenserie, Säule 1.<br />
Modellsäule 2<br />
MS2-Phagen, Eingesetzte Konzentration 5,2 x10 9 /10mL<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000.000<br />
PFU /10mL<br />
Modellsäule 1<br />
B.-subtilis-Sporen, Eingesetzte Konzentration 1,2 x10 10 /100 mL<br />
07.02.2011<br />
08.02.2011<br />
09.02.2011<br />
10.02.2011<br />
11.02.2011<br />
12.02.2011<br />
13.02.2011<br />
14.02.2011<br />
15.02.2011<br />
16.02.2011<br />
09.03.2011<br />
Bild 9. Ergebnisse MS2-Phagen, Erste Probenserie, Säule 2.<br />
07.02.2011<br />
08.02.2011<br />
09.02.2011<br />
10.02.2011<br />
11.02.2011<br />
12.02.2011<br />
13.02.2011<br />
14.02.2011<br />
15.02.2011<br />
16.02.2011<br />
09.03.2011<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000<br />
KBE /100 mL<br />
Bild 10. Ergebnisse Bacillus subtilis, Erste Probenserie,<br />
Säule 1.<br />
Plan, Tagessammelproben zu untersuchen, scheiterte<br />
daran, dass wegen des geringen Durchflusses nicht an<br />
allen Zapfhähnen gleichzeitig <strong>Wasser</strong> entnommen werden<br />
konnte. Die Proben für Bacillus subtilis- und Coliphagen-Untersuchungen<br />
wurden nach Probenahme<br />
gekühlt per Über-Nach-Express an das Institut für Hygiene<br />
und Öffentliche Gesundheit, Bonn, die Proben zur<br />
Untersuchung auf Escherichia coli an das Labor Dr.<br />
Scheller, Augsburg, übersandt.<br />
Nach der ersten Dotierung wurden zehn Tage lang<br />
Proben entnommen, danach wurden die Systeme vier<br />
Wochen lang weiter kontinuierlich mit Trinkwasser<br />
durchspült, bevor eine weitere Probe entnommen<br />
wurde. Nach der folgenden zweiten Dotierung wurden<br />
22 Tage lang Proben entnommen, wobei die oberen<br />
Probenhähne gegen Ende der Serie nicht mehr beprobt<br />
wurden. Zwischen und nach den beiden mikrobiologischen<br />
Versuchen (Serie 1 und Serie 2) wurden weitere<br />
Tracerversuche (Versuche 3 bis 5) durchgeführt, um<br />
Setzungs- oder Kolmationseffekte der Sedimente und<br />
damit verbundene Veränderungen der vertikalen Fließgeschwindigkeit<br />
in den Säulen zu erkennen.<br />
5. Erster Dotierungsversuch<br />
Im ersten mikrobiologischen Versuch wurden die Organismen<br />
wie oben beschrieben am 05.02.2011 zugesetzt<br />
und nach etwa 48 Stunden Wartezeit arbeitstäglich Proben<br />
an jeweils allen Entnahmehähnen entnommen. Die<br />
Ergebnisse der Untersuchungen auf MS2-Coliphagen<br />
und Bacillus subtilis sind in den Bildern 8 bis 11 dargestellt.<br />
Die Bilder zeigen von oben nach unten die jeweils<br />
acht Entnahmehähne und an diesen jeweils von oben<br />
nach unten die Ergebnisse im zeitlichen Verlauf (KBE =<br />
Kolonie-bildende Einheiten ≈ vermehrungsfähige Bakterien;<br />
PFU = Plaque-forming Units ≈ infektiöse Viruspartikel).<br />
Escherichia coli konnte in beiden Säulen nur vier Tage<br />
lang an dem jeweils obersten Probenahmehahn nachgewiesen<br />
werden, danach nicht mehr. An den tiefer<br />
gelegenen Probenahmehähnen konnte E. coli nie nachgewiesen<br />
werden.<br />
Über die gesamte Versuchszeit konnten am oberen<br />
Ende der Säulen MS2-Coliphagen und B. subtilis-Sporen<br />
nachgewiesen werden, wenn auch mit fallender Tendenz.<br />
Dabei ist festzuhalten, dass die Abnahme der Phagen<br />
sehr viel deutlicher (in der Säule 2 um mehr als<br />
5 Logarithmen-Stufen) war als die der Sporen. In beiden<br />
Säulen gelangten die Sporen innerhalb von vier bzw.<br />
sieben Tagen bis an den fünften Probenahmehahn, also<br />
bis in rund 225 cm Tiefe. Die MS2-Phagen konnten dagegen<br />
– von einem Einzelnachweis am Hahn 5/1 abgesehen<br />
– über die Dauer des ersten Versuchs nicht weiter als<br />
125 cm in die Säulen vordringen. Es ist nicht auszuschließen,<br />
dass es <strong>sich</strong> bei dem Einzelnachweis um eine Kontamination<br />
bei den Probenahmen handelte.<br />
November 2011<br />
1064 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Bei beiden Organismen kam es über die jeweils<br />
zurückgelegte Strecke zu einer Reduktion zwischen<br />
etwa fünf (B. subtilis) und rund 6,5 (MS2-Phagen) Logarithmen-Stufen<br />
(99,999 %).<br />
Nach dieser Beprobungsserie wurden die Säulen<br />
weiter mit <strong>Wasser</strong> durchströmt, aber erst nach drei<br />
Wochen wieder beprobt. Es zeigte <strong>sich</strong>, dass Bacillus<br />
subtilis-Sporen in sehr niedriger Konzentration<br />
(1/100 mL) mittlerweile am unteren Ende der Säule 2<br />
angekommen waren; Phagen waren in beiden Säulen<br />
auch nach diesem Zeitraum am untersten Entnahmehahn<br />
nicht nachweisbar.<br />
6. Zweiter Dotierungsversuch<br />
Sechs Wochen nach der ersten Zudosierung wurden<br />
am 12.03.2011 in gleicher Weise nochmals alle drei Mikroorganismen<br />
zu den Säulen zugegeben und die Säulen<br />
in gleicher Weise beprobt. Die Probenserie wurde<br />
diesmal allerdings auf einen Gesamtzeitraum von dreieinhalb<br />
Wochen ausgedehnt, wobei zum Ende hin nur<br />
noch die unteren Entnahmehähne untersucht wurden.<br />
Da die Säulen zwischen den beiden Versuchen nicht<br />
desinfiziert wurden, ergibt <strong>sich</strong> insgesamt eine Beobachtungsdauer<br />
von zwei Monaten für die Barrierewirkung<br />
der Sedimente gegenüber einer stoßweisen Kontamination.<br />
Auch in der zweiten Serie zeigte <strong>sich</strong>, dass der zugesetzte<br />
E. coli <strong>sich</strong> in dem nährstoffarmen <strong>Wasser</strong> nicht<br />
halten konnte und bereits zwei Tage nach Zudosierung<br />
nicht mehr nachzuweisen war. Sicherheitshalber erfolgten<br />
eine zweite Zudosierung von E. coli am 22.03.2011<br />
und eine Kontrolle des obersten Entnahmehahnes<br />
zusätzlich zum Colilert-Verfahren mit Nachweis über<br />
CC-Agar. Dabei wurden am obersten Entnahmehahn<br />
jeweils Konzentrationen von 1,7 bzw. 2,3 · 10 6 KBE /<br />
100 mL E. coli nachgewiesen. An den folgenden Entnahmehähnen<br />
konnte E. coli nie nachgewiesen werden. Die<br />
Ergebnisse der zweiten Versuchsserie für die MS2-Coliphagen<br />
und B. subtilis sind in den Bilder 12 bis 15 dargestellt.<br />
Auch in der zweiten Untersuchungsserie gelangen in<br />
der Säule 1 die MS2-Phagen nicht über die Hälfte der<br />
Filterstrecke hinaus, sondern werden diesmal maximal<br />
bis in 0,75 Meter Tiefe nachgewiesen. In der Säule 2<br />
kommt es sporadisch bis an den vorletzten Hahn zu<br />
Nachweisen von einzelnen MS2-Phagen in 10 mL Untersuchungsvolumen.<br />
Hohe Nachweise von Phagen sind<br />
aber auch hier nur bis in 0,75 Meter Tiefe möglich. Dagegen<br />
können die B. subtilis-Sporen von Beginn der Probenserie<br />
an in beiden Säulen auch an den untersten<br />
Hähnen in Konzentrationen bis maximal 20 KBE /<br />
100 mL nachgewiesen werden. Die gemessenen Konzentrationen<br />
nehmen von oben nach unten bis etwa<br />
zum Hahn Nr. 5 kontinuierlich ab und schwanken an<br />
den Hähnen 6 bis 8 über die Zeit gleichmäßig zwischen<br />
1 und 10 KBE/100 mL.<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils imzeitlichen Verlauf<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils im zeitlichen Verlauf<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils imzeitlichen Verlauf<br />
Hahn 1/2<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/2<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/2<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/2<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/2<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/2<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/2<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/2<br />
3,75 m<br />
Hahn 1/1<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/1<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/1<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/1<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/1<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/1<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/1<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/1<br />
3,75 m<br />
Hahn 1/2<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/2<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/2<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/2<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/2<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/2<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/2<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/2<br />
3,75 m<br />
Modellsäule 2<br />
B.-subtilis-Sporen, Eingesetzte Konzentration 1,2 x10 10 /100 mL<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000<br />
KBE /100 mL<br />
Bild 11. Ergebnisse Bacillus subtilis, Erste Probenserie,<br />
Säule 2.<br />
Modellsäule 1<br />
MS2-Phagen, Eingesetzte Konzentration 1,7 x10 9 /10mL<br />
14.03.2011<br />
15.03.2011<br />
17.03.2011<br />
18.03.2011<br />
19.03.2011<br />
20.03.2011<br />
21.03.2011<br />
22.03.2011<br />
23.03.2011<br />
24.03.2011<br />
26.03.2011<br />
27.03.2011<br />
28.03.2011<br />
29.03.2011<br />
30.03.2011<br />
31.03.2011<br />
01.04.2011<br />
03.04.2011<br />
04.04.2011<br />
05.04.2011<br />
06.04.2011<br />
07.04.2011<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000<br />
PFU /10 mL<br />
Bild 12. Ergebnisse MS2-Phagen, Zweite Probenserie,<br />
Säule 1.<br />
Modellsäule 2<br />
MS2-Phagen, Eingesetzte Konzentration 1,7 x10 9 /10mL<br />
07.02.2011<br />
08.02.2011<br />
09.02.2011<br />
10.02.2011<br />
11.02.2011<br />
12.02.2011<br />
13.02.2011<br />
14.02.2011<br />
15.02.2011<br />
16.02.2011<br />
09.03.2011<br />
14.03.2011<br />
15.03.2011<br />
17.03.2011<br />
18.03.2011<br />
19.03.2011<br />
20.03.2011<br />
21.03.2011<br />
22.03.2011<br />
23.03.2011<br />
24.03.2011<br />
26.03.2011<br />
27.03.2011<br />
28.03.2011<br />
29.03.2011<br />
30.03.2011<br />
31.03.2011<br />
01.04.2011<br />
03.04.2011<br />
04.04.2011<br />
05.04.2011<br />
06.04.2011<br />
07.04.2011<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000<br />
PFU /10 mL<br />
Bild 13. Ergebnisse MS2-Phagen, Zweite Probenserie,<br />
Säule 2.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1065
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils im zeitlichen Verlauf<br />
Entnahmehahn und -tiefe,<br />
Ergebnisse jeweils im zeitlichen Verlauf<br />
Hahn 1/1<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/1<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/1<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/1<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/1<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/1<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/1<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/1<br />
3,75 m<br />
Hahn 1/2<br />
0,25 m<br />
Hahn 2/2<br />
0,75 m<br />
Hahn 3/2<br />
1,25 m<br />
Hahn 4/2<br />
1,75 m<br />
Hahn 5/2<br />
2,25 m<br />
Hahn 6/2<br />
2,75 m<br />
Hahn 7/2<br />
3,25 m<br />
Hahn 8/2<br />
3,75 m<br />
Modellsäule 1<br />
B.-subtilis-Sporen, Eingesetzte Konzentration 1,9 x10 10 / 100 mL<br />
14.03.2011<br />
15.03.2011<br />
17.03.2011<br />
18.03.2011<br />
19.03.2011<br />
20.03.2011<br />
21.03.2011<br />
22.03.2011<br />
23.03.2011<br />
24.03.2011<br />
26.03.2011<br />
27.03.2011<br />
28.03.2011<br />
29.03.2011<br />
30.03.2011<br />
31.03.2011<br />
01.04.2011<br />
03.04.2011<br />
04.04.2011<br />
05.04.2011<br />
06.04.2011<br />
07.04.2011<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000.0001.000.000.000<br />
KBE /100 mL<br />
Bild 14. Ergebnisse Bacillus subtilis, Zweite Probenserie,<br />
Säule 1.<br />
Modellsäule 2<br />
B.-subtilis-Sporen, Eingesetzte Konzentration 1,9 x10 10 / 100 mL<br />
14.03.2011<br />
15.03.2011<br />
17.03.2011<br />
18.03.2011<br />
19.03.2011<br />
20.03.2011<br />
21.03.2011<br />
22.03.2011<br />
23.03.2011<br />
24.03.2011<br />
26.03.2011<br />
27.03.2011<br />
28.03.2011<br />
29.03.2011<br />
30.03.2011<br />
31.03.2011<br />
01.04.2011<br />
03.04.2011<br />
04.04.2011<br />
05.04.2011<br />
06.04.2011<br />
07.04.2011<br />
0 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000.000<br />
KBE /100 mL<br />
Bild 15. Ergebnisse Bacillus subtilis, Zweite Probenserie,<br />
Säule 2<br />
Die Konzentrationen der eingesetzten Organismen<br />
werden über den Gesamt-Zeitraum betrachtet also um<br />
mehr als zehn (E. coli), zehn (MS2-Phagen) bzw. neun<br />
(B. subtilis) Zehnerpotenzen reduziert.<br />
Art des Einbaus der Materialien begründet liegen. Das<br />
Modell wurde mit Materialien gefüllt, die direkt am<br />
geplanten Standort des HFB erbohrt frisch eingebaut<br />
wurden, und mit <strong>Wasser</strong> betrieben, das in seiner chemischen<br />
Zusammensetzung ebenfalls weitgehend dem an<br />
diesem Standort entspricht.<br />
Das Modell weist also sowohl hin<strong>sich</strong>tlich seiner hydraulischen<br />
Eigenschaften wie auch der chemischen<br />
Zusammensetzung größtmögliche Übereinstimmung<br />
mit den heterogenen natürlichen Verhältnissen auf.<br />
Gerade chemische Verhältnisse in den Sedimenten können<br />
auf den Rückhalt von Mikroorganismen einen entscheidenden<br />
Einfluss haben, weshalb der Auswahl der<br />
verwendeten Sedimente eine große Bedeutung<br />
zukommt [3, 4].<br />
7.2 Vergleich der eingesetzten Konzentrationen<br />
von Mikroorganismen mit Vorkommen in der<br />
Umwelt<br />
In den Modellversuchen wurden bewusst Konzentrationen<br />
von Mikroorganismen eingesetzt, die deutlich<br />
über denen liegen, die im Normalbetrieb oder bei Schadensszenarien<br />
im Einzugsgebiet zu erwarten wären.<br />
Beispielsweise liegt die im Sickerwasser aus Mistmieten<br />
zu erwartende Konzentration von E. coli mit 8 · 10 7 KBE/<br />
100 mL [5] 1000-fach unter der hier eingesetzten Konzentration.<br />
Die Konzentrationen in unbehandeltem<br />
<strong>Abwasser</strong> bewegen <strong>sich</strong> in der gleichen Größenordnung<br />
[6]. Die in Oberflächenwasser zu erwartenden<br />
Konzentrationen liegen drei bis vier Zehnerpotenzen<br />
niedriger, in schlecht geschützten Grundwässern<br />
wurden bis 10 3 KBE/100 mL gemessen [1]. In gut<br />
geschützten Grundwässern ist E. coli normalerweise<br />
nicht nachweisbar.<br />
Durch die stark überhöhten Zudosiermengen sollte<br />
es ermöglicht werden, das Rückhaltevermögen bzw. die<br />
Eliminierungseffektivität der Bodenpassage quantitativ<br />
mikrobiologisch belegen zu können, wie es von der<br />
WHO und der novellierten Trinkwasserverordnung<br />
gefordert und in der in Kürze erscheinenden Begründung<br />
zur Novellierung der Trinkwasserverordnung<br />
präzisiert werden wird.<br />
7. Bewertung<br />
7. 1 Qualität des Modells im Vergleich zur<br />
natürlichen Schichtung<br />
Die Tracerversuche zu Beginn und nach der ersten Versuchsserie<br />
zeigen, dass mit dem Modell nach einer Einlaufzeit<br />
ein System aufgebaut werden konnte, das vergleichbare<br />
Durchlässigkeitsbeiwerte aufweist, wie sie<br />
bei der Erkundung im Gelände ermittelt wurden. Es<br />
kann also davon ausgegangen werden, dass die hydraulischen<br />
Verhältnisse für den vertikalen Fluss in den Säulen<br />
denen in den natürlichen Sandschichten entsprechen.<br />
Gleichwohl sind zwischen den Säulen Unterschiede<br />
erkennbar, die offenbar in der unterschiedlichen<br />
7.3 Kontaminationsrisiken im Umfeld des<br />
geplanten Brunnenstandortes<br />
Der Standort des neu geplanten HFB liegt innerhalb des<br />
<strong>Wasser</strong>schutzgebietes im Augsburger Stadtwald. Das<br />
Gebiet wird als Naherholungsgebiet von Fußgängern,<br />
Radfahrern etc. genutzt. Landwirtschaftliche Nutzung<br />
findet im Einzugsgebiet des Brunnens nicht statt, das<br />
Befahren der Wege ist nicht gestattet und die Zufahrten<br />
mit Schranken abgesperrt. Jagdliche Nutzung findet<br />
ebenfalls nicht statt. In Hochwasserszenarien ist eine<br />
Beeinflussung des Grundwassers durch den benachbarten<br />
Reichskanal und kleinere Oberflächengewässer<br />
nicht auszuschließen.<br />
November 2011<br />
1066 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Aufgrund der Lage des Brunnens in einem geschützten<br />
Gebiet bestehen allenfalls geringe Risiken eines<br />
erhöhten Eintrags von (fäkalen) Mikroorganismen von<br />
der Oberfläche in die Sandschichten am Brunnenstandort<br />
des geplanten HFB.<br />
8. Bewertung der Eliminierungsleistung<br />
der Sandschichten<br />
Der Rückhalt von Mikroorganismen in wasser-gesättigten<br />
Sandschichten kann auf verschiedenen Mechanismen<br />
beruhen [7, 8, 4, 9, 10]:<br />
""<br />
mechanischer Rückhalt<br />
""<br />
Adsorption an Bodenpartikel<br />
""<br />
Absterben der Mikroorganismen<br />
""<br />
„Grazing“ (Gefressen-werden) durch Protozoen<br />
Der letzte Punkt ist vor allem in Langsamsandfiltern mit<br />
vergleichsweise hoher Strömungsgeschwindigkeit von<br />
Bedeutung [11] und kann im vorliegenden Fall vernachlässigt<br />
werden. Das mechanische Zurückhalten von Mikroorganismen<br />
bestimmt <strong>sich</strong> einerseits durch die Porengröße<br />
der Sedimentschichten und andererseits durch<br />
die Eigenbeweglichkeit der Organismen. Dabei wirkt<br />
der Sedimentkörper als Tiefenfilter. Die physika lische<br />
(reversible) Adsorption von Mikroorganismen, v. a. Viren,<br />
an Bodenpartikel ist abhängig vom pH-Wert und der<br />
Ionendichte des <strong>Wasser</strong>s sowie der Ladungsverteilung<br />
auf der Oberfläche der Organismen [8, 12].<br />
Durch das Wechselspiel dieser verschiedenen Faktoren<br />
ist es zu erklären, dass im vorliegenden Fall die deutlich<br />
kleineren Coliphagen sehr viel besser zurück gehalten<br />
werden als die hydrophoben Sporen von B. subtilis:<br />
Aufgrund der unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften<br />
der Oberflächen adsorbieren erstere stärker an<br />
Sedimentpartikel als letztere. Diese Resultate werden<br />
z. B. auch durch die Untersuchungen von [13] zur „Colloid<br />
Filtration Theory“ bestätigt. Ebenso ist der nahezu<br />
vollständige Rückhalt und das Verschwinden von E. coli<br />
nicht allein durch das mechanische Entfernen der Bakterien<br />
aus der <strong>Wasser</strong>phase zu erklären [14], sondern auch<br />
durch die niedrigen Nährstoffkonzentrationen im versuchstechnisch<br />
verwendeten <strong>Wasser</strong>, an die Fäkalkeime<br />
wie E. coli nicht angepasst sind.<br />
Die am Standort des geplanten HFB angetroffenen<br />
und im Modell verbauten Sedimentschichten waren<br />
geeignet, im Modell die beaufschlagten Mikroorganismenkonzentrationen<br />
über die gesamte Filtrationsstrecke<br />
und den beobachteten Zeitraum von zwei Monaten<br />
um neun bis zehn Zehnerpotenzen zu reduzieren. Bei<br />
der Bewertung ist zu berück<strong>sich</strong>tigen, dass im Modell<br />
die Filtrationsstrecke vier Meter betrug, wogegen der<br />
geplante Brunnen eine Filtrationsstrecke von mehr als<br />
zehn Metern über den Filtersträngen des Brunnens aufweisen<br />
wird.<br />
Die im Modell angetroffenen Eliminierungseffektivitäten<br />
übertreffen die Anforderungen an Trinkwasseraufbereitungen<br />
mit Ultrafiltrationsmembranen um drei bis<br />
vier Logarithmen-Stufen. Darüber hinaus ergibt <strong>sich</strong> aus<br />
der Lage des Brunnenstandortes und der Auswertung<br />
der Literatur [5], dass die am Brunnenstandort an der<br />
Geländeoberfläche zu erwartenden Konzentrationen<br />
von Mikroorganismen um mehrere Zehnerpotenzen<br />
niedriger sind als die hier im Modell eingesetzten.<br />
Die Ergebnisse aus den Säulenmodellen deuten also<br />
insgesamt darauf hin, dass die am Standort des geplanten<br />
HFB angetroffenen Sandschichten eine genügende<br />
Sicherheit bieten, den Grundwasserleiter vor den hier<br />
sporadisch zu erwartenden mikrobiologischen Kontaminationen<br />
zu schützen.<br />
Danksagung<br />
Die Autoren danken der Stadtwerke Augsburg <strong>Wasser</strong> GmbH,<br />
Dr. Franz Otillinger, Robert Hörmann und Thomas Pechmann für die<br />
Projektfinanzierung und die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
bei den Säulenversuchen im <strong>Wasser</strong>werk Lochbach.<br />
Literatur<br />
[1] WHO, Ed.: WHO Guidelines for drinking-water quality –<br />
Second Addendum to third edition. Geneva, World Health<br />
Organisation, 2008.<br />
[2] Davies, C. M. and Long, J. A. et al.: Survival of fecal microorganisms<br />
in marine and freshwater sediments. Appl Environ<br />
Microbiol 61 (1995) No. 5, p. 1888–96.<br />
[3] Walker, S. G. and Flemming, C.A. et al.: Physicochemical interaction<br />
of Escherichia coli cell envelopes and Bacillus subtilis<br />
cell walls with two clays and ability of the composite to<br />
immobilize heavy metals from solution. Applied and Environmental<br />
Microbiology 55 (1989) No. 11, p. 2976–84.<br />
[4] Naclerio, G. and Fardella, G. et al.: Filtration of Bacillus subtilis<br />
and Bacillus cereus spores in a pyroclastic topsoil, carbonate<br />
Apennines, southern Italy. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces<br />
70 (2009) No. 1, p. 25–8.<br />
[5] Treskatis, C. und Exner, M. et al.: Konzept einer Hydrogeologisch<br />
mikrobiologischen Risikoanalyse von Trinkwassereinzugsgebieten.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 149 (2008) Nr. 9,<br />
S. 667–676.<br />
[6] Kistemann, T. and Rind, E. et al.: A comparison of efficiencies<br />
of microbiological pollution removal in six sewage treatment<br />
plants with different treatment systems. Int J Hyg<br />
Environ Health (2008).<br />
[7] Hijnen, W. A. and Brouwer-Hanzens, A.J. et al.: Transport of<br />
MS2 phage, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Cryptosporidium<br />
parvum, and Giardia intestinalis in a gravel and<br />
a sandy soil. Environmental science & technology 39 (2005)<br />
No. 20, p. 7860–8.<br />
[8] Chetochine, A. S. and Brusseau, M.L. et al.: Leaching of phage<br />
from Class B biosolids and potential transport through soil.<br />
Applied and Environmental Microbiology 72 (2006) No. 1,<br />
p. 665–71.<br />
[9] Naclerio, G. and Nerone, V. et al.: Role of organic matter and<br />
clay fraction on migration of Escherichia coli cells through<br />
pyroclastic soils, southern Italy. Colloids and surfaces. B,<br />
Biointerfaces 72 (2009) No. 1, p. 57–61.<br />
[10] Janjaroen, D. and Liu, Y. et al.: Role of divalent cations on<br />
deposition of Cryptosporidium parvum oocysts on natural<br />
organic matter surfaces. Environmental science & technology<br />
44 (2010) No. 12, p. 4519–24.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1067
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
[11] Waldhoff, A., Ed.: Hygienisierung von Mischwasser in Retentionsbodenfiltern<br />
(RBF). <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> Umwelt. Kassel,<br />
Kassel University Press, 2008.<br />
[12] Xiao, L. and Qu, X. et al.: Biosorption of nonpolar hydrophobic<br />
organic compounds to Escherichia coli facilitated by<br />
metal and proton surface binding. Environmental science &<br />
technology 41 (2007) No. 8, p. 2750–5.<br />
[13] Gupta, V. and Johnson, W.P. et al.: Riverbank filtration: comparison<br />
of pilot scale transport with theory. Environmental<br />
science & technology 43 (2009) No. 3, p. 669–76.<br />
[14] Bales, R. C. and Gerba, C.P. et al.: Bacteriophage Transport in<br />
Sandy Soil and Fractured Tuff.” Applied and Environmental<br />
Microbiology 55 (1989) No. 8, p. 2061–2067.<br />
Autoren<br />
Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis<br />
E-Mail: c.treskatis@bup-gup.de |<br />
Bieske und Partner Beratende Ingenieure GmbH |<br />
Im Pesch 79 |<br />
D-53797 Lohmar<br />
Prof. Dr. med. Martin Exner<br />
E-Mail: Martin.Exner@ukb.uni-bonn.de |<br />
Dr. rer. nat. Christoph Koch<br />
E-Mail: Christoph.Koch@ukb.uni-bonn.de |<br />
Dr. rer. nat. Jürgen Gebel<br />
E-Mail: Juergen.Gebel@ukb.uni-bonn.de |<br />
Eingereicht: 07.08.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit |<br />
Sigmund-Freud-Straße 25 |<br />
D-53105 Bonn<br />
<strong>gwf</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
INTERNATIONAL<br />
The leading specialist journal<br />
for water and wastewater<br />
S1 / 2011<br />
Volume 152<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Innovation from tomorrow’s world<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
The leading Knowledge Platform in<br />
Water and Wastewater Business<br />
MIS Universell.<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
9/2011<br />
Jahrgang 152<br />
ISSN 0016-3651<br />
B 5399<br />
Established in 1858, »<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>« is regarded<br />
as the leading publication for water and wastewater<br />
technology and science – including water production,<br />
water supply, pollution control, water purification and<br />
sewage engineering.<br />
It‘s more than just content: The journal is a publication<br />
of several federations and trade associations. It comprises<br />
scientific papers and contributions re viewed by experts, offers<br />
industrial news and reports, covers practical infor mation, and<br />
publishes subject laws and rules.<br />
In other words: »<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong>« opens a direct way to<br />
your target audience.<br />
Boost your Advertising! Now!<br />
Das Schnellmontagesystem mit eingebauter Injektionsmembran.<br />
MIS ist die innovative Hauseinführung, mit der Sie Bohrungen schnell gas- und wasserdicht machen:<br />
• Expansionsharz-Schnellabdichtsystem für Gas- und <strong>Wasser</strong>hauseinführungen.<br />
• Integrierter Außenflansch. Keine Nachbearbeitung der Außenabdichtung.<br />
• Gleichmäßige Harzverteilung in alle Hohlstellen/Ausbrüche – für alle Mauerwerke geeignet.<br />
• Besonders <strong>sich</strong>er in der Anwendung – ein Arbeitsgang, eine Kartuschenfüllung.<br />
Damit Wände dichter bleiben. Und Gebäude länger leben.<br />
Informieren Sie <strong>sich</strong> jetzt: Telefon: 0 73 24 96 00-0 · Internet: www.hauff-technik.de<br />
Mit dem Kopf durch die Wand.<br />
Knowledge for the Future<br />
Oldenbou<br />
Rosenheimer Straße 145<br />
D-81671 München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Media consultant:<br />
Inge Matos Feliz<br />
matos.feliz@oiv.de<br />
Phone: +49 (0)89/45051-228<br />
Fax: +49 (0)89/45051-207<br />
<strong>gwf</strong> international.indd 1 06.10.11 11:34<br />
November 2011<br />
1068 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
3R + <strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
im Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
3R International erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine 3R (12 Ausgaben) und<br />
<strong>gwf</strong> <strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> (12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
□ Als Heft für 528,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 528,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ Als Heft für 264,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 264,- pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert <strong>sich</strong> der Bezug um<br />
ein Jahr. Die <strong>sich</strong>ere und pünktliche Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,–<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice 3R<br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Datum, Unterschrift<br />
PAGWFW0211<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice 3R, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Entfernung von Arsen, Nickel und Uran<br />
bei der <strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, <strong>Wasser</strong>aufbereitung, Trinkwassergrenzwerte, Arsenentfernung,<br />
Nickelentfernung, Uranentfernung, Festbettadsorption<br />
Martin Jekel, Carsten Bahr, Volker Schlitt und Dieter Stetter<br />
In Rohwässern der Trinkwasserversorgung können<br />
gelegentlich erhöhte Konzentrationen von Arsen,<br />
Nickel und Uran auftreten, wodurch die Grenzwerte<br />
überschritten werden (As 10 µg/L, Ni 20 µg/L,<br />
U 10 µg/L, neue Trinkwasserverordnung 2011). Die<br />
Ursache des Auftretens ist meist geochemischer<br />
Natur. Für jeden Stoff existieren Verfahren zur<br />
Entfernung oder wurden dafür entwickelt. Neben<br />
konventionellen Techniken mit einem variablen<br />
Entfernungseffekt sind für die Nachrüstung vor allem<br />
Festbett-Sorp tionsverfahren mit sehr hohen spezifischen<br />
Durchsätzen in Bettvolumen bis zum Durchbruch<br />
empfehlenswert. Für Arsen sind poröse Eisenhydroxidgranulate,<br />
für Nickel chelatbildende Ionentauscher<br />
und für Uran basische Ionenaustauscher<br />
erfolgreich im Einsatz. Bei Nickel- und Uranentfernungsanlagen<br />
kann durch eine chemische Regeneration<br />
das Sorptionsmaterial wieder verwendet<br />
werden. Beladene Eisenhydroxide werden bei der<br />
Arsen entfernung sach gerecht abgelagert.<br />
Removal of Arsenic, Nickel and Uranium<br />
in Water Treatment<br />
Raw waters of drinking water supplies may contain<br />
elevated concentrations of arsenic, nickel and uranium,<br />
exceeding the limit values (As 10 µg/L;<br />
Ni 20 µg/L; U 10 µg/L, in the new German Drinking<br />
Water Directive of 2011). The presence of these metals<br />
is mostly due to natural, geochemical occurrence.<br />
There are existing processes or newly developed ones<br />
for each of the metals. Besides conventional treatment<br />
processes with a variable removal effect, fixedbed<br />
adsorbers are suitable for new process units,<br />
allowing very high specific throughputs (in bed volumes)<br />
until the breakthrough. Porous granular ferrichydroxides<br />
are effective for arsenic, while chelating<br />
ion exchangers are suitable for nickel. Uranium is<br />
removed by anionic exchangers. By a chemical regeneration<br />
of ion exchangers for Ni and U, they can be<br />
reused. Exhausted ferrichydroxides are disposed<br />
safely.<br />
1. Einleitung<br />
Arsen, Nickel und Uran erreichen gelegentlich im<br />
Rohwasser, das zur Trinkwassergewinnung genutzt<br />
wird, Konzentrationen, die eine Entfernung dieser Stoffe<br />
erforderlich machen. In den seltensten Fällen handelt es<br />
<strong>sich</strong> direkt um anthropogene Einträge; meist stammen<br />
diese Stoffe aus natürlichen Quellen. Allerdings können<br />
menschliche Aktivitäten die Mobilisierung der Stoffe<br />
verursacht haben.<br />
In diesem Beitrag werden die wesentlichen Regeln<br />
beschrieben, die bei der Beurteilung von notwendigen<br />
aufbereitungstechnischen Maßnahmen zur Verminderung<br />
der Spurenstoffkonzentration und bei der Auswahl<br />
geeigneter Aufbereitungsverfahren zu beachten<br />
sind. Vorausgesetzt wird, dass Maßnahmen geprüft und<br />
ggf. ergriffen wurden, um die Einträge dieser Spurenstoffe<br />
in das <strong>Wasser</strong> zu verhindern bzw. zu minimieren<br />
und diese Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben.<br />
Dieser Beitrag ist inhaltlich angelehnt an ein DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 249, das in Vorbereitung ist und 2011 als<br />
Gelbdruck erscheinen wird.<br />
2. Prinzipien der Aufbereitung<br />
Im Trinkwasser dürfen chemische Stoffe nicht in Konzentrationen<br />
enthalten sein, die eine Schädigung der<br />
menschlichen Gesundheit besorgen lassen. Für Arsen<br />
und Nickel gibt die Trinkwasserverordnung Grenzwerte<br />
vor, die beim Verbraucher einzuhalten sind. Bei einer<br />
Entscheidung über Maßnahmen zur Konzentrationsverminderung<br />
und deren Ausmaß muss berück<strong>sich</strong>tigt<br />
werden, dass es insbesondere bei Nickel durch Wechselwirkungen<br />
mit Werkstoffen im Verteilsystem und in<br />
Installationen wieder zu Konzentrationszunahmen<br />
kommen kann. Aufgrund seiner Nierentoxizität wird<br />
von Toxikologen für Uran ein gesundheitlicher Leitwert<br />
von 10 µg/L vorgeschlagen, der auch als Grenzwert in<br />
die neue Trinkwasserverordnung übernommen wird [1].<br />
Das Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung sollte so<br />
gewählt werden, dass unter Berück<strong>sich</strong>tigung der<br />
Rohwasserbeschaffenheit nicht nur eine gezielte und<br />
selektive Entfernung des Schadstoffes erreicht wird,<br />
sondern dass auch bei der anschließenden Trinkwasserverteilung<br />
keine nachteiligen Effekte auftreten (z. B.<br />
November 2011<br />
1070 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Korrosion, mikrobiologische Probleme, Bildung von<br />
Nebenprodukten). Es sind dabei die Vorgaben der<br />
TrinkwV 2011 und die jeweiligen DVGW-Arbeitsblätter<br />
zu beachten.<br />
Ferner sollten sehr aufwändige und komplexe Aufbereitungsverfahren<br />
möglichst vermieden werden,<br />
wenn sie eine hohe Störanfälligkeit aufweisen und/oder<br />
eine sehr intensive Überwachung benötigen. Es sollten,<br />
wenn möglich immer, eigen<strong>sich</strong>ere Verfahren mit hoher<br />
Prozess<strong>sich</strong>erheit und Betriebsstabilität und mit geringem<br />
Betreuungs- und Überwachungsaufwand bevorzugt<br />
werden. Die Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung<br />
sollten soweit möglich kontinuierlich betrieben werden.<br />
Bei der Wahl des Aufbereitungsverfahren sind das<br />
Minimierungsgebot nach § 6 (3) der TrinkwV 2011 und<br />
die Liste der Aufbereitungsstoffe nach § 11 der TrinkwV<br />
2011, die vom Umweltbundesamt veröffentlicht wird,<br />
zu berück<strong>sich</strong>tigen.<br />
Bei der Aufbereitung fallen feste und/oder flüssige<br />
Rückstände an, die umweltverträglich und entsprechend<br />
den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden<br />
müssen.<br />
3. Maßnahmen zur Reduzierung<br />
der Belastung<br />
Bei erhöhten Konzentrationen in Rohwässern, die zur<br />
Trinkwasserversorgung genutzt werden, ist der<br />
Ursprung (geogen, anthropogen) der Belastung zu<br />
klären. Besteht der Verdacht auf anthropogene Kontaminationen<br />
ist das BBodSchutzG zu berück<strong>sich</strong>tigen.<br />
Sofern die Belastung zunächst in einem Mischwasser<br />
nachgewiesen wurde, ist zu ermitteln, welche Rohwasservorkommen<br />
bzw. Brunnenwässer von den erhöhten<br />
Spurenmetallgehalten betroffen sind. Normalerweise<br />
sind die Konzentrationen in einem Grundwasser zeitlich<br />
vergleichsweise konstant, können jedoch örtlich stark<br />
variieren. Bei der Variation von Brunnenschaltungen<br />
können <strong>sich</strong> deshalb auch unterschiedliche Rohwasserzusammensetzungen<br />
ergeben.<br />
Die betroffenen Wässer sollen über einen ausreichend<br />
langen Zeitraum unter allen zu erwartenden<br />
Betriebsbedingungen mehrmalig untersucht werden,<br />
um die Gesamtbelastung abschätzen zu können. Insbesondere<br />
für eine ggf. erforderliche Aufbereitung ist es<br />
wichtig, dass für die Spurenstoffe die chemischen<br />
Spezies bekannt sind oder be<strong>rechnet</strong> werden. Die <strong>Wasser</strong>parameter,<br />
die für eine Aufbereitung bedeutsam<br />
sind, und die zugehörigen Schwankungsbereiche<br />
müssen bekannt sein. Um eine Veränderung im Chemismus<br />
der Wässer zu erkennen, sollten die chemisch-physikalischen<br />
<strong>Wasser</strong>parameter der letzten 5 bis 10 Jahre<br />
ausgewertet werden.<br />
Bevor die Errichtung bzw. Erweiterung einer Aufbereitungsanlage<br />
zur Entfernung der Spurenstoffe<br />
betrachtet wird, sollte zunächst geprüft werden, ob zur<br />
Vermeidung einer Grenzwertüberschreitung hin<strong>sich</strong>tlich<br />
der Spurenstoffgehalte im abgegebenen Trinkwasser<br />
eine der folgenden Maßnahmen zielführend ist,<br />
wobei auch wirtschaftliche Ge<strong>sich</strong>tspunkte zu berück<strong>sich</strong>tigen<br />
sind.<br />
Durch Ausweitung des <strong>Wasser</strong>rechts für ein unbelastetes<br />
<strong>Wasser</strong>vorkommen oder Bezug von unbelastetem<br />
Fremdwasser ist ggf. eine ausreichende Konzentrationsverminderung<br />
im abgegebenen Trinkwasser möglich.<br />
Im Vorfeld der <strong>Wasser</strong>gewinnung kann die Errichtung<br />
und der Betrieb von Abwehrbrunnen zum Schutz<br />
der Versorgung genutzt werden. Daher müssen die<br />
hydrogeologischen Gegebenheiten ermittelt und ggf.<br />
ein Grundwassermodell erstellt werden.<br />
Bei anthropogenen Beeinflussungen sind durch die<br />
zuständigen Behörden Maßnahmen zu veranlassen.<br />
Sofern keine dieser Alternativen zu realisieren ist, sind<br />
zur Reduzierung der Belastung aufbereitungstechnische<br />
Maßnahmen zu prüfen.<br />
4. Arsen<br />
Arsen ist ein toxisches Element, das ubiquitär im Untergrund<br />
verteilt ist und in vielen Trinkwasserressourcen<br />
der Erde auftritt. Die dauernde und hohe Aufnahme von<br />
Arsen über das Trinkwasser und die Nahrung verursacht<br />
eine chronisch toxische Wirkung beim Menschen,<br />
welche <strong>sich</strong> z. B. durch Hautschädigungen oder Krebserkrankungen<br />
zeigt [2].<br />
4.1 Vorkommen und Eigenschaften<br />
Arsen ist ein relativ häufiges Begleitelement in der<br />
Erdkruste und findet <strong>sich</strong> insbesondere in sulfidischen<br />
Erzen. Durch Verwitterungsvorgänge kann es <strong>sich</strong> in<br />
Böden und Sedimenten anreichern. Obwohl der<br />
geogene Ursprung des Arsens dominiert, können auch<br />
anthropogene Emissionen zu lokal erheblichen Kontaminationen<br />
führen. Beispiele hierfür sind arsenhaltige<br />
Abraumhalden von Hüttenbetrieben oder industrielle<br />
Altlasten und unge<strong>sich</strong>erte Hausmülldeponien. Die<br />
Mobilisierung des Arsens aus dem Boden in das Grundwasser<br />
wird maßgeblich durch das Redoxpotential und<br />
den pH-Wert im Untergrund beeinflusst. Unter oxidierenden<br />
und leicht reduzierenden Bedingungen ist es<br />
mäßig mobil, im stark reduzierenden Milieu hingegen<br />
als Sulfid festgelegt. In Deutschland kommen Grundwässer<br />
mit geringen geogen bedingten Arsengehalten<br />
unter 10 µg/L relativ häufig vor. Regional begrenzt<br />
finden <strong>sich</strong> aber insbesondere in Kluftgrundwasserleitern<br />
des Buntsandsteins und des Sandsteinkeupers<br />
auch höhere Konzentrationen, die meist zwischen<br />
10 µg/L und 250 µg/L liegen [3].<br />
Arsen liegt im Grundwasser in den Oxidationsstufen<br />
+III (Arsenit) und +V (Arsenat) vor. Im trinkwasserrelevanten<br />
pH-Bereich von 6,0 bis 9,5 dominieren unter<br />
oxidierenden Bedingungen die fünfwertigen Formen<br />
H 2 AsO 4<br />
– und HAsO 4<br />
2– , während unter reduzierenden<br />
Bedingungen die dreiwertige, ungeladene arsenige<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1071
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 1.<br />
Stabilitätsfelder<br />
für<br />
Arsenverbindungen<br />
in wässriger<br />
Lösung<br />
(25 °C, 1 atm,<br />
10 –5,3 mol/L As,<br />
10 –3 mol S) [3].<br />
Säure H 3 AsO 3 vorherrscht (Bild 1). Beide Arsenformen<br />
können jedoch auch gleichzeitig auftreten.<br />
4.2 Voruntersuchungen zur Verfahrenswahl<br />
Aufgrund seiner Ladungsneutralität ist das dreiwertige<br />
Arsen schlechter entfernbar als das fünfwertige Arsen,<br />
weshalb in der Regel eine Oxidation zum fünfwertigen<br />
Arsen zu empfehlen ist. Diese kann auf biologischem<br />
Wege mit Sauerstoff in Festbettfiltern oder durch den<br />
Einsatz von chemischen Oxidationsmitteln erreicht werden.<br />
Wirksame und zugelassene Oxidationsmittel sind<br />
Ozon, Kaliumpermanganat und <strong>Wasser</strong>stoffperoxid in<br />
Kombination mit Eisen(II)salzen (als Fenton΄s Reagenz).<br />
Der Einsatz von Chlorgas, Chlordioxid und Hypochlorit<br />
für Oxidationszwecke ist entsprechend der Trinkwasserverordnung<br />
in Deutschland nicht zulässig.<br />
Zur Beurteilung der Entfernungsmöglichkeiten für<br />
Arsen ist eine Rohwasseranalyse entsprechend Trinkwasserverordnung<br />
(TrinkwV, Anlage 2 und 3) notwendig,<br />
die durch die Parameter Phosphat, Silikat, Calcium,<br />
Magnesium, Redoxpotential sowie Säure- und Basekapazität<br />
ergänzt wird. Sinnvollerweise wird zusätzlich<br />
die As(III)- und As(V)-Konzentration ermittelt. Aufgrund<br />
der chemischen Ähnlichkeit von Arsenat und Phosphat<br />
ist letzteres als wichtigster Konkurrent bei der spezifischen<br />
Arsenentfernung zu betrachten.<br />
4.3 Entfernung von Arsen im Rahmen<br />
vorhandener Aufbereitungsprozesse<br />
In Enteisenungs- und Entmanganungsfiltern kann sowohl<br />
die Oxidation als auch ein Rückhalt des Arsens stattfinden.<br />
Nach einer Belüftung des Rohwassers werden<br />
gelöstes Eisen(II) und Mangan(II) im Filterbett überkatalytisch-biologische<br />
Reaktionen zu unlöslichen<br />
Eisen- und Manganoxiden/-hydroxiden oxidiert und<br />
dort abgeschieden. Gleichzeit ist eine Oxidation des<br />
Arsen(III) durch die Manganoxide oder auf biologischem<br />
Wege möglich. Die Festlegung des Arsenat erfolgt<br />
durch Adsorption bzw. Mitfällung an den Reaktionsprodukten<br />
der Enteisenung. Die Voraussetzung für die<br />
Wirksamkeit ist ein genügend hoher Eisengehalt im<br />
Rohwasser und eine nicht zu hohe Arsenkonzentration.<br />
Günstig sind molare Eisen- zu Arsenverhältnisse von 10<br />
bis 30. Je nach Beschaffenheit des Rohwassers können<br />
eine zusätzliche Dosierung von Eisen(II) oder von Oxidationsmitteln<br />
oder eine leichte Senkung des pH-Wertes<br />
zur Verbesserung der Arseneliminierung beitragen.<br />
Bei der Flockung mit Eisen- oder Aluminiumsalzen<br />
zur Trübstoffentfernung ist in der Regel eine simultane<br />
Elimination von Arsen zu beobachten, welche von der<br />
guten Adsorption des Arsens an den gebildeten Eisenhydroxid-<br />
bzw. Aluminiumhydroxid-Flocken resultiert.<br />
Aus diesem Grund ist die Flockung auch als gezieltes<br />
Verfahren der Arsenentfernung geeignet.<br />
Während der Fällungsenthärtung ist bei einem pH-<br />
Wert oberhalb von 10,5 eine gleichzeitige Arsenentfernung<br />
zu beobachten. Der Einsatz der Kalkfällung zum<br />
alleinigen Zweck der Arsenentfernung ist aber in der<br />
Praxis nicht sinnvoll, da durch die erhebliche Veränderung<br />
der <strong>Wasser</strong>zusammensetzung in der Regel eine<br />
nachfolgende Stabilisierung des <strong>Wasser</strong>s notwendig ist<br />
(z. B. durch Mischen oder Aufhärtung).<br />
Membranverfahren zur Partikelentfernung (z. B.<br />
Mikrofiltration) haben keinen Einfluss auf die Arsenkonzentration.<br />
Hingegen kann durch Nanofiltration<br />
und Umkehrosmose Arsenat zum Teil zurückgehalten<br />
werden. Zu beachten ist aber, dass das ungeladene<br />
Arsen(III) die Membran weitgehend ungehindert<br />
passiert. Da diese Verfahren generell eine weitgehende<br />
Enthärtung bzw. Entsalzung des <strong>Wasser</strong>s<br />
erzielen, ist die Arsenentfernung nur als Nebeneffekt<br />
zu betrachten.<br />
Stark basische Ionenaustauscher sind zwar prinzipiell<br />
in der Lage, das Anion Arsenat zu entfernen, dies erfolgt<br />
aber nicht selektiv. Aus diesem Grund ist eine gezielte<br />
Arsenentfernung mit Ionenaustauschern ohne eine<br />
parallele bedeutende Entfernung des konkurrierenden<br />
Sulfats und Nitrats nicht möglich. Das ungeladene<br />
Arsen(III) ist durch Ionenaustausch nicht zu entfernen.<br />
Andere Verfahren der Trinkwasseraufbereitung (wie<br />
z. B. Entsäuerung durch Belüftung, Aktivkohleadsorption<br />
oder Desinfektion) haben keine Auswirkung auf die<br />
Arsenkonzentration im <strong>Wasser</strong>.<br />
4.4 Gezielte Entfernung von Arsen<br />
Die Aufbereitungstechniken zur selektiven Arseneliminierung<br />
aus Trinkwasser beruhen auf der Adsorption<br />
der Arsenverbindungen an schwerlösliche Metalloxide/<br />
-hydroxide, die entweder als festes Adsorptionsmedium<br />
eingesetzt werden oder als Reaktionsprodukte nach der<br />
Dosierung von Flockungssalzen vorliegen.<br />
November 2011<br />
1072 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
4.4.1 Adsorption<br />
Festbett-Adsorptionsverfahren sind für die Spurenstoffentfernung<br />
besonders geeignet, da sie bei richtiger Auslegung<br />
lange Standzeiten bei gleichzeitig hoher<br />
Betriebs<strong>sich</strong>erheit und geringem Wartungsaufwand<br />
ermöglichen. Zur Arsenentfernung kommen granulierte<br />
Adsorbentien auf Basis von Metalloxiden/-hydroxiden<br />
zum Einsatz [4]. In Deutschland sind die folgenden<br />
Adsorbentien zugelassen: Eisen(III)hydroxidoxid nach<br />
DIN EN 15029, eisenumlagertes, aktiviertes Aluminiumoxid<br />
nach DIN EN 14369 und aktiviertes, granuliertes<br />
Aluminiumoxid nach DIN EN 13753. In der Praxis hat <strong>sich</strong><br />
gezeigt, dass Eisenoxide/-hydroxide ein wesentlich<br />
höheres Adsorptionsvermögen aufweisen als Aluminiumoxid.<br />
Während des Betriebes erschöpft <strong>sich</strong> das<br />
Adsorptionsmaterial allmählich und muss vor Erreichen<br />
des Grenzwertes im Produktwasser gegen frisches Material<br />
ausgetauscht werden. Eine Reihenwechselschaltung<br />
zweier Adsorber erhöht die Betriebs<strong>sich</strong>erheit.<br />
Die erzielbare Adsorptionskapazität hängt von den<br />
Eigenschaften des Adsorbens (z. B. spezifische Oberfläche)<br />
und von den Rohwasserparametern ab. Ein<br />
geringerer pH-Wert und eine geringe Konzentration<br />
konkurrierender Anionen, insbesondere Phosphat,<br />
führen zu langen Standzeiten der Adsorptionsfilter. Bei<br />
der Auslegung der Festbettadsorber wird in der Regel<br />
von einer Filtergeschwindigkeit von 5 bis 15 m/h und<br />
einer Leerbettverweilzeit von 3 bis 10 Minuten ausgegangen.<br />
Nach vorliegenden Betriebserfahrungen werden<br />
bei Arsenkonzentrationen im Rohwasser von 10 bis<br />
50 µg/L, geringen Phosphat- und Silikatgehalten und<br />
pH-Werten unter 8,0 Beladungen von etwa 1 bis 10 g<br />
Arsen pro kg trockenes Adsorbens erreicht [5]. Beispielhaft<br />
sind drei typische Durchbruchskurven für ein im<br />
Trinkwasser zugelassenes Granuliertes Eisenhydroxid<br />
(GEH) in Bild 2 wiedergegeben.<br />
Bild 2. Arsen-Durchbruchskurven für Granuliertes Eisenhydroxid (GEH)<br />
aus drei verschiedenen <strong>Wasser</strong>werken [6].<br />
4.4.2 Flockung<br />
Bei der Flockung entstehen amorphe Niederschläge aus<br />
Eisen- oder Aluminiumhydroxid, die das Arsen adsorptiv<br />
binden. Die Dosiermengen des Flockungsmittels hängen<br />
von der spezifischen Rohwasserzusammensetzung<br />
ab, insbesondere vom pH-Wert sowie von der Arsenund<br />
Phosphat-Konzentration. In grober Näherung sollte<br />
die molare Fe(III) bzw. Al(III)-Konzentration mindestens<br />
das 10- bis 30-fache der molaren Arsenkonzentration<br />
betragen. Typische Dosiermengen liegen zwischen 0,5<br />
und 5 mg/L als Metallion [7]. Je niedriger der pH-Wert<br />
des Rohwassers ist, desto weniger Flockungsmittel wird<br />
benötigt bzw. desto geringer ist die Arsenkonzentration<br />
im aufbereiteten <strong>Wasser</strong>. Konkurrierende <strong>Wasser</strong>inhaltsstoffe,<br />
wie z. B. Phosphat, können eine Erhöhung der<br />
Flockungsmitteldosierung notwendig machen. Die Flockung<br />
mit Al(III)-Salzen ist gegenüber dem Einsatz von<br />
Fe(III) weniger effektiv und im pH-Bereich des Einsatzes<br />
eingeschränkt. Beide Flockungsmittel zeigen gegenüber<br />
Arsen(III) eine schlechtere Wirksamkeit, deshalb ist<br />
eine chemische Oxidation vor der Flockung erforderlich.<br />
Die Abtrennung der ausgefällten Hydroxide erfolgt<br />
in der Regel durch eine Schnellfiltration, wobei Durchbrüche<br />
besonders zu vermeiden sind (Arbeitsblatt<br />
W 213). Auch eine Verfahrenskombination mit der<br />
Mikrofiltration ist dazu geeignet, die Flocken abzutrennen.<br />
Hierbei ergibt <strong>sich</strong> der Vorteil, dass im Gegensatz<br />
zum herkömmlichen Flockungsverfahren die Ausbildung<br />
von Makroflocken nicht erforderlich ist.<br />
4.4.3 In-situ-Aufbereitung im Aquifer<br />
Unter der Voraussetzung eines geeigneten Eisen-Arsen-<br />
Verhältnisses im Rohwasser sowie guter hydrogeologischer<br />
Bedingungen kommt eine in-situ-Aufbereitung<br />
zur Arsenentfernung in Betracht. Dabei wird Arsen im<br />
Aquifer abgeschieden, analog zur subterrestrischen<br />
Enteisenung und Entmanganung [8].<br />
4.4.4 Entsorgung<br />
Bei den oben genannten Verfahren zur gezielten Arsenentfernung<br />
fallen feste oder schlammartige Rückstände<br />
an, die umweltverträglich und entsprechend den<br />
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden müssen.<br />
Aufgrund der selektiven Adsorption des Arsens an den<br />
Eisen- bzw. Aluminiumhydroxiden ist eine Elution unter<br />
normalen pH- und Redoxbedingungen nicht wahrscheinlich.<br />
Das beladene Material wird nicht regeneriert,<br />
sondern deponiert. Bei der Entsorgung von Aufbereitungsrückständen<br />
sind die DVGW-Arbeitsblätter<br />
W 221, Teile 1 bis 3, und W 222 zu beachten.<br />
5. Nickel<br />
Der Grenzwert der TrinkwV für Nickel wurde auf 20 µg/L<br />
festgesetzt. Da der Grenzwert am Zapfhahn gilt und da<br />
<strong>sich</strong> vornehmlich in der Hausinstallation die Konzen-<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1073
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
tration noch erhöhen kann, ist für den <strong>Wasser</strong>werksausgang<br />
ein Wert von 10 µg/L anzustreben.<br />
Vorkommen<br />
Das in Deutschland im Grundwasser auftretende Nickel<br />
beruht meist auf geogenem Vorkommen. Die Mobilisierung<br />
des in Grundwasserleitern vorhandenen Nickels ist<br />
jedoch in aller Regel anthropogen. Ursache für erhöhte<br />
Nickelkonzentrationen können Säureeinträge aus der<br />
Atmosphäre oder der Landwirtschaft sein, die in<br />
schlecht gepufferten Böden bzw. Grundwasserleitern<br />
zu einer Mobilisierung von Schwermetallen führen. Weiterhin<br />
kann der Zustrom von nitrathaltigem Grundwasser<br />
in pyrithaltige Grundwasserleiter eine Freisetzung<br />
von Nickel und anderen verwandten Schwermetallen<br />
(Zink, Cobalt) bewirken. In der wässrigen Phase liegt<br />
Nickel als freies zweiwertiges Kation vor [9].<br />
Voruntersuchungen zur Verfahrenswahl<br />
Die Voruntersuchungen sollten neben Nickel die für das<br />
Kalk-Kohlensäuregleichgewicht relevanten Parameter<br />
zuzüglich Eisen, Mangan, Cobalt, Zink, Cadmium, Blei,<br />
Aluminium, Trübung, Temperatur und DOC umfassen.<br />
Sofern ein Membranverfahren zur Nickelentfernung<br />
eingesetzt werden soll, sind zusätzlich Phosphat, Strontium,<br />
Barium sowie Silikat zu bestimmen. Da Nickel in<br />
erhöhter Konzentration primär in Grundwässern anzutreffen<br />
ist, sind starke Schwankungen der <strong>Wasser</strong>beschaffenheit<br />
nahezu auszuschließen. Über die Erfordernisse<br />
von technischen oder Pilotversuchen muss<br />
anhand der bereits vorliegenden Aufbereitungsergebnisse,<br />
der vorhandenen technischen Anlagen und der<br />
Ergebnisse der <strong>Wasser</strong>analyse(n) entschieden werden.<br />
5.1 Entfernung von Nickel im Rahmen<br />
vorhandener Aufbereitungsprozesse<br />
5.1.1 Enteisenung und Entmanganung<br />
Für die Enteisenung ist keine relevante Entfernung von<br />
Nickel bekannt. Nickel kann aber bei der Entmanganung<br />
mit entfernt werden. Der Mechanismus ist der<br />
Adsorption zuzuordnen, da Nickelionen an frisch gefälltem<br />
Manganoxid (MnO x ) und/oder an Braunstein<br />
(MnO 2 ) adsorbiert werden können. Eine merkliche<br />
Nickelentfernung tritt bei der Entmanganung bereits<br />
bei pH-Werten um 7 auf. Die erreichbare Restkonzentration<br />
nimmt mit steigender Mangankonzentration im<br />
Filterzulauf und mit steigendem pH-Wert bei der Entmanganung<br />
ab. Für Eliminationsraten von über 60 %<br />
sind bei ausreichend hohen Mangankonzentrationen<br />
pH-Werte um 8 oder höher erforderlich.<br />
5.1.2 Entsäuerungsfiltration<br />
Die Entsäuerungsfiltration führt als alleiniges Verfahren<br />
in der Regel nicht zu einer ausreichenden Entfernung<br />
von Nickel. Lediglich für sehr weiche Wässer, die bis zu<br />
einem pH-Wert von etwa 9 ohne Probleme filtrativ<br />
entsäuert werden können, ist ggf. eine Entfernung von<br />
Nickel möglich. Wenn das Rohwasser Eisen und/oder<br />
Mangan enthält, gelten die Ausführungen für die Enteisenung<br />
und Entmanganung.<br />
5.1.3 Enthärtung<br />
Bei der Fällungsenthärtung kann Nickel in Abhängigkeit<br />
vom pH-Wert gut bis sehr gut entfernt werden. So werden<br />
für Nickel Eliminationsraten von über 90 % erreicht.<br />
Es ist aber zu berück<strong>sich</strong>tigen, dass nach der Fällung<br />
eine Filtration des behandelten <strong>Wasser</strong>s bei dem hohen<br />
pH-Wert erforderlich sein kann, um entsprechend hohe<br />
Eliminationsraten im Gesamtsystem Fällung-Filtration<br />
zu erhalten [10].<br />
5.1.4 Ionenaustausch<br />
Nickel wird bei der Enthärtung oder Entsalzung mit<br />
schwach oder stark sauren Kationenaustauschern ähnlich<br />
gut oder besser entfernt als Calcium und Magnesium.<br />
Damit ist auch die teilweise Entfernung bei der<br />
Teilentsalzung mit Mischbettaustauschern möglich. Es<br />
ist davon auszugehen, dass die Nickelentfernung direkt<br />
proportional zur Härteentfernung ist. Vor einem ersten<br />
Einsatz für diese Anwendung sollten jedoch Pilotversuche<br />
erfolgen, da beim Einsatz von Ionenaustauschverfahren<br />
immer die Gefahr von Verdrängungseffekten<br />
besteht, die im ungünstigsten Fall gegen Ende einer<br />
Beladungsphase zu einem Anstieg der Ablaufkonzentration<br />
über die Zulaufkonzentration führen könnten.<br />
5.1.5 Membranfiltration<br />
Nickel kann bei der Umkehrosmose oder Nanofiltration<br />
mit entfernt werden. Das Permeat solcher Anlagen muss<br />
allerdings ähnlich wie beim Einsatz von Fällungsverfahren<br />
verschnitten oder weiter aufbereitet werden, um<br />
das Trinkwasser zu stabilisieren. Bei einer Aufbereitung<br />
des gesamten <strong>Wasser</strong>stroms zur weitestgehenden<br />
Nickelentfernung sind aufwändige Remineralisierungsverfahren<br />
erforderlich. Allein zum Zweck der Schwermetallentfernung<br />
ist der Einsatz dieser Verfahren nicht<br />
sinnvoll.<br />
5.2 Gezielte Entfernung von Nickel<br />
5.2.1 Adsorption an Manganoxid<br />
Das Verfahren „Mangandosierung zur Nickelent fernung“<br />
ist vor allem dann interessant, wenn in betroffenen <strong>Wasser</strong>werken<br />
die vorhandenen Filteranlagen im Hinblick<br />
auf die Nickelentfernung optimiert und weitergehend<br />
ausgenutzt werden können. Es sind in jedem Fall Aufbereitungsversuche<br />
erforderlich. Durch die Zugabe von<br />
Mangan(II)-chlorid vor einer Filterstufe zur Entmanganung<br />
und einen möglichst hohen pH-Wert kann die<br />
Nickelelimination bei diesem Prozess verbessert<br />
werden. Durch Umstellung und ggf. Ergänzung der<br />
Verfahrensführung beim Betrieb einer zweistufigen<br />
Enteisenungs- und Entmanganungsanlage, kann die<br />
November 2011<br />
1074 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Entfernung der natürlichen – bei Bedarf auch aufgestockten<br />
– Mangankonzentration ggf. vollständig in die<br />
erste Filterstufe verschoben werden. Nach Dosierung<br />
von Mangan(II)-chlorid in das Filtrat dieser Stufe steht<br />
die zweite Filterstufe dann für einen weiteren Entmanganungs-<br />
und Entnickelungsschritt zur Verfügung. Bis<br />
zu Nickelkonzentrationen von 80 µg/L im Rohwasser<br />
und einem Gehalt von 0,3 bis 1 mg/L Mangan können<br />
bei pH-Werten von 7,3 bis 8,3 rund 40–60 % des Nickels<br />
entfernt werden [11]. Bei einer geringeren natürlichen<br />
Mangan-Konzentration muss Mangan(II)-chlorid dosiert<br />
werden, um diese Nickel-Eliminationsraten erreichen zu<br />
können.<br />
5.2.2 Selektiver Ionenaustausch<br />
Zur Entfernung von Nickel sehr gut geeignet sind<br />
schwermetallselektive Ionenaustauscher vom Iminodiessigsäure-Typ,<br />
die auch weitere Schwermetall-Ionen,<br />
wie z. B. Blei und Cadmium, selektiv gegen Calcium-<br />
Ionen austauschen und so aus dem Trinkwasser<br />
en tfernen können (Bild 3) [12].<br />
Dieser Austauschertyp ist in der Liste der Aufbereitungsstoffe<br />
und Desinfektionsverfahren nach § 11<br />
TrinkwV 2011 genannt. Kupfer, Zink und auch andere<br />
Schwermetalle wie Blei und Cadmium müssen für die<br />
Beladung der Ionenaustauscher berück<strong>sich</strong>tigt werden.<br />
Iminodiessigsäureaustauscher sind von der Partikelform<br />
und -größe sowie dem grundsätzlichen hydraulischen<br />
Verhalten üblichen Kationenaustauschern gleichzusetzen.<br />
Sie werden in der Regel in der Mono-Natriumform<br />
geliefert. Empfehlenswert für die Trinkwasseraufbereitung<br />
ist die Calciumform, ggf. noch die Mono-<br />
Natrium-Form. Der Einsatz erfolgt in der Regel in Ionenaustauscherkolonnen<br />
im Abstrombetrieb. Der Durchbruch<br />
hängt von der Rohwasserkonzentration ab. In<br />
den bekannten Fällen lag diese unter 200 µg/L.<br />
Darüber hinaus sollte das zu behandelnde <strong>Wasser</strong><br />
folgenden Anforderungen genügen:<br />
""<br />
Cu, Zn möglichst < 500 µg/L, da konkurrierende<br />
Beladung<br />
""<br />
pH-Wert > 6 (Sättigungsindex max. +0,4)<br />
""<br />
Summe der Erdalkalien < 5 mmol/L<br />
""<br />
TOC/DOC möglichst geringer biologisch<br />
abbaubarer Anteil<br />
""<br />
Eisen/ Mangan < 0,02 mg/L<br />
""<br />
Trübung < 0,2 FNU<br />
Bild 3. Wirkungsweise von Iminodiessigsäureaustauschern.<br />
Bild 4. Durchbruchskurven für Nickel in einer zweistufigen<br />
Adsorberanlage mit einem Iminodiessigsäureaustauscher.<br />
Die typischen Filtergeschwindigkeiten liegen zwischen<br />
15 und 50 m/h. Die Harzschütthöhe liegt bei 1–2 m. Die<br />
Totalkapazität des Ionenaustauschers liegt typischerweise<br />
bei etwa 1,8 eq/L für die Calciumform. Die nutzbare<br />
Kapazität hängt vom Zusammenspiel der wichtigsten<br />
Einflussfaktoren Nickel-Zulauf-Konzentration, spezifischer<br />
Durchsatz, Calciumkonzentration und tolerierte<br />
Nickel-Ablauf-Konzentration ab. Bei einer tolerierten<br />
Ablaufkonzentration von 25 % des jeweiligen Grenzwertes<br />
des relevanten Schwermetalls haben <strong>sich</strong> nutzbare<br />
Kapazitäten von 0,5 bis max. 1 eq/L als erreichbar<br />
und wirtschaftlich sinnvoll erwiesen. Ein Beispiel für das<br />
Durchbruchsverhalten von Nickel in einem Chelataustauschersystem<br />
mit zwei Säulen ist in Bild 4 wiedergegeben.<br />
Zur Vor-Ort-Überprüfung der Nickelkonzentration<br />
stehen Küvettentestverfahren für Cadmium (0–80 µg/L),<br />
Blei (0–300 µg/L), Nickel (7–1000 µg/L) und Kupfer<br />
(2–200 µg/L) zur Verfügung. Eine Bestimmung von<br />
Nickel im Bereich von 10 µg/L ist möglich. Mit der<br />
Nutzung dieser Verfahren kann der Einsatz von Labor-<br />
Messverfahren weitgehend verringert und auf die Kontrolle<br />
mit Vor-Ort-Messungen zurückgegriffen werden.<br />
Eine Bestimmung der Schwermetallkonzentrationen im<br />
behandelten <strong>Wasser</strong> mit einem Labor-Messverfahren<br />
sollte jedoch gelegentlich zusätzlich erfolgen.<br />
5.2.3 Entsorgung<br />
Prinzipiell ist eine Regenerierung der Ionentauscher im<br />
<strong>Wasser</strong>werk möglich, wird aber bisher nicht praktiziert.<br />
Zur Vermeidung eines zu großen verfahrenstechnischen<br />
Aufwandes im <strong>Wasser</strong>werk kann ein Regenerierservice<br />
für mobile Austauscherkolonnen oder für loses Harz mit<br />
Hol- und Bringservice in Anspruch genommen werden.<br />
Wird das Harz nicht regeneriert, muss es einer Verbrennung<br />
zugeführt werden.<br />
Das bei der Adsorption an die Manganoxide<br />
eliminierte Nickel wird zum Teil mit diesen in den<br />
<strong>Wasser</strong>werksschlamm überführt, zum Teil verbleibt es<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1075
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
an den Manganoxidbelägen auf dem Filtermaterial. Je<br />
nach Filtrationsverfahren im <strong>Wasser</strong>werk (Enteisenung,<br />
Entmanganung, Entsäuerung) gelangen noch eine<br />
Reihe anderer Feststoffe in den Schlamm. Je nach<br />
Nickelgehalt im Schlamm kann der <strong>Wasser</strong>werksschlamm<br />
auch mit dem Nickel entsorgt bzw. verwertet<br />
werden.<br />
6. Uran<br />
Die in Deutschland im Grundwasser auftretenden Urangehalte<br />
sind im Allgemeinen auf natürliche Einflüsse<br />
zurückzuführen. Der Grenzwert der kommenden<br />
TrinkwV für Uran wurde auf 10 µg/L aufgrund der chemotoxischen<br />
Wirkung von Uran festgesetzt. Die radiotoxische<br />
Wirkung von natürlichem Uran ist in diesem<br />
Konzentrationsbereich zu vernachlässigen.<br />
6.1 Vorkommen<br />
Uran ist natürlicherweise ubiquitär in der Hydrosphäre<br />
anzutreffen. Die meisten Grundwässer enthalten Uran,<br />
wobei die Konzentration jedoch in der Regel unter<br />
2 µg/L beträgt und nur in den seltenen Fällen 10 µg/L<br />
überschreitet. Die Konzentrationsverteilung von Uran<br />
im Grundwasser ist als sehr kleinräumig differenziert zu<br />
bezeichnen. Zwar gibt es in Deutschland Gebiete, in<br />
denen höhere Urankonzentrationen im Grundwasser<br />
wahrscheinlicher sind als in anderen Gebieten, aber<br />
auch in den betroffenen Gebieten ist Uran sehr kleinräumig<br />
verteilt. Hoch belastete und unbelastete<br />
Brunnen können weniger als 50 bis 200 m voneinander<br />
entfernt liegen.<br />
In der wässrigen Phase liegt Uran nicht als freies Kation<br />
vor. In natürlichen Grundwässern spielt das Uranylkation<br />
UO 2<br />
2+ eine zentrale Rolle, da es das Zentrum von<br />
Uranylkomplexen wie beispielsweise der Uranylcarbonatokomplexe<br />
bildet. Diese sehr stabilen anionischen<br />
Komplexe stellen die dominante Uranspezies in natürlichen<br />
Grundwässern dar. Uran liegt somit nicht wie<br />
Bild 5. Chemische Speziation eines uranhaltigen Modellwassers.<br />
andere Metalle oder Schwermetalle als Kation, sondern<br />
als anionischer Komplex im Grundwasser vor (Bild 5).<br />
Die mit erhöhten Urankonzentrationen belasteten<br />
Grundwässer sind in der Regel sauerstoffhaltig und weisen<br />
vergleichsweise hohe Hydrogencarbonatgehalte<br />
und Härtegrade auf. Neben Carbonat bildet das Uranylkation<br />
auch mit anderen Liganden wie Sulfat oder<br />
Phosphat sowie Huminstoffen stabile Komplexe [13].<br />
6.2 Voruntersuchungen zur Verfahrenswahl<br />
Die Voruntersuchungen sollten die für das Kalk-Kohlensäuregleichgewicht<br />
relevanten Parameter zuzüglich<br />
Eisen, Mangan, Aluminium, Trübung, Temperatur und<br />
DOC umfassen. Sofern ein Membranverfahren zur Uranentfernung<br />
eingesetzt werden soll, ist zusätzlich Phosphat,<br />
Strontium, Barium sowie Silikat mit zu bestimmen.<br />
6.3 Entfernung von Uran im Rahmen vorhandener<br />
Aufbereitungsprozesse<br />
Uran kann mit etablierten Verfahren der Trinkwasseraufbereitung<br />
nur vergleichsweise schlecht entfernt<br />
werden. Bei einigen Verfahren ist prinzipiell eine weitergehende<br />
Entfernung möglich, wobei jedoch gravierende<br />
Nachteile hin<strong>sich</strong>tlich Betriebsbedingungen und<br />
Entsorgung bestehen. Die folgenden Aussagen gelten<br />
insbesondere für Wässer mit Urankonzentrationen unter<br />
100 µg/L.<br />
Durch eine Entmanganungsfiltration kann Uran nicht<br />
aus dem <strong>Wasser</strong> entfernt werden. Durch die Filtration zur<br />
Enteisenung kann abhängig vom Eisengehalt des Rohwassers<br />
und der Urankonzentration ein Teil des Urans<br />
mit aus dem <strong>Wasser</strong> entfernt werden. Eine <strong>sich</strong>ere Einhaltung<br />
des Grenzwertes ist damit nicht gewährleistet.<br />
Uran kann bei der Flockungsfiltration bzw. Flockung<br />
mit Sedimentation zum Teil aus dem <strong>Wasser</strong> entfernt<br />
werden. Der Eliminationsgrad ist im Wesentlichen von<br />
der Urankonzentration des <strong>Wasser</strong>s, dem pH-Wert sowie<br />
der Menge und der Art des zugegeben Flockungsmittels<br />
abhängig. Je niedriger der pH-Wert im pH-Bereich<br />
6,5 bis 9,5 ist, desto besser wird Uran bei der Flockung<br />
entfernt. Flockungsmittel auf Aluminiumbasis sind zur<br />
Uranentfernung besser geeignet als solche auf Basis<br />
von Eisen. Für eine weitgehende Entfernung sind hohe<br />
Flockungsmittelmengen (über 10 mg/Al) erforderlich,<br />
wie sie in der Trinkwasseraufbereitung üblicherweise<br />
nicht eingesetzt werden.<br />
Mit den üblichen zur Trinkwasserenthärtung eingesetzten<br />
Membrantypen zur Nanofiltration und Umkehrosmose<br />
wird Uran mit aus dem <strong>Wasser</strong> entfernt. Hier<br />
sind die entsprechenden technischen Regeln zum<br />
Betrieb von Nanofiltrations- bzw. Umkehrosmoseanlagen<br />
zu berück<strong>sich</strong>tigen.<br />
Die Wirkungsgrade hin<strong>sich</strong>tlich der Entfernung von<br />
Uran sind abhängig von dem gewählten Membrantyp<br />
und können deutlich über 95 % liegen. Diese Verfahren<br />
sind nicht selektiv für die Entfernung von Uran. Die<br />
November 2011<br />
1076 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Anwendung bedeutet eine gravierende Änderung der<br />
<strong>Wasser</strong>beschaffenheit, da je nach Membrantyp auch 45<br />
bis 100 % der Hauptinhaltsstoffe wie Chlorid, Sulfat,<br />
Magnesium, Calcium etc. aus dem <strong>Wasser</strong> entfernt<br />
werden. Die Entfernungsraten für die Hauptinhaltsstoffe<br />
sind ebenfalls im Wesentlichen abhängig vom gewählten<br />
Verfahren und dem eingesetzten Membrantyp.<br />
In der Regel muss die Entfernung von Uran im<br />
Vollstrom erfolgen. Bei niedrigen Urankonzentrationen<br />
(< 20 µg/L) kann eine Teilstromaufbereitung ausreichend<br />
sein. Es ist zu berück<strong>sich</strong>tigen, dass die<br />
Membranverfahren zumeist mit Ausbeuten zwischen 80<br />
und 90 % betrieben werden und demzufolge ein<br />
entsprechend hohes Rohwasservorkommen zur Verfügung<br />
stehen muss.<br />
6.4 Gezielte Entfernung von Uran<br />
6.4.1 Ionenaustausch<br />
In der Trinkwasseraufbereitung ist zur selektiven Entfernung<br />
von Uran ausschließlich das Ionenaustauschverfahren<br />
unter Einsatz spezieller schwach oder stark basischer<br />
Anionenaustauschertypen geeignet. Mit diesem<br />
Verfahren lässt <strong>sich</strong> Uran selbst bei hohen Urankonzentrationen<br />
im Rohwasser von über 100 µg/L vollständig<br />
und <strong>sich</strong>er aus dem <strong>Wasser</strong> entfernen (Bild 6).<br />
Für den problemlosen Einsatz von Ionenaustauschern<br />
zur Uranentfernung sollte das <strong>Wasser</strong> im Zulauf zur<br />
Ionenaustauscheranlage hin<strong>sich</strong>tlich der chemisch-physikalischen<br />
Beschaffenheit einschließlich Eisen und Mangan<br />
Trinkwasserqualität aufweisen. Eine Calcitabscheidung<br />
im Filterbett sollte in jedem Fall vermieden werden.<br />
Empfehlenswert ist der Einsatz von Ionenaustauschern in<br />
der Sulfatform, um Calcitabscheidung insbesondere in<br />
der Einfahrphase zu verhindern. Wenn hohe Filtergeschwindigkeiten<br />
(> 10–15 m/h) realisiert werden sollen,<br />
sind hin<strong>sich</strong>tlich der Parameter Trübung, Eisen und<br />
Mangan strengere Anforderungen einzuhalten:<br />
""<br />
Trübung < 0,1 FNU,<br />
""<br />
Eisen < 0,01 mg/L<br />
""<br />
Mangan < 0,01 mg/L<br />
Die Schütthöhe an Harz liegt in der Regel bei 1 m bis<br />
2 m. Die Austauschkinetik ist sehr hoch, so dass die<br />
Ionenaustauscherkolonnen für Filtergeschwindigkeiten<br />
von 10 m/h bis maximal rund 50 m/h ausgelegt werden<br />
können. Dies entspricht je nach Schütthöhe spezifischen<br />
Durchsätzen von etwa 5 BV/h bis 50 BV/h.<br />
Die erreichbare Beladung und damit die Filterlaufzeit<br />
sind abhängig von der <strong>Wasser</strong>zusammensetzung. Die<br />
erreichbare Uranbeladung des Ionenaustauschers sinkt<br />
mit steigendem pH-Wert, mit steigender DOC/TOC-<br />
Konzentration und in geringerem Maß mit steigendem<br />
Anionengehalt. Aufgrund des Adsorptionsgleichgewichts<br />
wird die Beladung auch von der Urankonzentration<br />
im Zulauf und der maximal zugelassenen Konzentration<br />
im Filterablauf bestimmt. Unter ungünstigen<br />
Bild 6. Urandurchbruch in verschiedenen Tiefen eines<br />
Anionenaustauschers in einem <strong>Wasser</strong>werk.<br />
Umständen werden Beladungen des Ionenaustauschers<br />
von rund 2 g Uran /L Ionenaustauschermaterial erreicht.<br />
Unter günstigen Bedingungen steigt die Beladung auf<br />
über 30 g/L an. Im praktischen Betrieb resultieren aus<br />
diesen erreichbaren Beladungen Filterlaufzeiten zwischen<br />
50 000 BV und mehr als 300 000 BV [14].<br />
Die durch die Beladung des Ionenaustauschers mit<br />
Uran ausgehende Strahlenbelastung für <strong>Wasser</strong>werkspersonal<br />
beträgt unter sehr konservativen Annahmen<br />
maximal ein Zehntel der durchschnittlichen Strahlenbelastung<br />
von beruflich nicht strahlenexponierten<br />
Bevölkerungsgruppen durch natürliche Quellen von<br />
2,4 mSv. Die überschlägige Berechnung der Strahlenbelastung<br />
sollte für jede Anlage nach dem ersten vollständigen<br />
Filterlauf nachvollzogen werden. Hierfür ist<br />
eine gamma-spektrometrische Untersuchung des beladenen<br />
Ionenaustauschers erforderlich. Neben den<br />
Gehalten der unterschiedlichen Uranisotope sollten<br />
zusätzlich zumindest die Konzentrationen der Radiumisotope<br />
226 und 228, der Thoriumisotope 228 und 230<br />
sowie Blei 210, Kalium 40 und Cäsium 137 mit untersucht<br />
werden [15].<br />
6.4.2 Überwachung<br />
Die betriebliche Überwachung der Ionenaustauscheranlagen<br />
beschränkt <strong>sich</strong> auf die Überwachung des<br />
Durchsatzes und des Druckverlustes. Eine kontinuierliche<br />
Überwachung des Urangehaltes im Filterablauf ist<br />
nicht möglich. Daher sollten in regelmäßigen zeitlichen<br />
Abständen Proben im Filterablauf genommen und auf<br />
Uran untersucht werden. Die Festlegung der zeitlichen<br />
Intervalle ist von der Betriebserfahrung abhängig.<br />
Bei einer Neuanlage wird empfohlen, während des<br />
ersten Filterlaufs bis zur Erschöpfung des Ionenaustauschers<br />
alle rund 15 000 BV (bezogen auf dem Filterablauf)<br />
jeweils eine Probe aus den Filterablauf zu entnehmen<br />
und auf Uran zu untersuchen. Es empfiehlt <strong>sich</strong><br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1077
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
auch, Proben aus der halben Schütthöhe zu entnehmen,<br />
zur Früherkennung der vergleichbar scharfen<br />
Durchbruchsfront. Bei jeder zweiten Probenahme sollte<br />
auch der Filterzulauf beprobt werden. Nach den entsprechenden<br />
Betriebserfahrungen können die Probenahmeintervalle<br />
verlängert werden, sofern <strong>sich</strong> die<br />
Betriebsbedingungen der Anlage nicht gravierend<br />
verändern (Filterbetthöhe, unbekannter Ionenaustauschertyp<br />
etc.).<br />
6.4.3 Entsorgung<br />
Die Entsorgung von uranbeladenen Ionenaustauschern<br />
kann durch externe Regeneration des Ionenaustauschers<br />
erfolgen. Ein alternativer Entsorgungspfad ist<br />
die Verbrennung, bei der das Uran in der Schlacke bzw.<br />
dem Filterstaub verbleibt. Eine Deponierung des beladenen<br />
Ionenaustauschers ist aufgrund der Gesetzeslage<br />
nicht möglich. Die Genehmigung für die Entsorgung<br />
des Konzentrats bei Einsatz eines Membranverfahrens<br />
bedarf einer Genehmigung.<br />
7. Betrieb von Festbettadsorbern<br />
Zur selektiven Entfernung von Arsen, Nickel oder Uran<br />
ist der Einsatz von Festbettadsorbern das Verfahren der<br />
Wahl. Die Adsorberkolonnen sind für die Arsenentfernung<br />
mit granulierten Eisenoxiden/-hydroxiden, für die<br />
Entfernung von Nickel oder Uran mit jeweils speziellen<br />
Ionenaustauschern befüllt. Folgende Punkte sind beim<br />
Betrieb von Adsorptionskolonnen zu beachten: Die<br />
Adsorber sollten wenn möglich über den gesamten Filterlauf,<br />
das heißt von der Befüllung bis zum Austausch<br />
bzw. Regeneration des Material ohne Spülung betrieben<br />
werden. Sie sind daher so in die Aufbereitungsanlage zu<br />
integrieren, dass die Trübung und die Konzentrationen<br />
an Eisen und Mangan im Zulauf möglichst gering sind.<br />
Die Möglichkeit der Spülung muss dennoch gegeben<br />
sein, insbesondere ist ein Klarspülen der Adsorptionskolonnen<br />
nach einer Neu befüllung erforderlich.<br />
Längere Stillstandszeiten der Adsorber sollten insgesamt<br />
vermieden werden. Kommt es dennoch zu<br />
längeren Stillstandszeiten sind die Adsorber danach wie<br />
Tiefenfilter in Betrieb zu nehmen, d.h. es ist die Möglichkeit<br />
eines Erstfiltratabschlags vorzusehen. Nach einer<br />
Neubefüllung ist ebenfalls ein Erstfiltratabschlag erforderlich,<br />
wobei dessen Dauer vom eingesetzten Material<br />
abhängt. Bei Einsatz von Ionenaustauschern sollten<br />
Druckstöße sowohl im Betrieb als auch beim Anfahren<br />
der Filter vermieden werden, da es hierdurch zu einer<br />
Kompaktierung der Schüttung kommen kann und diese<br />
<strong>sich</strong> ungünstig auf den Druckverlust auswirken.<br />
Sofern aufgrund der <strong>Wasser</strong>beschaffenheit im Zulauf<br />
mit Spülungen während eines Filterlaufs zu rechnen ist,<br />
kann ein Schauglas im Bereich des oberen Teils der<br />
Schüttung und in der Höhe des Freibords sinnvoll sein.<br />
So können ggf. Verbackungen erkannt und die Bettausdehnung<br />
bei der Spülung kontrolliert werden.<br />
8. Schlussfolgerungen<br />
Für alle drei hier beschriebenen anorganischen Spurenstoffe<br />
As, Ni und U stehen technisch erprobte, spezifische<br />
Entfernungsverfahren zur Verfügung. Sie erlauben<br />
eine <strong>sich</strong>ere Einhaltung der Trinkwassergrenzwerte<br />
zu vertretbaren Kosten, vorausgesetzt die Rohwassergehalte<br />
liegen nicht übermäßig hoch und die wasserchemischen<br />
Randbedingungen sind günstig. Die weitaus<br />
meisten Fälle erhöhter Rohwasserkonzentrationen<br />
betreffen den Bereich unter 100 µg/L so dass die<br />
Zielwerte von unter 10 µg/L erreichbar sind. Vor allem<br />
die Festbettadsorbertechniken sind für den <strong>sich</strong>eren<br />
Betrieb günstig, weil sie über eine längere Zeit einen<br />
Ablauf mit geringen Restkonzentrationen produzieren<br />
und die Überwachung der Anlagen durch relativ wenige<br />
Beprobungen (z.B. einmal monatlich) erleichtern. Die<br />
erreichten Standzeiten der Festbettadsorber (Granulierte<br />
Eisenhydroxide für As, Ionentauscher für Ni und U)<br />
betragen in günstigen Fällen einige Monate bis wenige<br />
Jahre. Für eine geordnete Entsorgung der beladenen<br />
Adsorbermaterialien ist zu sorgen.<br />
Literatur<br />
[1] Konietzka R., Dieter H. H. und Voss J. U.: Vorschlag für einen<br />
gesundheitlichen Leitwert für Uran im Trinkwasser. Umweltmedizin<br />
in Forschung und Praxis 10 (2005) Nr. 2, S. 133–143.<br />
[2] Guidelines for drinking-water quality. 3rd edition. Incorporating<br />
1 st and 2 nd addenda, Vol.1, Recommendations. World<br />
Health Organisation, Geneva 2008. ISBN 978 92 4 154761 1.<br />
[3] Jekel, M.: Removal of arsenic in drinking water treatment. In<br />
J. O. Nriagu (Ed.), Arsenic in the environment. John Wiley &<br />
Sons, Inc., New York, 1994, p. 119–132.<br />
[4] Mohan, D. and Pittman, C.: As removal from water using<br />
adsorbents – A critical review. Journal Hazardous Material<br />
142 (2007) No. 1–2, p. 1–53.<br />
[5] Driehaus, W.: Arsenic removal – experience with the GEH®<br />
process in Germany. Water Science and Technology: Water<br />
Supply. 2 (2002) No. 2, p. 275-280.<br />
[6] Bahr, C., Driehaus, W., Kersten, M., Vlasova, N., Posth, N., Kappler,<br />
A., Schurk, K., Stanjek, H., Daus, B., Kolbe, F. und Wennrich,<br />
R.: MicroActiv – Optimierung von <strong>Wasser</strong>aufbereitungstechnologien<br />
zur Arsen- und Antimonfixierung durch mikrobiologisch<br />
aktivierte Eisenminerale. <strong>Wasser</strong> 2010. Jahrestagung<br />
der <strong>Wasser</strong>chemischen Gesellschaft, Fachgruppe in der<br />
Gesellschaft der Deutschen Chemiker. 10.–12. Mai 2010,<br />
Bayreuth. Poster PAu04, S. 236–240.<br />
[7] Jekel, M.: Arsenentfernung in der <strong>Wasser</strong>aufbereitung.<br />
DVGW-Schriftenreihe <strong>Wasser</strong>, 82 (1994) 71.<br />
[8] Rott, U. und Meyer, C.: Die unterirdische Trinkwasseraufbereitung<br />
– ein Verfahren zur rückstandsfreien Entfernung von<br />
Arsen. <strong>Wasser</strong> und Abfall 10 (2000), S. 36–43.<br />
[9] Cremer, N.: Untersuchungen zum Auftreten und zur Bindungsform<br />
von Schwermetallen im Grundwasser Nordrhein-Westfalens<br />
unter besonderer Berück<strong>sich</strong>tigung der<br />
Mobilität des Nickels. Ursachen und Lösungsmöglichkeiten<br />
für Probleme mit toxischen Schwermetallen bei der Trinkwassergewinnung<br />
und Aufbereitung. Berichte aus dem<br />
IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für <strong>Wasser</strong>forschung<br />
gemeinnützige GmbH. Band 40. 5 – 44. Mülheim an der Ruhr<br />
(2003).<br />
November 2011<br />
1078 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
[10] Overath H., Stetter D. und Hahne J.: Entfernung von Nickel,<br />
Cobalt und Cadmium aus Rohwasser zur Trinkwassergewinnung<br />
– das Kevelaer-Verfahren. bbr 10 (1998).<br />
[11] Stetter D. und Dördelmann O.: Untersuchungen zur weitergehenden<br />
Entfernung von Nickel aus Grundwässern bei der<br />
filtrativen Entsäuerung und Entmanganung. DVGW-F&E Vorhaben<br />
W 4/05/04 (2008).<br />
[12] Overath H., Stetter D. und Dördelmann O.: Entwicklung der<br />
Verfahrenstechnik zur Eliminierung von Schwermetallen aus<br />
Rohwässern zur Trinkwassergewinnung mit chelatbildenden<br />
Kationenaustauscherharzen zur technischen Reife (Teilprojekt<br />
1). Abschlussbericht zum BMBF-Forschungsvorhaben<br />
02 WT 9759. IWW, Mülheim an der Ruhr (2002).<br />
[13] Riegel, M., Tokmachev, W. and Höll, H.: Kinetics of uranium<br />
sorption onto weakly basic anion exchangers. Reactive &<br />
Functional Polymers 68 (2008), p. 1072–1080.<br />
[14] Schlitt V.: Uran in Trinkwasser. In: Stuttgarter Berichte zur<br />
Siedlungswasserwirtschaft, Bd. 196 (2009), S. 77–96.<br />
[15] Uranentfernung in der Trinkwasseraufbereitung: Schlussbericht<br />
zum Verbundprojekt ; Uran-Projekt ; [Jekel M., Bahr<br />
C.; Teilprojekt 1: Oxidische Sorbentien; W. H. Höll, Riegel M.;<br />
Teilprojekt 2: Ionentauscher; Baldauf G., Schlitt V.; Teilprojekt<br />
3: Pilotfilteranlagen] http://edok01.tib.uni-hannover.de/<br />
edoks/e01fb10/625139569.pdf<br />
Eingereicht: 14.07.2011<br />
Korrektur: 26.10.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Autoren<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel<br />
E-Mail: martin.jekel@tu-berlin.de |<br />
Technische Universität Berlin |<br />
Institut für Technischen Umweltschutz |<br />
Fachgebiet <strong>Wasser</strong>reinhaltung, KF4 |<br />
Straße des 17. Juni 135 |<br />
D-10623 Berlin<br />
Dipl.-Ing. Carsten Bahr<br />
E-Mail: carsten.bahr@geh-wasserchemie.de |<br />
GEH <strong>Wasser</strong>chemie GmbH & Co. KG |<br />
Heinrich-Hasemeier-Straße 33 |<br />
D-49076 Osnabrück<br />
Dipl.-Ing. Volker Schlitt<br />
E-Mail: volker.schlitt@tzw.de |<br />
TZW Karlsruhe |<br />
Karlsruher Straße 84 |<br />
D-76139 Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing.Dr. Dieter Stetter<br />
E-Mail: d.stetter@iww-online.de |<br />
IWW Zentrum <strong>Wasser</strong> Mülheim |<br />
Moritzstraße 26 |<br />
D-45476 Mülheim an der Ruhr<br />
Zeitschrift KA – <strong>Abwasser</strong> · Abfall<br />
In der Ausgabe 11/2011 lesen Sie u.a. folgende Beiträge:<br />
Liebscher / Gillar / Bosseler<br />
Rölle / Kuch<br />
Bester u.a.<br />
Seeliger<br />
Kraft / Saathoff<br />
Rapp<br />
Sanierung von <strong>Abwasser</strong>schächten – Untersuchung von Materialien und Systemen<br />
zur Abdichtung und Beschichtung – Teil 3: Beschichtung mit mineralischen und<br />
polymeren Systemen<br />
die Aktivkohlebehandlungsstufe auf der Kläranlage Kressbronn – Gezielte Entnahme<br />
von Pharmaka, Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln<br />
abbau von organischen Schadstoffen bei der Klärschlammbehandlung in<br />
pflanzen beeten<br />
wasserversorgung und <strong>Wasser</strong>schutzgebiete – Eine Betrachtung aus Anlass<br />
des neuen <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetzes<br />
planungs- und Steuerungstools für die Instandhaltung von Infrastruktur-Erfahrungen<br />
bei Emschergenossenschaft und Lippeverband<br />
planung der Trinkwasserversorgung für ein Dorf im ecuadorianischen Regenwald<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1079
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Ermittlung der horizontalen und<br />
vertikalen Durchlässigkeitsbeiwerte<br />
aus Pumpversuchen<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, Grundwasserleiter, Pumpversuch, horizontaler und<br />
vertikaler Durchlässigkeitsbeiwert<br />
Günter Schneider<br />
Es wird die Möglichkeit aufgezeigt, aus einem Pumpversuch<br />
den horizontalen (k fH ) und vertikalen (k fV )<br />
Durchlässigkeitsbeiwert eines Grundwasserleiters zu<br />
bestimmen. Dazu werden zunächst die k f -Werte der<br />
einzelnen Absenkstufen mit den DUPUIT/THIEM-<br />
Gleichungen be<strong>rechnet</strong> und gegen die jeweilige<br />
Absenkung s 0 bzw. s 0 * am Brunnenrand aufgetragen.<br />
Durch Extrapolation der Verbindungslinie bis zur<br />
Absenkung 0 wird der k fH -Wert erhalten. Für die<br />
Berechnung eines Senkungstrichters um einen Brunnen<br />
sowie die dabei geförderte <strong>Wasser</strong>menge werden<br />
zusätzlich die Verhältniswerte von k fH und k fV , das<br />
sind die Anisotropiefaktoren κ, benötigt. Ihre Ermittlung<br />
aus den einzelnen Absenkstufen ist angegeben.<br />
Ihr Auftrag zur zugehörigen Absenkung s 0 bzw. s 0 *<br />
und die Verbindungslinie durch diese Werte bis zur<br />
Abszisse (s 0 = 0) ergibt den κ 0 -Wert. Mit diesem kann<br />
der vertikale Durchlässigkeitsbeiwert k fV be<strong>rechnet</strong><br />
werden. Ein Beispiel erläutert die entsprechende<br />
Auswertung von Pumpversuchen.<br />
Determination of the Coefficient of Horizontal and<br />
Vertical Permeability<br />
A possibility is shown to determine the coefficient of<br />
horizontal (k fH ) and vertical (k fV ) permeability of an<br />
aquifer by means of a pumping test. Thereby one will<br />
obtain the value k fH by the extending the connection<br />
line of the test values to the zero-drawdown axis (plot<br />
of drawdowns versus k f -values). To calculate k fV the<br />
ratio of k fH and k fV (κ) is needed. It’s shown, how to<br />
get these values from the test values. Plotting the<br />
drawdowns versus these values and extending the<br />
line through these values to the zero-drawdown axis<br />
one can obtain κ 0 . The permeability coefficient k fV<br />
can be calculated by means of this value. An example<br />
shows the evaluation of pumping tests.<br />
1. Einführung<br />
Zur Ermittlung der zu erwartenden <strong>Wasser</strong>mengen, die<br />
bei Grundwasserabsenkungsmaßnahmen in Baustellen<br />
zu fördern sind, oder zur Berechnung der zu erwartenden<br />
Grundwassermengen bei Grundwasserversorgungsanlagen<br />
werden in der Regel zunächst Versuchsbrunnen<br />
niedergebracht, aus denen <strong>Wasser</strong> abgepumpt<br />
wird. Zusätzlich werden Grundwassermessstellen<br />
(GWMst) ausgeführt, in denen die Bewegungen des<br />
Grundwasserspiegels während des Pumpvorgangs<br />
gemessen werden. Die geförderten <strong>Wasser</strong>mengen<br />
zusammen mit den eingemessenen <strong>Wasser</strong>spiegellagen<br />
lassen dann einen Schluss zu auf die Größe der <strong>Wasser</strong>wegsamkeit<br />
des Grundwasserleiters. Erfasst wird sie<br />
bekanntlich durch den Durchlässigkeitsbeiwert k f (m/s),<br />
der dann die <strong>Wasser</strong>mengenberechnungen ermöglicht.<br />
Dieser wird bis heute analytisch durch Ansatz der<br />
DUPUIT/THIEM-Gleichungen (D/T) aus den Versuchen<br />
bestimmt, ausgenommen vielleicht Großprojekte, bei<br />
denen aufwendige numerische <strong>Wasser</strong>modelle erstellt<br />
werden. Die analytische Berechnung nimmt dabei an,<br />
dass die er<strong>rechnet</strong>en k f -Werte die horizontale <strong>Wasser</strong>wegsamkeit<br />
(k fH ) des GW-Leiters erfassen [z. B. 1, 2]. Die<br />
vertikale <strong>Wasser</strong>wegsamkeit des GW-Leiters (k fV ) wird<br />
dabei nicht mit berück<strong>sich</strong>tigt [3].<br />
Es sollen hier in erster Linie Lockergesteinsgrundwasserleiter<br />
betrachtet werden. Diese wurden in der<br />
Regel in strömendem <strong>Wasser</strong> sedimentiert und das<br />
hatte zur Folge, dass je nach <strong>Wasser</strong>führung gröberes<br />
oder feineres Gestein zur Ablagerung gekommen ist. So<br />
haben z. B. Aufmessungen in den Münchner Schmelzwasserschottern<br />
ergeben, dass – in vertikaler Richtung<br />
– etwa 30 % der Höhe von so genannten Rollkiesschichten<br />
(sandfreien Schichten) gestellt werden, der Rest von<br />
sandigen Kiesen [4]. Eine vergleichbare Schichtfolge<br />
wurde in den Lechschottern um Augsburg angetroffen.<br />
November 2011<br />
1080 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Bei sandkörnigen Sedimenten wird dann dementsprechend<br />
eine Wechselfolge von Sandschichten sowie<br />
schluffigen Sandschichten angetroffen.<br />
Vor allem bei numerischen Berechnungen, die <strong>sich</strong><br />
mit den <strong>Wasser</strong>spiegellagen in einem anisotropen GW-<br />
Leiter befasst haben, hat <strong>sich</strong> gezeigt, dass fehlende<br />
Aussagen über dessen vertikale Durchlässigkeit Annahmen<br />
über deren Größe erzwingen [5, 6]. Ziel dieses Aufsatzes<br />
soll es deshalb sein, eine Möglichkeit aufzuzeigen,<br />
Pumpversuche so auszuwerten, dass mit Hilfe der<br />
Durchlässigkeitswerte k fi , das sind Mischwerte aus horizontaler<br />
und vertikaler Durchlässigkeit, ein eindeutiger<br />
k fH - und k fV -Wert erhalten wird. Es wird dabei von den<br />
D/T-Gleichungen ausgegangen, so dass die Berechnung<br />
der Werte analytisch erfolgt. Die Berechnungen sind<br />
demzufolge auch rasch und mit wenig Aufwand durchzuführen.<br />
Gegenüber numerischen Grundwassermodellen<br />
ist es so auch möglich, durch Pumpversuche an<br />
mehreren Stellen den Grundwasserleiter besser zu<br />
erfassen.<br />
2. Isotroper Grundwasserleiter<br />
Es wird zunächst angenommen, dass der GW-Leiter isotrop<br />
ist, d. h. dass die <strong>Wasser</strong>wegsamkeit in allen Richtungen<br />
gleich groß ist. Damit ist die wesentliche Voraussetzung<br />
erfüllt, unter der die D/T-Gleichungen aufgestellt<br />
worden sind. Ferner wird davon ausgegangen,<br />
dass Pumpversuche in der jeweiligen Absenkstufe so<br />
lange gefahren worden sind, bis die geförderte <strong>Wasser</strong>menge<br />
Q (m³/s) und die in den GWMst gemessenen<br />
<strong>Wasser</strong>stände konstant waren. Die nun in den folgenden<br />
Gleichungen angegebenen Größen können Bild 1<br />
entnommen werden, die Gleichungen selbst werden als<br />
bekannt vorausgesetzt [7].<br />
2.1 Gespannter Grundwasserspiegel<br />
Die Mächtigkeit des Grundwasserspiegels beträgt m (m)<br />
und – falls die Absenkung im Brunnen nicht bis unter<br />
die Oberkante des GW-Leiters reicht – ist auch die Voraussetzung<br />
von D/T erfüllt, dass nämlich die GW-Strömung<br />
nur in horizontaler Richtung erfolgt.<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
= k<br />
H<br />
=<br />
(m/s) (Gl. 1)<br />
f<br />
2⋅π⋅m⋅( zr<br />
2 −z1)<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
= kfH<br />
=<br />
2⋅πr⋅m⋅( z<br />
2 2−z1)<br />
bzw. mit z 1 = H Q– s⋅<br />
ln 1 ; z<br />
r 2 = H – s 2<br />
1<br />
kf<br />
=<br />
2⋅π⋅m⋅( sr<br />
12<br />
−s2)<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
=<br />
(m/s) (Gl. 2)<br />
2⋅π⋅mr⋅( s<br />
2 1−s2)<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
=<br />
2 2<br />
Da die Grundwasserströmung π⋅( z2<br />
−r<br />
2z1<br />
)<br />
Q⋅ln<br />
stets in horizontaler Richtung<br />
erfolgt, kf<br />
= ist die r1<br />
Größe k f stets k fH , eine Beeinflussung<br />
2 2 2<br />
2<br />
durch die 2 vertikale π⋅( z z )<br />
z z H ( s<br />
)<br />
sH s s<br />
2 2<br />
− Durchlässigkeit 1 1 erfolgt 2 nicht. Der Fall<br />
2<br />
−<br />
1<br />
= ⋅ ⋅<br />
1<br />
− −<br />
2<br />
+<br />
eines gespannten GW-Spiegels 2 ⋅ wird 2 ⋅ Hdeshalb im Weiteren<br />
nicht 2<br />
2<br />
2<br />
z z<br />
2<br />
H ( s<br />
)<br />
s1<br />
sH s s<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
−<br />
verfolgt.<br />
1<br />
= 2⋅ ⋅<br />
1<br />
− −<br />
2<br />
+<br />
2 ⋅ 2 ⋅ H<br />
s1<br />
−<br />
2 ⋅H<br />
2<br />
s1<br />
s1<br />
−<br />
2s ⋅H<br />
2<br />
Bild 1. Senkungstrichter um einen Brunnen [8].<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
= k<br />
H<br />
=<br />
2⋅π⋅m⋅( z −z<br />
)<br />
2 1<br />
2.2 Freier Grundwasserspiegel<br />
r2<br />
2.2.1 Durchlässigkeitsbeiwerte<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
Kann <strong>sich</strong> kf<br />
= der GW-Spiegel im Grundwasserleiter frei<br />
2⋅π⋅m⋅( s1−s2)<br />
bewegen, lautet die Gleichung zur Erfassung des k f -<br />
Wertes<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
=<br />
(m/s)<br />
2 2<br />
π⋅( z2<br />
− z )<br />
r<br />
(Gl. 3)<br />
2<br />
1Q⋅ln<br />
r<br />
Die Darstellung<br />
kf<br />
= k<br />
H<br />
=<br />
21<br />
f der Qz-Werte, ⋅ln<br />
2⋅π⋅m⋅( zr<br />
um z. B. den Verlauf der<br />
2<br />
2<br />
2<br />
z z H ( s<br />
)<br />
sH s s<br />
2<br />
−z1)<br />
<strong>Wasser</strong>spiegellinie<br />
kf<br />
= k<br />
H<br />
=<br />
21<br />
f<br />
1<br />
2<br />
2<br />
−<br />
1<br />
⋅ über Q⋅ln<br />
2⋅π<br />
⋅m1<br />
⋅− ( zdie r in − den<br />
2<br />
+ GWMst gemessenen<br />
21<br />
−z<br />
Höhen zu verfolgen, bereitet ⋅<br />
1)<br />
kf<br />
= kfH<br />
=<br />
in diesem 2 ⋅ H<br />
2⋅πr⋅m⋅( z<br />
Fall ein Problem,<br />
2 2−z1)<br />
da die Absenkbeiträge Q⋅ln<br />
gegenüber den Höhen z relativ<br />
2<br />
s r<br />
klein sind. k 1<br />
s<br />
f<br />
=<br />
21<br />
1<br />
− Zudem Q⋅ln<br />
2⋅π⋅m⋅( s<br />
verläuft<br />
−s<br />
)<br />
ihre Darstellung in einem<br />
semilogarithmischen ⋅H<br />
r<br />
2<br />
kf<br />
=<br />
21<br />
Q⋅ln<br />
2⋅π⋅m⋅( sr<br />
Diagramm (die Höhen linear, die<br />
1−s2)<br />
Reichweiten kf<br />
= im logarithmischen Maßstab) wegen der<br />
2 2<br />
s⋅π<br />
⋅mr⋅( s<br />
Höhenquadrate<br />
2<br />
2 1−s2)<br />
s2<br />
− Q<br />
ln<br />
nicht geradlinig. Eine Lösung ist<br />
bekanntlich k 2<br />
dadurch<br />
H r<br />
1<br />
f<br />
=<br />
2<br />
Q⋅2l<br />
n<br />
2 gegeben, dass man z 1 durch H – s<br />
π⋅( z z )<br />
1<br />
2<br />
−r<br />
1<br />
und z 2<br />
kdurch f<br />
=<br />
21<br />
QH ⋅– 2l<br />
ns 2 ersetzt 2 [7]:<br />
π⋅( z2<br />
−r<br />
1z1<br />
)<br />
kf<br />
=<br />
2 2 2<br />
2<br />
2<br />
π⋅( z<br />
z z H ( s<br />
)<br />
sH s s<br />
2 2<br />
− z1<br />
)<br />
1<br />
2<br />
2<br />
−<br />
1<br />
= ⋅ ⋅<br />
1<br />
−<br />
2<br />
−<br />
2<br />
+<br />
2<br />
2<br />
2 ⋅ 2 ⋅ H<br />
z z H ( s<br />
)<br />
sH s s<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
−<br />
1<br />
= 2⋅ ⋅<br />
1<br />
− −<br />
2<br />
+<br />
2 ⋅<br />
2<br />
2 ⋅<br />
2<br />
2<br />
H<br />
Wird für z z 2 H ( s<br />
)<br />
s1<br />
s1<br />
−<br />
sH s s<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
−<br />
1<br />
= 2⋅ ⋅<br />
1<br />
− −<br />
2<br />
+<br />
2 ⋅ 2 ⋅ H<br />
2<br />
2s<br />
⋅H 1<br />
s1<br />
−<br />
2s<br />
⋅H<br />
2<br />
1<br />
s1<br />
− 2<br />
s2<br />
der Ausdruck s2<br />
−<br />
2 ⋅H<br />
2 s *<br />
2s<br />
⋅ 2H<br />
1 und für<br />
s2<br />
−<br />
2 ⋅<br />
2<br />
s2H<br />
s2<br />
−<br />
2 ⋅ H<br />
⋅<br />
f<br />
der Ausdruck s 2<br />
* eingeführt, ergibt <strong>sich</strong><br />
z 2<br />
2 – z 1<br />
2 = 2 · H · (s 1<br />
* – s 2* )<br />
Damit lautet die Gleichung 3:<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1081
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 2. Scheitel auf der Unterstromseite eines Brunnens [8].<br />
Die Darstellung der s * -Größen mit den zugehörigen<br />
2<br />
Reichweiten<br />
Q<br />
r<br />
s = r 0<br />
i im semilogarithmischen ⋅ln r−I⋅( r − ) Maßstab und<br />
ihre Verbindung 2 ⋅ π ⋅ kf<br />
⋅ ergibt H dann eine r gerade Linie, die bis<br />
zum Brunnenrand bzw. dem Rand der Absenkung weitergeführt<br />
Q<br />
r<br />
2<br />
s’<br />
werden kann. 0<br />
−I<br />
⋅ ( 1+<br />
Der Schnitt 2 π⋅kder f<br />
⋅H<strong>Wasser</strong>spiegellinie ⋅r<br />
r† )<br />
mit der Abszisse,<br />
d. h. für s = 0, ergibt die so genannte Reichweite R (siehe<br />
2<br />
Bild 1). Zu dieser Größe ist zu sagen, r0<br />
dass sie für die letzten<br />
5,0 bis 10,0 Höhenzentimeter R noch weiter reichen<br />
Q= 2⋅π⋅kf<br />
⋅HIR<br />
⋅⋅<br />
S⋅ ( 1+<br />
)<br />
2<br />
S<br />
kann. Dies wurde bei Berechnungen mit Berück<strong>sich</strong>tigung<br />
eines vertikalen<br />
2<br />
r Sickerstroms nachgewiesen [8].<br />
0<br />
RS<br />
⋅ ( 1+<br />
) = R<br />
Auf das Ergebnis 2<br />
R der k<br />
S<br />
f -Bestimmung hat dies nachgewiesenermaßen<br />
jedoch keinen Einfluss [8].<br />
= ⋅<br />
−<br />
November 2011<br />
1082 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
kf<br />
=<br />
(m/s) (Gl. 4)<br />
* *<br />
2⋅π⋅H⋅( s s )<br />
1 2<br />
kf<br />
1⋅ d1+ kf2⋅d2<br />
2.2.2 Scheitelentfernung kfH<br />
=<br />
d1+<br />
d R<br />
2<br />
s<br />
Betrachtet man den <strong>Wasser</strong>spiegelverlauf um einen<br />
Brunnen im Schnitt d ϕ = 0°, das ist entlang der x-Achse<br />
auf der kfVUnterstromseite =<br />
d1<br />
d eines Brunnens, so kann man<br />
2<br />
feststellen, dass<br />
+<br />
k es<br />
f 1<br />
k einen Punkt A gibt, von dem ab zum<br />
f 2<br />
einen Grundwasser in Richtung Brunnen fließt und zum<br />
anderen <strong>Wasser</strong> vom R Brunnen weg (Bild 2). Voraussetzung<br />
ist jedoch, Q⋅ln<br />
rdass ein Gefälle I des (ungestörten)<br />
0<br />
Grundwasserspiegels kf<br />
=<br />
2 2<br />
π⋅(<br />
H − h0<br />
)<br />
vorhanden ist, das in Richtung der<br />
x-Achse des Brunnens verläuft. Dieser Punkt A wird als<br />
Scheitelpunkt<br />
2 k<br />
bezeichnet und ist hinlänglich aus der<br />
fH<br />
Literatur κ = bekannt [z. B. 9, 10, 11]. Zur Erfassung seiner<br />
kfV<br />
Entfernung R s vom Brunnen liegen bislang nur Annahmen,<br />
jedoch keine<br />
2<br />
Lösungen vor. Da <strong>sich</strong> dieser Punkt A<br />
r0<br />
jedoch I⋅für ( r−anisotrope ) Untergrundverhältnisse als von<br />
r<br />
besonderer Bedeutung herausgestellt hat, wurde vom<br />
Autor diesem Problem nachgegangen.<br />
Die Gleichung, mit der der <strong>Wasser</strong>spiegel um einen<br />
Brunnen im Schnitt ϕ = 0° erfasst werden kann, lautet<br />
[8]:<br />
k<br />
f<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
r1<br />
=<br />
* *<br />
2⋅π⋅H⋅( s s )<br />
1 2<br />
2<br />
Q<br />
r0<br />
s = ⋅ln r−I⋅( r − )<br />
2 ⋅ π ⋅ kf<br />
⋅ H<br />
r<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
Es konnte dabei die rGröße s * durch s ersetzt werden, da<br />
1<br />
k<br />
2<br />
f<br />
=<br />
die <strong>Wasser</strong>spiegelabsenkung<br />
Q * * r0<br />
s’<br />
2⋅π⋅H⋅( sr<br />
2 −<br />
Q⋅ln<br />
−I<br />
⋅ ( 1+<br />
an<br />
2 π⋅kf<br />
⋅H⋅r<br />
r† ) der Stelle r = R s relativ<br />
1<br />
s2)<br />
weit vom Brunnen entfernt r1<br />
ist und hier s * ≈ s ist. Durch<br />
kf<br />
=<br />
* *<br />
Differenzieren 2⋅πQ<br />
von ⋅H⋅( s nach dr ergibt 2<br />
1<br />
− s2)<br />
r <strong>sich</strong>:<br />
2 0<br />
s = ⋅ln r−I⋅( r −r<br />
)<br />
0<br />
Q= 2<br />
⋅ π<br />
⋅ k<br />
f<br />
HIR ⋅⋅<br />
S⋅ ( 1+<br />
2<br />
Qf<br />
⋅ H<br />
r r)<br />
2<br />
’ = −I<br />
⋅ ( 1+<br />
R<br />
0 2<br />
Q<br />
Sr)<br />
2 ⋅ π⋅k<br />
⋅H r r 2 0<br />
s = ⋅ln r−I⋅( r − )<br />
f<br />
2 ⋅ π ⋅ k<br />
2<br />
Qf<br />
⋅ H r r<br />
2<br />
0<br />
Am Scheitelpunkt s’<br />
= r0<br />
A ist −Is’ ⋅ ( 1= +<br />
und r = R<br />
RS<br />
⋅ ( 1+<br />
) = R<br />
s . Damit erhält<br />
2 ⋅ π⋅k<br />
2 f<br />
⋅H⋅r<br />
r† )<br />
man: R<br />
2<br />
SQ<br />
r0<br />
s’<br />
= −I<br />
⋅ ( 1+<br />
2 ⋅ π⋅k<br />
2<br />
f<br />
⋅H⋅r<br />
r<br />
† )<br />
0<br />
Q= 2k⋅π<br />
⋅<br />
f 1 kdf<br />
⋅<br />
1+ HIR k⋅⋅ f2⋅dS⋅ ( 1+<br />
) (Gl. 5)<br />
2 2<br />
kfH<br />
=<br />
RS<br />
d1+<br />
d<br />
2<br />
2 r0<br />
Durch Qentsprechenden = 2⋅π⋅kf<br />
⋅HIR<br />
⋅⋅<br />
S⋅ ( Vergleich 1+<br />
)<br />
2 der Potenziale im<br />
2<br />
r<br />
RS<br />
Schnitt 0<br />
Rϕ ⋅ = + d<br />
S<br />
( 10° und ) = ϕ R = 90° hat <strong>sich</strong> ergeben [8]:<br />
kfV<br />
=<br />
2<br />
d<br />
RS<br />
1 2 d2<br />
r0+<br />
RS<br />
⋅ ( 1+<br />
k )<br />
f 1<br />
k=<br />
R<br />
2 f 2<br />
kR<br />
f 1⋅ Sd1+ kf2⋅d2<br />
kfH<br />
=<br />
Zum Potenzialvergleich d1+<br />
R<br />
d2<br />
wurde dabei angenommen,<br />
kQ1⋅ ⋅dln1+ k<br />
2⋅d<br />
dass das<br />
2<br />
k = <strong>Wasser</strong>spiegelgefälle<br />
f<br />
f<br />
r<br />
auf der Oberseite des<br />
fH<br />
0<br />
Brunnens f<br />
=<br />
2 2<br />
k =<br />
nicht<br />
d<br />
π⋅(<br />
H zu 1+<br />
− heinem d2<br />
0<br />
) Anheben des <strong>Wasser</strong>spiegels<br />
fV<br />
führt, sondern d1<br />
d2<br />
+ zu einem Eindrücken des Senkungstrichters<br />
und k auf =<br />
kf<br />
1<br />
kf<br />
2<br />
2<br />
der<br />
d<br />
Unterseite des Brunnens dementsprechend<br />
nicht<br />
fV fH<br />
κ = d1<br />
d<br />
2<br />
zu + einer Absenkung, sondern zu einer Ausbeulung<br />
des<br />
fV<br />
k<br />
Trichters.<br />
f 1<br />
kRf<br />
2<br />
Q⋅ln<br />
Wegen 2<br />
r0<br />
kf<br />
=<br />
der bei Brunnen vernachlässigbaren Größe<br />
r0<br />
2 2<br />
des Ausdrucks I⋅( r−π<br />
⋅(<br />
H)<br />
−R<br />
h0<br />
)<br />
r<br />
Q⋅lnr 02 /R 2 s kann somit ausgesagt werden,<br />
dass im<br />
r0<br />
k Falle<br />
f<br />
= eines isotropen GW-Leiters <strong>sich</strong> der <strong>Wasser</strong>spiegelscheitel<br />
π<br />
2 2<br />
2 k⋅(<br />
H − h<br />
fH an 0<br />
) der unteren Reichweitengrenze<br />
κ =<br />
einstellt. Holler kfV<br />
[12] und Bosold [13] haben mit ihren<br />
Annahmen 2 kfH<br />
κ = somit richtig gelegen. Auf die ausschließliche<br />
Gültigkeit rfV<br />
dieser Aussage für isotrope GW-Leiter ist<br />
k 2<br />
0<br />
I⋅( r−<br />
)<br />
jedoch ausdrücklich r zu verweisen.<br />
2<br />
r<br />
r<br />
0<br />
2<br />
I⋅( r−<br />
)<br />
Q<br />
⋅<br />
ln<br />
3. Anisotroper r Grundwasserleiter<br />
r<br />
1<br />
k<br />
f<br />
=<br />
* *<br />
Es wurde eingangs 2<br />
⋅ π<br />
⋅ H ⋅<br />
( s 1schon −<br />
s<br />
2<br />
) erwähnt, dass Grundwasserleiter,<br />
die von Lockergestein gebildet werden, in der<br />
2<br />
Regel in vertikaler Q Richtung einen r<br />
0 in der Kornzusam-<br />
s<br />
= ⋅ ln r − I ⋅ ( r<br />
−<br />
)<br />
mensetzung 2<br />
⋅ π<br />
⋅ wechselnden k<br />
f<br />
⋅ H Schichtaufbau r<br />
aufweisen.<br />
Die <strong>Wasser</strong>wegsamkeit in horizontaler Richtung ist<br />
2<br />
demzufolge wesentlich Q größer r als senkrecht dazu. Ist<br />
0<br />
s<br />
’<br />
= − I<br />
⋅ (<br />
1<br />
+<br />
man in der 2Lage, die Kornzusammensetzung der einzel-<br />
⋅ π⋅kf<br />
⋅H⋅r<br />
r† )<br />
nen Schichten zu bestimmen, kann der Durchlässigkeitsbeiwert<br />
bei Sanden nach 2<br />
r Beyer [14] und bei Kiesen<br />
0<br />
nach Seiler Q = 2 ⋅<br />
[15] π<br />
⋅ k ferfasst ⋅ HIR<br />
⋅⋅ Swerden. ⋅ ( 1<br />
+<br />
)<br />
2<br />
R Ist d 1 die Summe der<br />
S<br />
Schichten mit einem k f -Wert k f1 und d 2 die Summe der<br />
Schichten mit 2einem k f -Wert k f2 , so haben der mittlere<br />
r<br />
0<br />
horizontale R<br />
S<br />
⋅ (<br />
1<br />
+ k f -Wert )<br />
=<br />
R<br />
2 sowie der mittlere vertikale k f -Wert<br />
R<br />
S<br />
bekanntlich folgende Größen:<br />
k<br />
k<br />
fH<br />
fV<br />
= ⋅<br />
−<br />
k ⋅ d + k ⋅<br />
d<br />
=<br />
d<br />
+<br />
d<br />
=<br />
d<br />
k<br />
f 1 1 f2 2<br />
1<br />
f<br />
1<br />
1 2<br />
d<br />
d<br />
+<br />
k<br />
2<br />
f<br />
2<br />
R<br />
Q<br />
⋅<br />
ln<br />
r<br />
0<br />
(m/s)<br />
(m/s)
2<br />
r0<br />
RS<br />
⋅ (1+<br />
) = R<br />
2<br />
R<br />
S<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
kf<br />
1⋅ d1+ kf2⋅d2<br />
kfH<br />
=<br />
d + d<br />
1 2<br />
Fachberichte<br />
Als Beispiel können die Aufmessungen in einer<br />
11,0 m tiefen Baugrube in den Terrassenschottern im<br />
Osten von München genannt werden [8]. An den per<br />
Hand entnommenen Kiesproben wurden nach Seiler<br />
[15] folgende k f -Werte bestimmt:<br />
""<br />
Rollkies: d 1 etwa 30 % der Höhe; k f1 = 1,0 ∙ 10 –1 m/s<br />
""<br />
Sandiger Kies: d 2 etwa 70 % der Höhe;<br />
k f2 = 3,6 ∙ 10 –3 m/s<br />
Damit konnten folgende k f -Werte be<strong>rechnet</strong> werden:<br />
k fH = 3,2 ∙ 10 –2 m/s;<br />
k fV = 5,1 ∙ 10 –3 m/s<br />
Ein benachbarter Pumpversuch hat ein k fH von<br />
2,7 ∙ 10 –2 m/s sowie ein k fV von 4,7 ∙ 10 –3 m/s ergeben [8].<br />
Die Übereinstimmung der Werte ist sehr gut.<br />
3.1 Ermittlung des k fH -Wertes<br />
Es wurde bereits ausgeführt, dass in der Geohydraulik<br />
allgemein angenommen wird, dass Auswertungen von<br />
Versuchen in Brunnen, die von Messungen in GWMst<br />
begleitet waren, stets den horizontalen k f -Wert ergeben.<br />
Diese Annahme verwundert, da bei zunehmender<br />
Absenkung des Grundwasserspiegels das dem Brunnen<br />
zuströmende <strong>Wasser</strong> – zumindest in Brunnennähe – in<br />
vermehrtem Maße die weniger wasserwegsamen sandigen<br />
Kiesschichten durchfließen muss (Bild 3).<br />
Dies hat zur Folge, dass die Absenkung des<br />
<strong>Wasser</strong>spiegels nicht in dem Maße erfolgt, wie es in<br />
einem isotropen GW-Leiter der Fall wäre, d. h. er verläuft<br />
in zunehmenden Maße flacher als in einem isotropen<br />
GW-Leiter [5]. Bei der Auswertung der einzelnen<br />
<strong>Wasser</strong>spiegellagen z. B. nach Gleichung 3 hat dies zur<br />
Folge, dass <strong>sich</strong> mit zunehmender Absenkung immer<br />
größere k f -Werte ergeben, da die Differenzen der<br />
z-Werte im Nenner immer kleiner werden. Daraus kann<br />
wiederum gefolgert werden, dass bei minimaler<br />
Absenkung die Größe des k fH -Wertes erhalten wird. Da<br />
dies versuchstechnisch nicht ausführbar ist<br />
(<strong>Wasser</strong>mengenmessung, <strong>Wasser</strong>spiegelmessung) ist<br />
folgendermaßen vorzugehen:<br />
Man trägt die für die einzelnen Absenkstufen erhaltenen<br />
k f -Werte in Abhängigkeit vom zugehörigen s 0* -<br />
Wert im semilogarithmischen Maßstab auf und verlängert<br />
die Linien, die man durch die Verbindung der Versuchspunkte<br />
erhält, bis zur Abszisse, also bis zur<br />
Ordinate s 0<br />
* = 0. Der Schnittpunkt ergibt den k fH -Wert<br />
(Bild 4).<br />
Es kann somit nochmals festgehalten werden, dass<br />
die aus Pumpversuchen bestimmten k f -Werte<br />
Mischwerte sind, die zum größeren Teil aus dem k fH -<br />
Wert und mit zunehmender Absenkung in zunehmendem<br />
Maße vom k fV -Wert bestimmt werden.<br />
Bei der Auswertung einer Vielzahl von Pumpversuchen<br />
ist noch folgende Besonderheit aufgefallen: Setzt<br />
man in Gleichung 3 folgende Werte ein:<br />
d<br />
rk<br />
1 fV<br />
= r 0 ; z 1 = h 0 ; r 2 = R; z 2 = H<br />
d1<br />
d2<br />
+<br />
kf<br />
1<br />
kf<br />
2<br />
so erhält man:<br />
R<br />
Q⋅ln<br />
r<br />
kf<br />
=<br />
(m/s) (Gl. 6)<br />
2<br />
π⋅(<br />
H − )<br />
0<br />
2<br />
h0<br />
Es hat <strong>sich</strong> gezeigt, dass man mit hinreichender Genauigkeit<br />
hiermit κ = den Wert k fH erhält. Man kann daraus den<br />
2 kfH<br />
Schluss ziehen,<br />
kfV<br />
dass <strong>sich</strong> der <strong>Wasser</strong>spiegel im Brunnen<br />
so einstellt, als ob isotrope Verhältnisse im GW-Leiter<br />
2<br />
vorliegen. r0<br />
I⋅( r−Diese ) Tatsache erklärt auch mit, dass vermittels<br />
der D/T-Gleichungen r<br />
die Förderwassermengen relativ<br />
genau erhalten werden [16, 17, 18, 19, 20].<br />
Werden weitere als die aus den Versuchen erhaltenen<br />
k f -Werte benötigt, z. B. zur Berechnung von Förderwassermengen,<br />
können sie entweder aus Bild 4 entnommen<br />
werden oder mit folgender Gleichung be<strong>rechnet</strong><br />
werden [8]:<br />
k f = k fH + d 1 · (s 0* ) ß (Gl. 7)<br />
Die Größen d 1 und β können hierzu aus zwei Versuchswerten<br />
eines Pumpversuchs bestimmt werden.<br />
Bild 3. Brunnenzustrom in geschichteten GW-Leitern.<br />
Bild 4. Ermittlung des k fH -Wertes.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1083
R S<br />
2<br />
kf<br />
1⋅ d1+ kf2⋅d2<br />
kfH<br />
=<br />
FachberichtE d1+<br />
d2<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
d<br />
kfV<br />
=<br />
d1<br />
d2<br />
3.2 Vertikaler + Durchlässigkeitsfaktor k<br />
k<br />
fV<br />
f 1<br />
kf<br />
2r2<br />
Aus Pumpversuchsdaten Q⋅ln<br />
kann diese Größe nicht unmittelbar<br />
kbestimmt f<br />
r1<br />
= werden, da die D/T-Gleichungen sie<br />
R * *<br />
2⋅ nicht berück<strong>sich</strong>tigen. Q<br />
π⋅ H<br />
ln<br />
⋅( s1 − s2)<br />
Daher muss auf den Anisotropiefaktor<br />
kκ f zurückgegriffen =<br />
r0<br />
2 2 werden, der folgendermaßen<br />
π⋅(<br />
H − h0<br />
)<br />
2<br />
definiert ist:<br />
Q<br />
r0<br />
s = ⋅ln r−I⋅( r − )<br />
2 ⋅ π ⋅ kf<br />
⋅ H<br />
r<br />
2 kfH<br />
κ =<br />
k<br />
2<br />
fV Q<br />
r0<br />
s’<br />
= −I<br />
⋅ ( 1+<br />
Näheres hierzu 2 ⋅ π⋅kist f<br />
⋅Hin ⋅r<br />
der Veröffentlichung r† )<br />
von Lohr zu<br />
2<br />
finden<br />
r0<br />
I[1]. ⋅( r−Ist also ) der κ-Wert bekannt, kann sofort der<br />
k r<br />
2<br />
fV -Wert ermittelt werden. r0<br />
Q= 2⋅π⋅kf<br />
⋅HIR<br />
⋅⋅<br />
S⋅ ( 1+<br />
)<br />
2<br />
Für eine Aussage über die RGröße S<br />
des κ-Wertes wird<br />
wieder der Schnitt ϕ = 0° unterhalb eines Brunnens<br />
betrachtet. Bei<br />
2<br />
r einem isotropen GW-Leiter fallen – wie<br />
0<br />
R<br />
ausgeführt<br />
S<br />
⋅ ( 1+<br />
) = R<br />
– Scheitel 2<br />
R und Ende des Senkungstrichters<br />
S<br />
zusammen. Berechnungen von eingemessenen Senkungstrichtern<br />
k und Reichweitenentwicklungen unter<br />
f 1⋅ d1+ kf2⋅d2<br />
der Voraussetzung<br />
kfH<br />
=<br />
d isotroper Untergrundverhältnisse<br />
1+<br />
d2<br />
haben ergeben, dass die Reichweiten R der Versuchsstadien<br />
wesentlich d größer waren, als sie <strong>sich</strong> aus den<br />
Berechnungen kfV<br />
=<br />
d ergeben haben. Dies zeigt, dass bei<br />
1<br />
d2<br />
anisotropen Untergrundverhältnissen<br />
+<br />
k<br />
die Reichweitenentwicklung<br />
wesentlich weiter geht, als dies bei isotro-<br />
f 1<br />
kf<br />
2<br />
pen Verhältnissen Rder Fall wäre (Bild 3). Das Bemerkenswerte<br />
ist, dass Q⋅dabei ln<br />
r die Scheitelentfernung R s in Richtung<br />
Brunnen kf<br />
= zurückweicht, 2 2<br />
0<br />
π⋅(<br />
H − h<br />
also kleiner wird als im<br />
0<br />
)<br />
isotropen GW-Leiter.<br />
In Bild 5 wurden für verschiedene Reichweiten R<br />
2 kfH<br />
sowie κzwei = verschiedene Gefällewerte I (6 ‰; 3 ‰)<br />
kfV<br />
durch Abtrag der Größe<br />
2<br />
r0<br />
I⋅( r−<br />
)<br />
r<br />
Bild 5. Scheitelentwicklung bei variablen Reichweiten [8].<br />
November 2011<br />
1084 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong><br />
die zugehörigen Scheitel konstruiert. Wie zu erkennen<br />
ist, wandern sie mit zunehmender Verflachung der <strong>Wasser</strong>spiegellinie<br />
in Richtung Brunnen bzw. liegen bei größeren<br />
Gefällen I näher am Brunnen. Da die Reichweite R<br />
aber offen<strong>sich</strong>tlich vom Grad der Anisotropie bestimmt<br />
wird, d. h. je größer die Anisotropie ist, desto größer ist<br />
die Reichweite, kann somit über die Scheitellage mit<br />
deren Abstand R s vom Brunnen auf die Größe der Anisotropie<br />
geschlossen werden und damit unmittelbar auf<br />
den κ-Wert.<br />
Zur analytischen Erfassung der Absenkstufe in einem<br />
Pumpversuch müssen somit die Reichweitengrößen so<br />
„gestaucht“ werden, dass sie isotropen Verhältnissen<br />
entsprechen. Dann genügen sie wieder der Voraussetzung<br />
der D/T-Gleichung. x<br />
Lohr hat ausführlich aufgezeigt,<br />
wie dabei vorgegangen<br />
x’<br />
= x<br />
x’<br />
κ=<br />
werden muss [1]. Es ist zu<br />
setzen: κ<br />
x<br />
x’<br />
= y<br />
κx<br />
y’<br />
= y<br />
x’<br />
= ; y’<br />
κ=<br />
; z’ = z<br />
κ κ<br />
y<br />
y’<br />
=<br />
2 2<br />
bzw. κ x y r<br />
yr<br />
’ =<br />
y’<br />
= x+ 2<br />
y=<br />
2<br />
r; z’ = z<br />
2 2<br />
κ<br />
r’<br />
= κ κ+ κ=<br />
2 2<br />
2 2<br />
κ κ κ<br />
x y r<br />
Werden r’<br />
= die Ausdrücke + =<br />
2<br />
2 κ ⋅r2<br />
r<br />
κx κy Q⋅κ<br />
nun in die Gleichung 2 4 eingesetzt,<br />
so r’<br />
= wird<br />
rln<br />
κ ⋅r<br />
Q⋅ln<br />
2<br />
r<br />
2<br />
*<br />
erhalten: + =<br />
2 * 2<br />
Q⋅κln⋅<br />
r1<br />
Q⋅rln<br />
1<br />
sκ1 − sκ κ<br />
*<br />
2<br />
=<br />
*<br />
κ ⋅=<br />
r1<br />
r1<br />
s1 − s2κ2<br />
=<br />
⋅πr<br />
⋅kf<br />
⋅H<br />
2=<br />
⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
2<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
⋅π⋅kQf<br />
⋅⋅Hln<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
* *<br />
κ<br />
⋅<br />
r1<br />
2<br />
r1<br />
s<br />
2<br />
1<br />
− s2<br />
= Q⋅ln<br />
= Q⋅ln<br />
1<br />
*<br />
* *<br />
κ<br />
r<br />
Q r<br />
1<br />
r2<br />
r<br />
1 2<br />
1<br />
s1 − s<br />
s1 2<br />
=<br />
−<br />
2<br />
s<br />
⋅*<br />
π<br />
*<br />
2<br />
=<br />
⋅k<br />
⋅<br />
f<br />
⋅H<br />
2⋅π<br />
κ<br />
s<br />
= Q⋅<br />
⋅ ln<br />
⋅kf<br />
⋅H<br />
=<br />
*<br />
r IR ⋅ ⋅ln<br />
2<br />
r<br />
κ 2<br />
21⋅− πs⋅2k<br />
2=<br />
⋅<br />
f<br />
π<br />
H<br />
⋅kf<br />
2<br />
⋅H<br />
k<br />
⋅π<br />
H<br />
⋅k⋅ rln<br />
1<br />
f<br />
⋅H<br />
= IR ⋅ ⋅rln<br />
1<br />
Die Gleichung bleibt also 2⋅π⋅unverändert. f<br />
⋅<br />
1r1<br />
Nun wird r1<br />
für Q<br />
* *<br />
Q⋅<br />
r2<br />
r<br />
κ 2<br />
der in sGleichung 1<br />
− s2<br />
= *<br />
s<br />
5 angegebene 1 ⋅ ln = IR ⋅ Ausdruck ⋅ln<br />
eingesetzt<br />
02<br />
⋅π<br />
1<br />
* *<br />
* Q⋅<br />
1<br />
2<br />
κ 2<br />
s1 − s2<br />
= s0<br />
⋅ ln = IR ⋅ ⋅ln<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
r1<br />
r1<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
I ⋅ln R =<br />
⋅k<br />
Rf<br />
κ⋅<br />
H r1<br />
r1<br />
unter Berück<strong>sich</strong>tigung der angegebenen Beziehung<br />
= R<br />
R s ∙ (1 + r 02 /R<br />
* S2 ) =<br />
r<br />
R:<br />
s x 1<br />
0<br />
x’<br />
= 0<br />
r0<br />
*<br />
1<br />
I ⋅ln s<br />
R<br />
κ<br />
κ<br />
= R<br />
Q = 0 2 ·<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
p<br />
R<br />
·<br />
ln<br />
k f R<br />
· H · I · R<br />
r0κ<br />
=<br />
y lnR<br />
r<br />
κln=<br />
A<br />
Die Größe y’<br />
= R 0 lnA<br />
ln κ<br />
ist nun eine Reichweitengröße, die entsprechend<br />
κmodifiziert =<br />
1<br />
R<br />
Q<br />
werden muss. Unter Ansatz der Theorie<br />
der R<br />
κ 1<br />
κ<br />
konformen<br />
lnA<br />
Q = R = A<br />
x 2 2<br />
2⋅π⋅k<br />
H I κ<br />
f<br />
⋅<br />
Abbildungen<br />
⋅<br />
wurde gefunden, dass<br />
= R = A<br />
nicht die rx<br />
x y r<br />
’’<br />
=<br />
Größe lnA<br />
2+ ⋅R/κ, π⋅k=<br />
κ 2 2 sondern<br />
f<br />
⋅H⋅I<br />
der Ausdruck R 1/κ anzusetzen<br />
ist [8]. Damit ist: κ<br />
1<br />
Qκ κ κ<br />
= R<br />
1<br />
= A<br />
2⋅π⋅k<br />
Qln f<br />
⋅κ<br />
H=<br />
⋅I<br />
y<br />
κ<br />
R = 1<br />
ln κc=<br />
c sA*<br />
0+ 1⋅<br />
0<br />
2<br />
y’<br />
⋅<br />
= κ ⋅r2<br />
r<br />
Q π2 ⋅k· f p ⋅H· k⋅I<br />
*<br />
f · H c· I<br />
0+ · cR 1/k 1⋅s<br />
(m 3 2<br />
κ<br />
Q⋅ln<br />
Q⋅ln/s) 0<br />
1<br />
(Gl. 8)<br />
* *<br />
κ ⋅r1<br />
r1<br />
ln s1κ− = s2<br />
= =<br />
k *<br />
fH<br />
kc<br />
2<br />
0+ ⋅<br />
1<br />
fV<br />
= cπ<br />
1 ⋅skf<br />
⋅H<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
Durch Einsetzen 2 in 2<br />
ln κ =<br />
k0<br />
x fH<br />
k κ<br />
y die rD/T-Gleichung wird erhalten:<br />
r’<br />
= *<br />
c0 + fVc = 0<br />
1⋅s<br />
=<br />
2 2 2<br />
κ κ κ0<br />
0<br />
1<br />
k Q⋅<br />
κ<br />
* *<br />
r<br />
fH<br />
2<br />
r<br />
κ 2<br />
ks1 −<br />
fV<br />
= s2<br />
= ⋅ ln = IR ⋅ ⋅ln<br />
(Gl. 9)<br />
2<br />
1<br />
lk<br />
κ 2⋅π⋅k<br />
nfH<br />
0<br />
f<br />
⋅H<br />
r1<br />
r1<br />
κ=<br />
kfV<br />
=<br />
κ ⋅r2<br />
1 * r2<br />
2l nQ<br />
κ= ⋅1176 ln, + 045 , Q⋅⋅<br />
sln<br />
0<br />
Zur Ermittlung κ des *<br />
0 1176 , κ-Wertes + 045 , ⋅wird s Schnitt ϕ = 90°<br />
* * * 1<br />
κ ⋅r1<br />
r1<br />
0<br />
betrachtet:<br />
s1s− s<br />
0 2<br />
= 1 =<br />
l nκ=<br />
−3<br />
−3<br />
6310 ,<br />
1<br />
⋅ * 6310 , ⋅<br />
−3<br />
−3<br />
−3<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
2R<br />
⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
l nκ=<br />
k<br />
1176 ,<br />
fV<br />
=<br />
+ 045 , ⋅s<br />
6310<br />
⋅ = 0<br />
6310 , ⋅ = 11510 , ⋅<br />
2<br />
r<br />
−3<br />
s * 0<br />
*<br />
1176 , k fV<br />
= +<br />
234<br />
045<br />
,<br />
, , ⋅<br />
= 548 ,<br />
2 = 0; r 2 = R; s * = 11510 , ⋅<br />
2<br />
234 1 = s 0* ; r<br />
0 1 = r<br />
−3<br />
−3<br />
548 0 1<br />
* *<br />
Q⋅<br />
r2<br />
, r<br />
κ 2<br />
s1 − s26310<br />
= , ⋅ 6310 , ⋅ ln⋅<br />
= IR ⋅ ⋅ln<br />
−3<br />
k fV<br />
= lnR<br />
2⋅π⋅k=<br />
= 11510 , ⋅<br />
2 f<br />
⋅H<br />
r1<br />
r1<br />
Damit −3<br />
−3<br />
κwird:<br />
= 6310 , 234 , ⋅ 6310 , 548 , ⋅<br />
−3<br />
k fV<br />
= lnA<br />
= = 11510 , ⋅<br />
2<br />
*<br />
s 234 , 1 548 ,<br />
0<br />
1<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
= R (Gl. 10)<br />
Q<br />
κ<br />
= R = A<br />
2⋅π⋅r<br />
0k<br />
⋅H⋅I<br />
f<br />
R 1<br />
ln κ = κ =<br />
ln<br />
ln<br />
*<br />
cA<br />
+ c ⋅s<br />
0 1 0
2⋅π⋅kκ<br />
⋅<br />
f<br />
rH2<br />
2⋅π⋅kr<br />
f 2⋅<br />
H<br />
Q⋅ln<br />
Q⋅ln<br />
* *<br />
κ ⋅r1<br />
r1<br />
s1 − s2<br />
= =<br />
1<br />
2⋅πQ⋅k<br />
* *<br />
⋅f<br />
⋅H<br />
2r<br />
⋅π⋅k<br />
2 f<br />
⋅H<br />
r<br />
κ 2<br />
s1 − s2<br />
= ⋅ ln = IR ⋅ ⋅ln<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
r1<br />
r1<br />
1<br />
* *<br />
Q⋅<br />
r2<br />
r<br />
κ 2<br />
s1 − s<br />
*<br />
2<br />
= ⋅ ln = IR ⋅ ⋅ln<br />
1<br />
s 2⋅π⋅k<br />
0<br />
Bezeichnet I ⋅ln R<br />
κ<br />
f<br />
⋅H<br />
r1<br />
r1<br />
= R<br />
man R 1/κ mit A, so wird mit dem aus dem<br />
*<br />
1<br />
s0<br />
r0<br />
Auftrag der Versuchsergebnisse ermittelten R erhalten:<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
= R<br />
ln r0<br />
R<br />
κ = (Gl. 11)<br />
lnA<br />
lnR<br />
Eine weitere κ = Möglichkeit 1 zur Berechnung von κ ergibt<br />
lnQ<br />
A<br />
κ<br />
<strong>sich</strong> aus dem Term = für R die = AFörderwassermenge Q:<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H⋅I<br />
x<br />
1<br />
x’<br />
= Q<br />
κ<br />
= R = A<br />
2⋅π⋅ κ<br />
(Gl. 12)<br />
kf<br />
⋅H⋅1<br />
I<br />
ln κ =<br />
*<br />
c0+ c1⋅s<br />
Über Gleichung y 11<br />
0ist damit ebenfalls der κ-Wert zu<br />
y’<br />
= 1<br />
bestimmen. ln κ = κx<br />
*<br />
x’<br />
= kcfH<br />
0+ c1⋅s<br />
Es ist<br />
0<br />
k nun<br />
fV<br />
= κ zu vermuten, dass der κ-Wert keine Konstante<br />
ist, sondern<br />
2<br />
κ<br />
02<br />
<strong>sich</strong><br />
2<br />
x y wie r die k f -Werte mit dem Absenkvorgang<br />
r’<br />
= kfH<br />
k verändert.<br />
fV<br />
y<br />
+<br />
Zu<br />
=<br />
2 2 erwarten ist, dass er kleiner wird,<br />
y’<br />
= κ2<br />
κ κ<br />
da in zunehmendem 0<br />
1<br />
l nκ=<br />
κ Maße die sandigen Kiesschichten<br />
*<br />
den Absenkvorgang 1176 , + 045<br />
κ<br />
,<br />
⋅rbeeinflussen. ⋅s0<br />
Eine Vielzahl von<br />
2<br />
r2<br />
2<br />
Q⋅ln2<br />
1 Q⋅ln<br />
Pumpversuchen, l nκ=<br />
x ydie entsprechend ausgewertet wurden<br />
[8], 6310 1176 =<br />
, +<br />
* *<br />
κ ⋅<br />
r1<br />
r<br />
−3<br />
* 1<br />
rs’<br />
= − s<br />
−3<br />
⋅ + 045 =<br />
1 , 6310 , ⋅s0⋅<br />
−3<br />
k<br />
hat<br />
2<br />
fV<br />
=<br />
diese<br />
2<br />
Annahme<br />
2<br />
=<br />
κ 2⋅κπ<br />
⋅k=<br />
bestätigt.<br />
f<br />
⋅κH<br />
2⋅π⋅k= f 11510 ⋅,<br />
H ⋅<br />
2<br />
Trägt man 234 , die κ-Werte 548 , über die zugehörigen s 0* -<br />
−3<br />
−3<br />
Werte 6310 , ⋅ 6310 , ⋅<br />
−3<br />
k<br />
in<br />
fV<br />
=<br />
ein Diagramm Qκ<br />
=<br />
ein, kann 1<br />
⋅ ⋅r2<br />
r =<br />
r<br />
11510 2,<br />
eine<br />
⋅<br />
Versuchskurve<br />
* * 2<br />
2<br />
r2<br />
gezeichnet s1 − s2werden, =<br />
Q⋅ln<br />
κ<br />
234 , die man ⋅ 548 ln<br />
Q<br />
, entsprechend =<br />
⋅ln<br />
IR ⋅ ⋅ln<br />
bis zur Abszisse<br />
weiterführen 2⋅π⋅kkann. Es hat <strong>sich</strong> gezeigt, dass es<br />
* * 2⋅π⋅k<br />
κ ⋅<br />
f<br />
r<br />
H1<br />
r<br />
r1<br />
s<br />
r<br />
1<br />
− s2<br />
= = 1<br />
1<br />
f<br />
⋅H<br />
2⋅π⋅kf<br />
⋅H<br />
dabei von<br />
*<br />
Vorteil 1 ist, wenn die κ-Werte im natürlichen<br />
s0<br />
Logarithmus (ln κ) aufgetragen werden, da dies die Versuchskurve<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
= R<br />
1<br />
* *<br />
Q⋅<br />
r2<br />
r<br />
κ 2<br />
s1 − s2<br />
strafft.<br />
=<br />
Ein Beispiel<br />
⋅ ln =<br />
findet<br />
IR ⋅ ⋅ln<br />
<strong>sich</strong> in Bild 6.<br />
r 2⋅π⋅k<br />
0<br />
f<br />
⋅H<br />
r1<br />
r1<br />
Die Weiterführung der Versuchskurve bis zum<br />
Schnittpunkt * mit 1 der Abszisse ergibt den κ 0 -Wert. Er hat<br />
s0lnR<br />
eine horizontale κ = Strömung im Grundwasserleiter zur<br />
lnA<br />
Voraussetzung. I ⋅ln R<br />
κ<br />
= R<br />
r0<br />
Auch für die Größe 1 κ kann eine Gleichung angegeben<br />
werden, die es = dann R = Aermöglicht, den Wert für eine<br />
Q<br />
κ<br />
2⋅πln<br />
⋅kR<br />
f<br />
⋅H⋅I<br />
beliebige κ = Absenkgröße s<br />
* 0 zu berechnen:<br />
lnA<br />
1<br />
ln κ =<br />
1<br />
Q<br />
(Gl. 13)<br />
*<br />
c0+ c1⋅s0<br />
κ<br />
= R = A<br />
2⋅π⋅k<br />
Für s * f<br />
⋅H⋅I<br />
0 = 0 wird aus der Gleichung c 0 erhalten und für ein<br />
kfH<br />
beliebiges kfV<br />
= Wertepaar s<br />
2<br />
0* , κ kann die Gleichung nach c 1<br />
aufgelöst werden.<br />
κ 1<br />
ln κ = 0 Mit<br />
*<br />
bekanntem κ 0 -Wert kann dann<br />
c0+ c1⋅s0<br />
auch der k fV -Wert be<strong>rechnet</strong> werden:<br />
1<br />
l nκ=<br />
k<br />
*<br />
1176 fH<br />
k , + 045 , ⋅s0<br />
fV<br />
= (Gl. 14)<br />
2<br />
κ<br />
0<br />
−3<br />
−3<br />
6310 , ⋅ 6310 , ⋅<br />
−3<br />
k fV<br />
= = = 11510 , ⋅<br />
2<br />
l n 234 ,<br />
1<br />
4. Folgerungen κ=<br />
548 ,<br />
*<br />
Die Auswertung<br />
1176 , +<br />
zahlreicher<br />
045 , ⋅s0<br />
Pumpversuche, die in<br />
Lockergesteinsgrundwasserleitern ausgeführt worden<br />
−3<br />
−3<br />
waren, 6310 , ⋅ 6310 , ⋅<br />
−3<br />
khat fV<br />
= ergeben, dass = die – wie = 11510 , üblich ⋅ – mit den D/T-<br />
2<br />
Gleichungen 234 be<strong>rechnet</strong>en , 548 , Durchlässigkeitsbeiwerte k f<br />
mit zunehmender Absenkung des <strong>Wasser</strong>spiegels um<br />
den Brunnen auch zunehmend größer werden, bedingt<br />
durch den zunehmenden Einfluss der kleineren vertikalen<br />
Durchlässigkeit. Auf das Beispiel in Abschnitt 6 kann<br />
dazu verwiesen werden. Zur Ermittlung des tatsächlichen<br />
horizontalen Durchlässigkeitsbeiwertes muss deshalb,<br />
wie ausgeführt, die Verbindungskurve durch die<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Bild 6. κ-Werte eines Pumpversuchs.<br />
Fachberichte<br />
er<strong>rechnet</strong>en Versuchspunkte bis zur Abszisse, d.h. bis<br />
zur Absenkung s 0 bzw. s 0<br />
* = 0, extrapoliert werden. Dies<br />
ergibt den Wert k fH . Dann kann Gleichung 7 aufgestellt<br />
werden. Es wurde ferner festgestellt, dass die Anisotropiefaktoren<br />
κ dagegen mit zunehmender Absenkung<br />
abnehmen. Der für die Ermittlung von Gleichung 13<br />
erforderliche κ 0 -Wert wird in gleicher Weise durch Extrapolation<br />
der κ-Werte bis zur Abszisse erhalten. Damit<br />
kann Gleichung 13 aufgestellt werden.<br />
Soll nun der Absenktrichter um einen Brunnen sowie<br />
die dabei geförderte <strong>Wasser</strong>menge mit den<br />
D/T-Gleichungen be<strong>rechnet</strong> werden, ist für die vorzugebende<br />
Randabsenkung s 0 bzw. s 0<br />
* der entsprechende<br />
k f -Wert über Gleichung 7 zu ermitteln. Anschließend<br />
wird über Gleichung 13 der zugehörige κ-Wert<br />
bestimmt. Über Gleichung 10 kann dann die Reichweite<br />
R be<strong>rechnet</strong> werden. Damit wird über Gleichung 9 der –<br />
tatsächliche – <strong>Wasser</strong>spiegelverlauf und über Gleichung<br />
8 die dabei geförderte <strong>Wasser</strong>menge erhalten. Sobald<br />
also die Gleichungen zur Berechnung der k f - und<br />
κ-Werte aufgestellt sind, kann ein beliebiger Senkungstrichter<br />
um einen Brunnen sowie die geförderte <strong>Wasser</strong>menge<br />
rasch be<strong>rechnet</strong> werden. Schließlich ist noch<br />
darauf zu verweisen, dass es mit Kenntnis der Größen κ<br />
und κ 0 eines Absenkversuches möglich ist, <strong>Wasser</strong>stände<br />
h am Brunnenrand in die <strong>Wasser</strong>spiegelhöhen h 0 im<br />
Brunnen umzurechnen. Hierzu kann auf die Veröffentlichung<br />
von Schneider [8] verwiesen werden.<br />
Sind dagegen entsprechende numerische Berechnungen<br />
vorgesehen, sind nur die Größen k fH sowie κ 0<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1085
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Die Neigung des ungestörten Grundwasserspiegels<br />
im betreffenden Gelände wurde zu I = 2,9 ∙ 10 –3<br />
bestimmt. Die Mächtigkeit H des Grundwasserleiters,<br />
der ausschließlich von würmeiszeitlichen Niederterrassenschottern<br />
gebildet wird, wurde mit 13,15 m festgestellt.<br />
Der Brunnen wurde als vollkommener Brunnen<br />
ausgebaut mit einem Bohrdurchmesser von 0,95 m, d. h.<br />
r 0 hat 0,475 m betragen. Folgende drei Absenkstufen<br />
wurden gefahren: x<br />
x’<br />
=<br />
κ<br />
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
S Br (m) y 1,120 2,125 2,810<br />
y’<br />
=<br />
Q (m³/s) κ 0,075 0,125 0,160<br />
Bild 7. <strong>Wasser</strong>spiegelabsenkungen s * im Brunnen DB2621 [8].<br />
erforderlich, denn der für die Berechnungen benötigte<br />
k fV -Wert wird aus der Beziehung k fV = k fH /κ 0 ² erhalten. Es<br />
ist jedoch festzuhalten, dass diese Berechnungsmöglichkeit<br />
zeitaufwändiger und kostenintensiver ist als die<br />
vorgehend aufgeführte. Sie bietet <strong>sich</strong> jedoch an, wenn<br />
z. B. lineare Strömungsvorgänge unter Staudämmen,<br />
Wehren oder Schleusen erfasst werden sollen.<br />
5. Durchführung von Pumpversuchen<br />
An die Durchführung von Pumpversuchen sind gewisse<br />
Anforderungen zu stellen, damit eine hinreichend<br />
zuverlässige Auswertung der Versuchsdaten möglich<br />
wird:<br />
""<br />
Es ist ein Versuchsbrunnen niederzubringen sowie<br />
wenigstens drei Grundwassermessrohre zur Beobachtung<br />
des Grundwasserspiegels.<br />
""<br />
Nach den Erfahrungen ist es dabei nicht erforderlich,<br />
dass der Brunnen als vollkommener Brunnen, d. h.<br />
bis zum Stauer reichend, ausgeführt wird. Aussagen<br />
über die <strong>Wasser</strong>wegsamkeit des GW-Leiters sind<br />
dann aber nur bis zur Brunnenunterkante möglich.<br />
""<br />
Der Brunnenwasserspiegel ist laufend einzumessen.<br />
""<br />
Die erste GWMst sollte wenigstens 1,5 H (m) vom<br />
Brunnen entfernt angeordnet werden. Damit liegt<br />
sie außerhalb der stärksten Krümmung der Stromfäden,<br />
die <strong>sich</strong> in Brunnennähe einstellt. Die Bohrtiefe<br />
der GWMst spielt damit auch eine untergeordnete<br />
Rolle.<br />
""<br />
Es sind drei Absenkstufen vorzusehen,<br />
so z. B. s Br = 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m<br />
""<br />
Jede Absenkstufe sollte bis zum Eintritt der<br />
Beharrung gefahren werden.<br />
6. Beispiel<br />
Die Anwendung der angegebenen Gleichungen wird an<br />
einem Beispiel gezeigt. Der Pumpversuch wurde an<br />
dem Brunnen DB2621 durchgeführt, der im Zuge der<br />
geplanten Untertunnelung des Rangierbahnhofs im<br />
Münchner Norden ausgeführt worden ist.<br />
2 2<br />
Die in 12 GWMst x y gemessenen r<br />
<strong>Wasser</strong>stände sind in<br />
r’<br />
= + =<br />
2 2<br />
Bild 7 im semilogarithmischen κ κ κ Maßstab als Werte s * in<br />
Abhängigkeit vom Brunnenabstand r dargestellt.<br />
Folgende Reichweitenwerte κ ⋅r<br />
R bzw. Absenkungen s<br />
*<br />
2<br />
r2<br />
Q⋅ln<br />
Q⋅ln<br />
0<br />
am Brunnenrand * * (r 0<br />
κ= ⋅r1<br />
0,475 m) können r1<br />
daraus abgelesen<br />
werden: 2⋅π⋅k<br />
⋅H<br />
2⋅π⋅k<br />
⋅H<br />
s1 − s2<br />
= =<br />
f<br />
Stufe 1 Stufe 1 2 Stufe 3<br />
* *<br />
Q⋅<br />
r2<br />
r<br />
κ 2<br />
R (m) s1 − s2<br />
= 900,0 ⋅ ln = IR ⋅1160,0 ⋅ln<br />
2⋅π⋅k<br />
H<br />
1280,0<br />
f<br />
⋅ r1<br />
r1<br />
s * 0 (m) 0,73 1,16 1,38<br />
*<br />
1<br />
s0<br />
Mit Hilfe der Gleichungen 10 bzw. 11 können dann<br />
folgende I ⋅lnWerte R<br />
κ<br />
= R<br />
r<br />
R 1/κ bzw. κ be<strong>rechnet</strong> werden:<br />
0<br />
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
lnR<br />
R 1/κ = A κ(m) = 33,490 51,280 60,240<br />
lnA<br />
κ 1,937 1,792 1,746<br />
1<br />
Q<br />
κ<br />
Die κ-Werte sind = in R Bild = A<br />
2⋅π⋅k<br />
8 dargestellt, zur größeren<br />
f<br />
⋅H⋅I<br />
Anschaulichkeit zusammen mit den Werten, die aus<br />
einem weiteren,<br />
1<br />
etwa 470 m entfernten Brunnen<br />
DB2629 ln erhalten κ = worden * sind.<br />
c0+ c1⋅s0<br />
Die Weiterführung der Kurve bis zur Abszisse ergibt<br />
ein ln κ 0 von 0,85. Damit ist κ 0 = 2,34. Die Gleichung, die<br />
kfH<br />
<strong>sich</strong> aus kfV<br />
den =<br />
2gemessenen Werten sowie dem κ 0 -Wert<br />
κ<br />
0<br />
aufstellen lässt, lautet:<br />
1<br />
l nκ=<br />
1176 , + 045 , ⋅s<br />
*<br />
0<br />
−3<br />
−3<br />
Mit Gleichung<br />
6310 , ⋅ 6310 , ⋅<br />
k fV<br />
= 12 können = die Durchlässigkeitsbeiwerte<br />
−3<br />
= 11510 , ⋅<br />
2<br />
ermittelt werden, 234 , wenn nach 548 , k f aufgelöst wird:<br />
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
k f (m/s) 0,0093 0,01017 0,01108<br />
Die Darstellung der k f -Werte ist – wiederum mit den<br />
Ergebnissen aus Brunnen DB2629 – in Bild 9 zu finden.<br />
Durch Weiterführung der Verbindungslinie bis zur<br />
Abszisse wird ein k fH von 6,3 ∙ 10 –3 (m/s) erhalten. Mit<br />
den gemessenen Werten sowie mit der Größe k fH kann<br />
dann folgende Gleichung aufgestellt werden:<br />
f<br />
November 2011<br />
1086 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
f<br />
f<br />
s<br />
1<br />
Q⋅<br />
r2<br />
r<br />
κ 2<br />
− s = ⋅ ln = IR ⋅ ⋅ln<br />
2⋅π⋅k<br />
⋅H<br />
r r<br />
* *<br />
1 2<br />
f<br />
*<br />
1<br />
s0<br />
I ⋅ln R<br />
κ<br />
= R<br />
k f = 6,3 · 10 –3 + 3,7 · 10 –3 · s * 0,78 r<br />
0 (m/s)<br />
0<br />
Zum Vergleich lnR<br />
sollen noch mit Gleichung 6 die k fH -<br />
Werte<br />
κ<br />
be<strong>rechnet</strong><br />
=<br />
lnA<br />
werden. Es ist:<br />
Stufe 1 1 Stufe 2 Stufe 3<br />
Q<br />
κ<br />
h 0 (m) = 12,3 R = A<br />
2⋅π⋅k<br />
H I<br />
11,025 10,34<br />
f<br />
⋅ ⋅<br />
R (m) 900,0 1160,000 1280,00<br />
k fH (m) 16,39 ∙ 10 –3 6,03 ∙ 10 –3 6,09 ∙ 10<br />
ln κ =<br />
–3<br />
*<br />
c0+ c1⋅s0<br />
Als Mittelwert ergibt <strong>sich</strong> ein k fH von 6,2 ∙ 10 –3 m/s. Dieser<br />
Wert stimmt k sehr gut mit dem Abszissenwert von 6,3<br />
∙ 10 –3 fH<br />
m/s kfV<br />
= überein, 2<br />
κ<br />
so dass die mit Gleichung 6 be<strong>rechnet</strong>en<br />
Größen einen guten Hinweis auf die Größe von<br />
0<br />
k fH geben.<br />
1<br />
Mit l neinem κ= κ 0 von 2,34 sowie einem k fH von 6,3 ∙ 10 –3<br />
*<br />
1176 , + 045 , ⋅s0<br />
m/s kann schließlich der k fV -Wert be<strong>rechnet</strong> werden:<br />
k fV<br />
6310 , ⋅<br />
=<br />
2<br />
234 ,<br />
−3<br />
1<br />
6310 , ⋅<br />
=<br />
548 ,<br />
−3<br />
1<br />
= 11510 , ⋅<br />
Das Verhältnis von k fH zu k fV im betreffenden Bereich des<br />
Grundwassers liegt also bei 5,5.<br />
−3<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
Fachberichte<br />
Symbole<br />
A Scheitelpunkt eines abgesenkten <strong>Wasser</strong>spiegels auf der<br />
Unterstromseite eines Brunnens<br />
H Mächtigkeit des mit <strong>Wasser</strong> erfüllten Grundwasserleiters m<br />
I Gefälle des ungestörten Grundwasserspiegels –<br />
Q Förderwassermenge m³/s<br />
R Entfernung der <strong>Wasser</strong>spiegellinie von der<br />
Brunnenachse zu der Stelle, an der s = 0 ist<br />
m<br />
R s Entfernung des Scheitelpunktes A von der Brunnenachse m<br />
d 1 , d 2 Summe der Rollkies- bzw. sandigen Kiesschichten m<br />
h <strong>Wasser</strong>stand am Brunnenrand m<br />
h 0 <strong>Wasser</strong>stand im Brunnen m<br />
k f Durchlässigkeitsbeiwertm/s<br />
k fH Horizontaler Durchlässigkeitsbeiwert m/s<br />
k fV Vertikaler Durchlässigkeitsbeiwert m/s<br />
m Mächtigkeit eines GW-Leiters mit gespanntem<br />
<strong>Wasser</strong>spiegelm<br />
r Entfernung von der Brunnenachse m<br />
r 0 Radius der Brunnenbohrung m<br />
s Absenkung des GW-Spiegels m<br />
s * = s – s²/2Hm<br />
s 0 , s * 0 Absenkung am Brunnenrand<br />
m<br />
z Höhe des <strong>Wasser</strong>spiegels über der Brunnensohle m<br />
κ = (k fH /k fV ) 1/2 Anisotropiefaktor–<br />
κ 0 Anisotropiefaktor für s = 0 –<br />
Bild 8. κ-Werte.<br />
Literatur<br />
[1] Lohr, A.: Beitrag zur Ermittlung des k f -Wertes durch hydraulische<br />
Feldversuche. GWT No. 14.<br />
[2] Mansur, C. I. and Dietrich, R. J.: Pumping Test to Determine<br />
Permeability Ratio. Journal of the Soil Mechanics and Foundation<br />
Division, American Society of Civil Engineers 91 (1969)<br />
No. SM4, 1965.<br />
Bild 9. Durchlässigkeitsbeiwerte k f [8].<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1087
FachberichtE <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
[3] Heinrich, G.: Eine Näherung für die freie Spiegelfläche bei<br />
vollkommenen Brunnen. Österreichische <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
16 (1964) Nr. 1/2.<br />
[4] Hartel, F.: Zum Einfluss von Rollkieslagen in Terrassenschottern<br />
auf die Eindringwiderstände der leichten Rammsonde.<br />
Geotechnik (1989) Nr. 3.<br />
[5] Brauns, I.: Grenzabsenkung von Grundwasserbrunnen. Universität<br />
Karlsruhe. Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik,<br />
H. 87 (1981).<br />
[6] Klüber, T.: Die instationäre Brunnenströmung im anisotropen<br />
Grundwasserleiter mit freier Oberfläche. Technische Universität<br />
Darmstadt, 1975.<br />
[7] Herdt, W. und Arndts, E.: Theorie und Praxis der Grundwasserabsenkung.<br />
Ernst & Sohn Verlag, Berlin, München, Düsseldorf,<br />
1973.<br />
[8] Schneider, G.: Der vollkommene Brunnen in einem geneigten<br />
anisotropen Grundwasserleiter. Lehrstuhl und Prüfamt<br />
für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau<br />
der Technischen Universität München, H. 45, 2010.<br />
[9] Wiederhold, W.: Die raumzeitlichen Verhältnisse des Senktrichters<br />
eines Brunnens im Grundwasser mit freier Oberfläche.<br />
Methode zur vereinfachten Auswertung des hydrologischen<br />
Pumpversuchs. Zeitschrift für Grundwasser-<br />
Verlag, Frankfurt, 1961.<br />
[10] Polubarinova-Kochina, P. Y.: Theory of ground-water movement.<br />
Princeton University Press, New Jersey, 1962.<br />
[11] Bear, J.: Dynamics of Fluids in Porous Media. American Elsevier<br />
Publishing Company, New York, 1972.<br />
[12] Holler: Die Ermittlung der <strong>Wasser</strong>führung von Grundwasserströmungen<br />
aus Pumpversuchen. GWT (1929) Nr. 7.<br />
[13] Bosold, H.: Die Festlegung der Reichweiten bei kreisförmigen<br />
Fassungsanlagen und Einzelbrunnen. WWT (1966) Nr. H. 11.<br />
[14] Beyer, W.: Zur Bestimmung der <strong>Wasser</strong>durchlässigkeit von<br />
Kiesen und Sanden aus der Kornverteilungskurve. WWT<br />
(1964) Nr. 6.<br />
[15] Seiler, K. P.: Durchlässigkeit, Porosität und Kornverteilung<br />
quartärer Kies-Sand Ablagerungen des bayerischen Alpenvorlands.<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong> 114 (1973) Nr. 8, S. 353-358.<br />
[16] Schneebeli, G.: Sur l’hydraulique des puits. In Symposia<br />
Darcy, Publication No. 41 de l’Ass. Int. d’Hydrogeologie 1962,<br />
tome 2, 10–27. Gentbrugge, Belgium.<br />
[17] Hantush, M.S.: On the Validity of the Dupuit-Forchheimer<br />
Well-Discharge Formula. Jour. Geophys. Res. 67 (1962) No. 6,<br />
p. 2417–2420.<br />
[18] Heinrich, G.: Die strenge Lösung für die Ergiebigkeit eines<br />
vollkommenen Brunnens. Ingenieurarchiv, XXXII, Band 1963.<br />
[19] Hunt, B.W.: Exact Flow Rates from Dupuit’s Approximation.<br />
Journal of the Hydraulics Division 96 (1970) No. 3.<br />
[20] Murray, W.A. and Monkmeyer, P. L.: Validity of Dupuit-Forchheimer<br />
Equation. Journal of the Hydraulics Division 99<br />
(1973) No. 9.<br />
Autor<br />
Günter Schneider<br />
Tel. (089) 83 04 38 |<br />
Perlschneiderstraße 16 |<br />
D-81241 München<br />
Eingereicht: 27.05.2011<br />
Korrektur: 17.10.2011<br />
Im Peer-Review-Verfahren begutachtet<br />
Parallelheft <strong>gwf</strong>-Gas | Erdgas<br />
Biogas – Gasbeschaffenheit<br />
Sie lesen u. a. fol gende Bei träge:<br />
Müller-Syring u. a.<br />
Leövey/Römisch/<br />
Wegner-Specht/Steinkamp<br />
Steinhausen<br />
Cull<br />
Brieler/Crocoll<br />
power-to-Gas – Entwicklung von Anlagenkonzepten im Rahmen der<br />
DVGW-Innovationsoffensive<br />
Modellierung der Gasabnahme als Funktion der Temperatur: Optimierung<br />
der Temperaturgewichte<br />
verdichtermix – Schwingungstechnische Ab<strong>sich</strong>erung für gemeinsamen Betrieb<br />
von Turbo- und Kolbenverdichtern in Erdgasspeichern<br />
Minimale Ausgleichsenergiekosten dank höchster Prognosegüte<br />
videoüberwachung ist nicht gleich Sicherheit<br />
November 2011<br />
1088 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
BUCHBESPRECHUNGEN<br />
Buchbesprechungen<br />
WHG<br />
<strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz – Kommentar<br />
Herausgegeben von Dr. jur. Konrad Berendes, Ministerialrat<br />
a. D. im Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktor<strong>sich</strong>erheit; Prof. Dr. jur.<br />
Walter Frenz, Professor für Berg-, Umwelt- und<br />
Europarecht an der RWTH Aachen; Prof. Dr. jur.<br />
Hans-Jürgen Müggenborg, Rechtsanwalt und Fachanwalt<br />
für Verwaltungsrecht in Aachen, Honorarprofessor<br />
der RWTH Aachen sowie Lehrbeauftragter<br />
der Universität Kassel. Berlin, Bielefeld, München:<br />
Erich Schmidt Verlag 2011. LVII, 1667 S.,<br />
inkl. Online-Zugang zu wasserrechtlicher Vorschriftendatenbank,<br />
fester Einband, Preis: € 154,00, ISBN<br />
978-3-503-12666-8<br />
Ressource <strong>Wasser</strong> – im Spannungsverhältnis<br />
zwischen Nutzungsinteresse & Schutzerfordernis!<br />
Das 2010 in Kraft getretene <strong>Wasser</strong>haushaltsgesetz<br />
(WHG) ersetzt vollständig das vormals geltende<br />
Rahmenrecht. Neben vielen inhaltlichen Änderungen<br />
hat es vor allem systematische grundsätzliche<br />
Neuerungen gegeben.<br />
Praxisorientiert<br />
Mit speziellem Blick auf die Bedürfnisse der Praxis<br />
wurde dieser neue, das aktuelle WHG vollständig<br />
abdeckende Berliner Kommentar entwickelt. Er gibt<br />
allen Praktikern fundierte Fachinformationen mit<br />
ausführlichen Erläuterungen für die Anwendung<br />
der neuen Regelungen an die Hand.<br />
Umfassend<br />
Das Besondere an diesem Kommentar: Er bietet<br />
konkret einsetzbare Lösungsvorschläge zu den <strong>sich</strong><br />
in der Praxis ergebenden Rechtsfragen und stellt<br />
diese verlässlich dar. Bereits ergangene landesrechtliche<br />
Regelungen werden dabei ebenso berück<strong>sich</strong>tigt<br />
wie die europarechtlichen und umweltpolitischen<br />
Hintergründe. Als weiteres Praxis-Plus<br />
erhält der Nutzer Zugriff auf eine umfangreiche,<br />
ständig aktualisierte Internet-Datenbank mit wasserrechtlichen<br />
Vorschriften der EU, des Bundes und<br />
der Länder.<br />
Kompetent<br />
Die erfahrenen Verfasser – Anwälte, Verbandsjuristen,<br />
Umweltberater, Ministerialbeamte, Hochschullehrer<br />
und Richter – sind bestens mit der Materie<br />
vertraut und durch zahlreiche Publikationen ausgewiesen.<br />
Mit Dr. jur. Konrad Berendes, Ministerialrat<br />
a. D. im BMU, wurde zudem ein Herausgeber<br />
und Autor gewonnen, der maßgeblich am Entwurf<br />
des neuen WHG beteiligt war.<br />
Bestellmöglichkeit online unter<br />
www.ESV.info/978 3 503 12666 8<br />
Die Umweltziele der<br />
<strong>Wasser</strong>rahmenrichtlinie<br />
Anforderungen an die Bewirtschaftung der<br />
Oberflächengewässer aus der Sicht des Rechts<br />
der Europäischen Union<br />
Von Dr. Christian Port. Umwelt- und Technikrecht,<br />
Band 111. Berlin, Bielefeld, München: Erich<br />
Schmidt Verlag 2011. 247 S., fester Einband, Preis:<br />
€ 87,40, ISBN 978-3-503-13632 2.<br />
Darüber hinaus befasst <strong>sich</strong> die Arbeit in einem<br />
eigenständigen Unterkapitel auch mit der Frage der<br />
SUP-Pflichtigkeit von Bewirtschaftungsplan und<br />
Maßnahmenprogramm. Im Hinblick auf die „Wells“-<br />
Entscheidung des EuGH hat diese eine nicht unerhebliche<br />
Bedeutung für den Rechtschutz der Unionsbürger<br />
gegen Festsetzungen im Bewirtschaftungsplan<br />
und Maßnahmenprogramm erlangt.<br />
Herausforderung WRRL!<br />
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die<br />
Anforderungen der Richtlinie an die Durchführung<br />
der Bewirtschaftungsplanung systematisch darzustellen<br />
und die wesentlichen Rechtsfragen im<br />
Zusammenhang mit der fachlichen und rechtlichen<br />
Implementierung der Umweltziele zu erörtern.<br />
Bestellmöglichkeit online unter<br />
www.ESV.info/978 3 503 13632 2<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1089
FachberichtE Tagungsbericht<br />
Treffpunkt für das <strong>Wasser</strong>fach –<br />
4. Kolloquium der<br />
Trinkwasserspeicherung<br />
Nachbericht über Praxisseminar am 22. September 2011 in Koblenz<br />
Corinna Scholz<br />
„Hier sitzt man unter Kollegen“, meint Viola Pöllmann-<br />
Kux von der EVM Energieversorgung Mittelrhein GmbH.<br />
Die Bau-Ingenieurin besuchte das 4. Kolloquium der<br />
Trinkwasserspeicherung, um ihr Fachwissen zu erweitern.<br />
Für Planung und Bauleitung zuständig, betreut sie<br />
jährlich ein bis zwei Behälter-Sanierungen. „Daher hatte<br />
ich einige konkrete Fragen im Gepäck.“ Sie schätzt den<br />
spontanen Austausch mit anwesenden Experten und<br />
Planern, der in Koblenz auch übergreifende Themen wie<br />
den Brunnen-Rückbau umfasste.<br />
Neben Viola Pöllmann-Kux kamen wie im Vorjahr<br />
etwa hundert Teilnehmer zum Praxis-Seminar der Fachvereinigung<br />
S.I.T.W. (Bild 1). Darunter befanden <strong>sich</strong><br />
sämtliche Vertreter des Fachgebiets: Betreiber von <strong>Wasser</strong>behältern<br />
respektive <strong>Wasser</strong>meister, Planer, sowie<br />
Beteiligte von Verbänden, Ausführenden Firmen und<br />
Materialherstellern.<br />
Wie üblich traf man <strong>sich</strong> im 600 qm großen Prüflabor<br />
der Fachrichtung Bauingenieurwesen in der Fachhochschule<br />
Koblenz, die das Kolloquium gemeinsam mit<br />
dem DVGW unterstützte. „Die imposanten Räumlichkeiten<br />
bieten ideale Voraussetzungen für unsere Mischung<br />
aus Theorie und Praxis, denn hier können wir auch<br />
Laborversuche demonstrieren – real und zum Anfassen“,<br />
erläutert Eckart Flint, 1. Vorsitzender der Fachvereinigung<br />
Schutz und Instandsetzung von Trinkwasserbehältern<br />
e.V., kurz S.I.T.W. (Bild 2). Als Ziele der Praxisseminar-Reihe<br />
nennt er den persönlichen Erfahrungsaustausch<br />
sowie aktuelle Informationsvermittlung in<br />
dem speziellen Fachgebiet der Trinkwasserspeicherung.<br />
„Damit kommen Versorgungsunternehmen und gerade<br />
Mehrsparten-Versorger eigentlich nur in Berührung,<br />
wenn die Sanierung von Behältern ansteht.“<br />
Eindrücke der Teilnehmer<br />
Mit dieser Motivation kam auch Dipl.-Ing. Stefan Alef mit<br />
zwei Kollegen nach Koblenz. Der Abteilungsleiter An -<br />
lagenplanung und Betrieb bei der Stadtwerke Neuss<br />
Energie und <strong>Wasser</strong> GmbH holte <strong>sich</strong> Anregungen, „wie<br />
es andere machen oder eben gerade nicht“. Er wolle <strong>sich</strong><br />
und seine Mitarbeiter soweit bringen, mit Planern und<br />
Ausführenden Firmen auf Augenhöhe sprechen zu können.<br />
Im Rückblick meint er: „Wir müssen uns mit der<br />
Thematik intensiver beschäftigen, denn nicht nur die<br />
Instandsetzung, sondern auch der laufende Betrieb mitsamt<br />
Instandhaltung erfordert Fachwissen.“ So wolle er<br />
zum 5. Kolloquium wieder kommen und ergänzende<br />
DVGW-Seminare besuchen.<br />
„Das ist eine Pflichtveranstaltung“, betont Dipl.-Ing.<br />
Matthias Vennes von Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft<br />
für <strong>Wasser</strong>, <strong>Abwasser</strong> und Energiewirtschaft mbH<br />
in Bochum. Der Team-Projektleiter und Kollegen<br />
besuchten bereits mehrfach S.I.T.W. Kolloquien. „Wir<br />
müssen wissen, was am Markt passiert und dicht am<br />
Geschehen sein.“ Besonders relevant für ihn sei die Auseinandersetzung<br />
von Prof. Dr.-Ing. Breitbach mit dem<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 300. „Unser Gebetbuch“, zwinkert<br />
der Planer, der <strong>sich</strong> seit 20 Jahren in der Branche bewegt.<br />
Das Programm im Detail<br />
Die praxisbezogenen Vorträge spannten einen Bogen<br />
von der neuen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) über<br />
Hygieneaspekte und Qualitätsmanagement bis zu<br />
Anwendungsfragen zum DVGW-Regelwerk. Als Referenten<br />
fungierten Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach von<br />
der FH Koblenz und Dipl.-Ing. Rainer Pütz, Obmann in<br />
verschiedenen Projektkreisen des DVGW und seit<br />
33 Jahren in der Versorgungsbranche tätig, zuletzt als<br />
ehemaliger stellvertretender Laborleiter bei der Rhein-<br />
Energie AG in Köln und auch zuständig für die Kundenbetreuung<br />
und Labororganisation. Durch den abschließenden<br />
Praxisblock führte Heribert Weiß von der FH<br />
Koblenz.<br />
1. Neue TrinkwV<br />
Zu Beginn präsentierte Dipl.-Ing. Rainer Pütz (Bild 3) die<br />
wichtigsten Änderungen der neuen Trinkwasserverordnung<br />
(TrinkwV) 2011 und ihre Bedeutung in der Praxis.<br />
Der erfahrene Chemieingenieur führte das Publikum<br />
kurzweilig durch das 25 Paragraphen starke Verord-<br />
November 2011<br />
1090 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
nungswerk, kommentierte neue Passagen und gab<br />
zahlreiche praktische Tipps.<br />
Für Trinkwasserspeicher ist z. B. § 14 relevant, der nun<br />
im Absatz 3 die Pflicht des Trinkwasserversorgers enthält,<br />
geeignete Probennahme-Stellen nach den anerkannten<br />
Regeln der Technik einzurichten. Dies gelte<br />
sowohl für Behälter als auch für das Verteilungsnetz. Bei<br />
Neubauten und Sanierungen könne die zuständige<br />
Gesundheitsbehörde jetzt darauf bestehen, passende<br />
Öffnungen vorzusehen. Für Proben aus Verteilungsnetzen<br />
regelt § 14 Absatz 2 Satz 4, dass die Probenahme-<br />
Planung mit dem Gesundheitsamt abzustimmen ist.<br />
Nach § 19 sei die Trinkwasser-Installation bei gewerblicher<br />
Abgabe oder Abgabe an die Öffentlichkeit nun<br />
noch intensiver zu überwachen. Und dies mindestens<br />
auf diejenigen Parameter, von denen anzunehmen ist,<br />
dass sie <strong>sich</strong> in der Trinkwasser-Installation nachteilig<br />
verändern können. Als Beispiele nannte Rainer Pütz Blei,<br />
Kupfer und Nickel aber auch mikrobiologische Parameter<br />
wie Legionellen.<br />
Nach seiner Erfahrung werde ein Großteil der „Verunreinigungen“<br />
durch nicht zertifizierte Armaturen verursacht.<br />
In Anbetracht der verschärften Grenzwerte für<br />
Blei (0,025 mg/L noch bis zum 30.11.2013, danach 0,01<br />
mg/L laut § 6) kommentierte der Chemiker: „Diesen<br />
Grenzwert halten alte Trinkwasser-Installationen und<br />
Hauszuleitungen aus Blei praktisch nicht ein. Bleileitungen<br />
sollten also spätestens bis zum 01.12.2013 ausgetauscht<br />
werden.“<br />
Dazu fragte ein Teilnehmer, wie man mit privaten<br />
Hauseigentümern umgehen solle, die <strong>sich</strong> dagegen<br />
sperrten. Rainer Pütz empfahl, das Gesundheitsamt zu<br />
informieren. Die Mediziner dort sollten das Risiko für die<br />
Bewohner abwägen. Mehr sei nicht nötig, da keine<br />
anderen Personen gefährdet wären – anders als bei mikrobiellen<br />
Auffälligkeiten, wo es u. U. zu Rückverkeimung<br />
im Netz kommen könne.<br />
Eine weitere Frage aus dem Podium lautete: Wer hat<br />
Anzeigepflicht bei Verunreinigungen und wem gegenüber?<br />
Der Referent antwortete, dass <strong>sich</strong> jeweils der<br />
Eigentümer bzw. Betreiber der betroffenen Anlage, also<br />
<strong>Wasser</strong>versorger oder Hausbesitzer, zunächst ans<br />
Gesundheitsamt wenden muss, nicht an den <strong>Wasser</strong>versorger.<br />
Gegebenenfalls sollte der Immobilieneigner<br />
auch den <strong>Wasser</strong>versorger informieren. Sein Tipp: bei<br />
der Installation nicht an der falschen Stelle sparen und<br />
Planung sowie Bau und insbesondere die Wartung qualifizierten<br />
Fachfirmen übertragen.<br />
2. Qualitätsmanagement<br />
Prof. Dr.-Ing. Manfred Breitbach (Bild 4) startete seinen<br />
Vortrag über das Qualitätsmanagement für die Instandsetzung<br />
in der Trinkwasserspeicherung mit einer Party:<br />
Ein Versorger lud seine Kunden in einen frisch sanierten<br />
Behälter. Die Gäste genossen zwar die Begehung als<br />
seltene Gelegenheit, trugen jedoch so viel Schmutz hin-<br />
Bild 1. Rund 100 Teilnehmer informierten <strong>sich</strong> beim Praxisseminar<br />
„Trinkwasserspeicherung“ über den aktuellen Stand der Technik.<br />
© Alle Abbildungen: Corinna Scholz<br />
Bild 3. „Die Bewertung<br />
des Kunden über die<br />
Trinkwasser-Qualität<br />
findet am Zapfhahn<br />
statt“, betonte Dipl.-Ing.<br />
Rainer Pütz in seinem<br />
Vortrag über die neue<br />
TrinkwV.<br />
Bild 2. Eckart Flint,<br />
1. Vorsitzender der<br />
S.I.T.W., eröffnete das gut<br />
besuchte Praxisseminar.<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1091
FachberichtE Tagungsbericht<br />
Bild 4.<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Manfred<br />
Breitbach<br />
übernahm<br />
wieder die<br />
fachliche<br />
Leitung des<br />
4. Kolloquiums:<br />
„Was wir mit<br />
der Sanierung<br />
tun, ist<br />
eigentlich,<br />
Opferschichten<br />
einzubringen.“<br />
Bild 5. Heribert Weiß mit Team von der FH Koblenz (r.) erläutert die<br />
Demoversuche während des Praxisblocks.<br />
Bild 6. Der Praxisblock bot Versuchs-Exponate zum Anfassen, was<br />
viele Teilnehmer des Kolloquiums wahrnahmen.<br />
ein, dass aufwändig gereinigt werden musste. Die gut<br />
gemeinte Feier kam dem Betreiber also teuer zu stehen.<br />
Mit diesem Beispiel ließ der anerkannte Experte die<br />
Pläne so mancher anwesenden Versorger platzen, die<br />
einen Tag der Offenen Tür als Kundenevent planten.<br />
Danach widmete er <strong>sich</strong> in gewohnt eloquenter Weise<br />
sachlicheren Inhalten. Als ein Etappenziel nannte er das<br />
mittlerweile erreichte, flächendeckende Netz von rund<br />
30 Fachunternehmen mit DVGW W 316-Zertifzierung.<br />
Als weitere Maßnahme empfahl er allen Beteiligten,<br />
ein individuelles Qualitäts-Management-System (QMS)<br />
aufzubauen – unabhängig von der Unternehmensgröße.<br />
Als wichtigen Bestandteil nannte er die Darstellung<br />
der internen Organisation. Dort sollte <strong>sich</strong> auch die<br />
Verantwortliche Fachauf<strong>sich</strong>t finden mitsamt Vertreter-<br />
Regelung, was gerade bei kleineren Unternehmen eher<br />
selten sei. Es wäre jedoch zu bedenken, dass im Fall des<br />
Falles innerhalb von sechs Wochen ein Nachfolger<br />
benannt werden muss.<br />
Prof. Manfred Breitbach erläuterte seine Erfahrung als<br />
Zertifizierer: Vor Ort würde er <strong>sich</strong> immer die Form der<br />
Ablage anschauen. Es müsse ein in <strong>sich</strong> vernetztes,<br />
bewegliches System sein. „Ein Regal mit Papierordner<br />
reicht da einfach nicht“, so der Experte, „nötig ist ein<br />
Dokumenten-Management-System.“<br />
Als weitere Schwachstelle präsentierte er den internen<br />
Schulungsplan. Nur selten würde dort krankheitsbedingter<br />
Ausfall berück<strong>sich</strong>tigt. Es wäre nötig, durchgängig<br />
zu dokumentieren und kontinuierlich fortzuschreiben.<br />
Schulungslisten mitsamt Erinnerungsfunktion<br />
wären da hilfreich.<br />
Als Beispiel für den Baustellenalltag führte er die<br />
Pflicht zur Selbstüberwachung auf: „Manche scheinen<br />
die zu vergessen.“ Selbst ein Hygrometer sei regelmäßig<br />
zu überprüfen und die Ergebnisse zu dokumentieren.<br />
Die einfachste Methode zur Kalibrierung wäre, den<br />
Sensor in den Mund zu halten. Ein Wert um 99 % wäre<br />
korrekt.<br />
Der Dozent und Gutachter schloss mit der Empfehlung:<br />
„Qualität kann man nicht alleine machen. Nötig ist<br />
ein Austausch von Bauherrn, Planern und Ausführenden<br />
Unternehmen.“ Er appellierte an die Auftraggeber, ihre<br />
Partner immer nach QM-Maßnahmen zu fragen.<br />
3. <strong>Wasser</strong>schutzzonen<br />
In Vertretung für Bertil Winterstein von der RheinEnergie<br />
AG in Köln erläuterte Prof. Manfred Breitbach einen Maßnahmenkatalog<br />
für Bauarbeiten in Trinkwasserschutzgebieten,<br />
der auf Erfahrungen des Kölner Versorgers<br />
basiert. Ziel sei es, die Ausführenden Firmen zu sensibilisieren<br />
und deren Verhalten anzupassen. Aber auch den<br />
Versorgern riet er zu vorbeugenden Maßnahmen wie<br />
ausreichend Park- und Lagermöglichkeiten am sanierungsbedürftigen<br />
Behälter zu schaffen. Bei Baumaßnahmen<br />
im Winter dürfe zwar geräumt, aber kein Salz eingesetzt<br />
werden. Generell wäre zu empfehlen, bei der<br />
November 2011<br />
1092 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Tagungsbericht<br />
Fachberichte<br />
Instandsetzung die Arbeiten nach der Trinkwasserschutzzone<br />
III zu planen, damit alle relevanten Aspekte<br />
der Trinkwasserhygiene beachtet würden.<br />
4. DVGW-Regelwerk<br />
Danach schwenkte Prof. Manfred Breitbach zu Anwendungsfragen<br />
des DVGW-Regelwerks in puncto Instandhaltung<br />
von Trinkwasserbehältern. Er konzentrierte <strong>sich</strong><br />
auf die Frage, wie <strong>sich</strong> der Qualitätsanspruch aus dem<br />
W 316 in die „schwierige Gemengelage“ der anderen<br />
Regelwerke und Vorschriften einbringen ließe. Zumal<br />
auch verschiedene Auskleidungssysteme realisiert würden,<br />
die nur wenig beschrieben seien.<br />
Als Ausweg stellte der Gutachter den Ansatz vor, das<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 300 neu zu strukturieren. Dort<br />
würden in vier Teilen alle Belange behandelt mit dem<br />
Vorteil, Maßnahmen für Instandhaltung und Neubau<br />
vereinheitlichen zu können.<br />
Als wesentliche Neuerung würde eine eigene Expositionsklasse<br />
für Trinkwasser führende Oberflächen<br />
geschaffen, die so genannte X TW. Diese berück<strong>sich</strong>tige<br />
den besonderen Angriff durch Auslaugung des Zementsteins,<br />
dem ein Speicherbehälter ausgesetzt sei. „<strong>Wasser</strong><br />
beeinflusst die berührenden Betonoberflächen bis zu<br />
einer Tiefe von 9 cm“, erklärte der Dozent und erntete<br />
erstaunte Blicke. Daher sei die komplette Betonrandzone<br />
zu betrachten. Ein neues Qualitätskriterium stelle<br />
die Porenradien-Verteilung dar, die bei der Eingangsprüfung<br />
zu beachten sei. Zurzeit befinde <strong>sich</strong> die neue<br />
Version der W 300 in der fachlichen Abstimmung.<br />
5. Praxisblock<br />
Welche verheerende Wirkung Oberflächenfeuchte auf<br />
die Haftzugfestigkeit haben kann, demonstrierte Heribert<br />
Weiß (Bild 5) von der FH Koblenz im Laborversuch.<br />
Er hatte mit Kollegen zwei Betonplatten präpariert: Eine<br />
war oberflächlich trocken, während die zweite 50 %<br />
Feuchte aufwies. Bei sonst gleichen Bedingungen<br />
(5 Grad Celsius Lagertemperatur, PMMA-Kleber zwischen<br />
Oberfläche und Prüfstempel sowie gleiche<br />
Abzuggeschwindigkeit) erreichte der feuchte Prüfkörper<br />
nicht einmal ein Zehntel seines trockenen Pendants.<br />
In Zahlen ausgedrückt: 0,4 N/qmm gegenüber<br />
4,0 N/qmm Haftzugfestigkeit.<br />
Korrelierend dazu ließ <strong>sich</strong> unterschiedliches Bruchverhalten<br />
beobachten. Während am feuchten Prüfkörper<br />
Adhäsionsversagen auftrat, zeigte die trockene<br />
Betonplatte einen klassischen Kohäsionsbruch im<br />
Beton.<br />
Prof. Manfred Breitbach kommentierte das Versuchsergebnis<br />
folgendermaßen: Der feuchte Prüfkörper<br />
kommt den realen Verhältnissen in einem Trinkwasserbehälter<br />
näher als denen des trockenen. Wer zum falschen<br />
Zeitpunkt, z. B. zu schnell nach der Entleerung,<br />
Tests an den Behälteroberflächen oder Bohrkernen<br />
durchführt, muss mit Fehlinterpretationen der Haftzugfestigkeit<br />
rechnen.<br />
Heribert Weiß lud die Teilnehmer ein, <strong>sich</strong> die Proben<br />
aus der Nähe anzusehen und gemeinsam zu diskutieren<br />
(Bild 6). Wissenschaftliche Mitarbeiter realisierten vor<br />
Ort einen weiteren Laborversuch, wobei sie die Temperatur<br />
der Prüfkörper variierten.<br />
Nächstes Kolloquium in 2013<br />
Wegen der konstant hohen Beteiligung an der Praxisseminar-Reihe<br />
plant die S.I.T.W. bereits ihre nächste Veranstaltung.<br />
Das dann 5. Kolloquium der Trinkwasserspeicherung<br />
ist für März 2013 angesetzt. Anregungen für<br />
Vortragsthemen und Referenten sind herzlich willkommen.<br />
Interessierte Teilnehmer können <strong>sich</strong> unter E-Mail:<br />
verwaltung@sitw.de, Tel. (05231) 9609-18, vormerken<br />
lassen und erhalten beizeiten weitere Informationen<br />
und eine Einladung.<br />
Autorin<br />
Eingereicht: 19.10.2011<br />
Dipl.-Ing. Corinna Scholz<br />
E-Mail scholz.corinna@t-online.de |<br />
Paul-Sorge-Straße 66a |<br />
D-22459 Hamburg<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1093
Praxis<br />
Ohne Experten wird es teuer<br />
Qualitäts<strong>sich</strong>erung beginnt bei der Auswahl des Planers<br />
ntwässerungssysteme sind<br />
„Elangfristig nutzbare Einrichtungen,<br />
ohne die eine zivilisierte<br />
Gesellschaft aus hygienetechnischen<br />
und umweltrelevanten Gründen<br />
nicht existieren kann. Die Erhaltung<br />
dieser Werte im sozialen wie<br />
im monetären Sinn ist heute mehr<br />
denn je erforderlich“, diese Meinung<br />
vertritt Dipl.-Ing. (FH) Markus Vogel,<br />
Inhaber des Ingenieurbüros VOGEL<br />
Ingenieure aus dem baden-württembergischen<br />
Kappelrodeck. Mit<br />
seiner Meinung steht der beratende<br />
Ingenieur, der <strong>sich</strong> mit seinen Mitarbeitern<br />
auf den Bereich der<br />
Kanalsanierung spezialisiert hat,<br />
nicht alleine. Mittlerweile ist auch in<br />
den Blickpunkt der Öffentlichkeit<br />
gerückt, dass die Entwässerungsanlagen<br />
zu den wertvollsten Einrichtungen<br />
von Städten und Gemeinden<br />
gehören. „Sie unterliegen einer<br />
steten Abnutzung und Alterung“, so<br />
Vogel. „Deshalb trägt die Instandhaltung<br />
neben der Sicherstellung<br />
der wasserwirtschaftlichen Ge<strong>sich</strong>tspunkte<br />
zur Erhaltung der vorhandenen<br />
Vermögenswerte bei.“ Es gilt,<br />
diese Systeme durch gezielte, intelligente<br />
Sanierungsmaßnahmen in<br />
ihrer Funktion zu erhalten. Auch,<br />
um Gebührengelder sinnvoll und<br />
zukunftsorientiert einzusetzen. An<br />
den Kanalbau werden aus diesem<br />
Grund besondere Ansprüche<br />
gestellt. Zum Beispiel hin<strong>sich</strong>tlich<br />
einer konsequenten Qualitäts<strong>sich</strong>erung<br />
von der Kanaluntersuchung<br />
über die Ausschreibung bis zur Ausführung.<br />
Die Qualität bei einigen Sanierungsverfahren<br />
wird in wesentlichem<br />
Maße erst auf der Baustelle<br />
erzeugt; deshalb ist es notwendig,<br />
Rahmenbedingungen zu definieren,<br />
die helfen, das gewünschte und<br />
seitens des Auftraggebers bestellte<br />
Qualitätsniveau verlässlich zu erreichen.<br />
Ausführende Unternehmen<br />
belegen ihre Qualifikation im<br />
Interne Projekt- und Prozessbesprechung: Gaby Vogel, Dipl.-Ing. (FH)<br />
Markus Vogel, Dipl.-Ing. Rico Nock, Dipl.-Ing. (FH) Jens Biegger (v.li.).<br />
© VOGEL Ingenieure<br />
Bereich der Kanalsanierung mit<br />
dem Gütezeichen S (Sanierung).<br />
Firmen, die diesen Nachweis führen,<br />
erfüllen die von Auftraggebern<br />
gestellten Anforderungen an Material,<br />
Verfahren, Ausführung und<br />
Eigenüberwachung in Übereinstimmung<br />
mit den aktuellen Regelwerken.<br />
Allerdings ist Qualifikation und<br />
Fachwissen auch auf Auftraggeberseite<br />
gefragt. Die Qualitäts<strong>sich</strong>erung<br />
beginnt mit der Auswahl des<br />
Planers. Er ist es, der dafür Sorge zu<br />
tragen hat, dass die richtigen Techniken<br />
vor Ort zur Schadensbehebung<br />
eingesetzt werden. Das<br />
Thema Kanalsanierung erfordert<br />
erfahrene Fachleute in der Planung,<br />
Ausschreibung und Bauüberwachung.<br />
Die Praxis zeigt, dass es hier<br />
nicht immer rund läuft. Unvollständige<br />
Planungsfestlegungen und<br />
Ausschreibungsunterlagen führen<br />
oft zu Sanierungsergebnissen, welche<br />
die gestellten Anforderungen<br />
nicht erfüllen. Ursache sind fehlende<br />
Fachkenntnisse bzw. Erfahrungen<br />
oder die zu oberflächliche<br />
Projektbearbeitung. Die Folge sind<br />
unwirtschaftliche Sanierungen, die<br />
<strong>sich</strong> situationsbedingt regelmäßig<br />
erst viele Jahre später als solche herausstellen.<br />
Die Gründe für diese Entwicklung<br />
liegen für Markus Vogel auf der<br />
Hand: „Eine zu geringe Personaldecke<br />
und Personalabbau in den<br />
Tiefbauämtern bedeuten in der<br />
Regel, dass wichtige Aufgaben ganz<br />
einfach zeitlich und organisatorisch<br />
nicht mehr erfüllt werden können.<br />
Zudem ist diese Entwicklung meist<br />
mit dem Verlust von Kompetenz<br />
verbunden. Unter dieser Situation<br />
leidet die Zielorientierung bei der<br />
Planerauswahl, eine Kontrolle der<br />
Ingenieurleistungen findet praktisch<br />
nicht statt.“ Bei der Planerauswahl<br />
sind so genannte Allrounder<br />
mittlerweile nicht mehr zwangsläufig<br />
die erste Wahl. „Die modernen<br />
Sanierungstechniken, die <strong>sich</strong> in<br />
den letzten 20 Jahren entwickelt<br />
haben, tragen dazu bei, dass die<br />
Lebenszeit von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen deutlich verlängert<br />
werden kann. Der zielgerichtete<br />
und lösungsorientierte Einsatz der<br />
vielfältigen modernen Materialien<br />
November 2011<br />
1094 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
und Verfahren erfordert jedoch ein<br />
gehöriges Maß an Spezialwissen.<br />
Deshalb ist derjenige, der von sehr<br />
vielem nur etwas weiß, schlichtweg<br />
überfordert“, so Vogel weiter.<br />
Fachwissen nötig<br />
Für den beratenden Ingenieur verlangt<br />
jede Sanierungsmaßnahme<br />
nach ganz speziellem Know-how.<br />
Auf Seiten von Auftraggebern und<br />
Bauüberwachern ebenso wie auf<br />
Seiten der ausführenden Unternehmen.<br />
Eine Kanalbaumaßnahme<br />
kann nur dann gelingen, wenn das<br />
nötige Fachwissen vorhanden ist<br />
und wenn Auftraggeber, Ingenieurbüro<br />
und Auftragnehmer Hand in<br />
Hand zusammenarbeiten. Politik,<br />
Wirtschaft sowie Institutionen und<br />
Verbände weisen seit vielen Jahren<br />
darauf hin, dass der dauerhaften<br />
Dichtheit von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen mehr Aufmerksamkeit<br />
gewidmet werden muss. Es liegt im<br />
Interesse aller, dass <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanäle von erfahrenen<br />
und zuverlässigen Fachleuten<br />
geplant, gebaut oder saniert werden.<br />
Aus diesem Grund wurde die<br />
Güte<strong>sich</strong>erung RAL-GZ 961 eingeführt,<br />
um eine kontrollierte Selbstverpflichtung<br />
der Unternehmen<br />
und eine Zuverlässigkeitssteigerung<br />
zu erreichen. Im Fokus steht<br />
dabei der Zustand unserer Kanalisation.<br />
Erfahrung und Zuverlässigkeit<br />
sind Grundlagen für Planungs- und<br />
Ausführungsqualität und somit für<br />
die Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit<br />
der Leitungsinfrastruktur.<br />
rungen an die Fachkunde, die technische<br />
Leistungsfähigkeit und technische<br />
Zuverlässigkeit der Bieter<br />
sowie die Dokumentation der<br />
Eigenüberwachung. Im Einzelnen<br />
betrifft dies Anforderungen an Personal,<br />
Betriebseinrichtungen und<br />
Geräte, Nachunternehmer und<br />
Eigenüberwachung, deren Erfüllung<br />
die Bieter mit Angebots -<br />
abgabe nachweisen müssen.<br />
Allerdings: Was für die Auftragnehmerseite<br />
gilt, sollte auch auf<br />
Seiten der Auftraggeber selbstverständlich<br />
sein. „Von den ausführenden<br />
Unternehmen fordern wir<br />
Nachweise zur Qualifikation, deshalb<br />
ist es nur konsequent, dass <strong>sich</strong><br />
auch Ingenieurbüros auf den Prüfstand<br />
stellen“, so die Überzeugung<br />
von Markus Vogel.<br />
In den letzten Jahren wünschten<br />
<strong>sich</strong> zunehmend mehr Beteiligte<br />
einen Beleg für die fachtechnische<br />
Eignung von Organisationen, die<br />
mit der Ausschreibung und Bauüberwachung<br />
von Maßnahmen<br />
beauftragt sind. Einen entsprechenden<br />
Antrag hat die Mitgliederversammlung<br />
der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau diskutiert und unterstützt.<br />
Konsequent wurde die Ingenieurleistung<br />
im Bereich Ausschreibung<br />
(A) und Bauüberwachung (B) bei<br />
der grabenlosen Sanierung (S) von<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen und -kanälen<br />
2007 als Beurteilungsgruppe ABS in<br />
die Güte- und Prüfbestimmungen<br />
aufgenommen. Auftraggeber und<br />
Ingenieurbüros dokumentieren<br />
damit ihre besondere Erfahrung<br />
und Zuverlässigkeit der Organisation<br />
und des eingesetzten Personals.<br />
Etwa durch entsprechende<br />
Referenzen und ein Managementsystem<br />
zur Fehlerminimierung. Mit<br />
Zeugnissen kann die Qualifikation<br />
des eingesetzten Personals nachgewiesen<br />
werden. Damit wurde ein<br />
Anforderungskatalog geschaffen,<br />
der Grundlage ist für zuverlässiges<br />
Handeln bei Ausschreibung und<br />
Bauüberwachung.<br />
Für Markus Vogel ein Schritt in<br />
die richtige Richtung. „Bereits im<br />
Mai 2008 haben wir als eines der<br />
ersten Ingenieurbüros in Deutschland<br />
ein RAL-Gütezeichen 961 in der<br />
Gruppe „Ausschreibung, Bauüberwachung<br />
von Sanierungsmaßnahmen<br />
an <strong>Abwasser</strong>leitungen und<br />
-kanälen erhalten“, blickt Vogel<br />
zurück. Seitdem kommt einmal im<br />
Jahr ein von der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau beauftragter Prüfingenieur<br />
ins Unternehmen, um <strong>sich</strong> die<br />
Erfüllung der Anforderungen bestätigen<br />
zu lassen. Im Vorfeld wurden<br />
das Büro, dessen Ablauf- und Qualitäts<strong>sich</strong>erungsprozesse<br />
sowie die<br />
Projektleiter eingehend geprüft.<br />
„Das bedeutete für uns keinen großen<br />
Aufwand“, so Vogel, der bereits<br />
bei der Gründung seines Unternehmens<br />
auf einen hohen Qualitätsstandard<br />
Wert legte. So nehmen<br />
unter anderem von Beginn an Mitarbeiter<br />
an der Weiterbildung zum<br />
<br />
Gute Erfahrungen<br />
„Mit der Güte<strong>sich</strong>erung haben wir<br />
in den letzten Jahren gute Erfahrungen<br />
gemacht“, bestätigt Markus<br />
Vogel. Die personelle und fachliche<br />
Qualifikation des Bieters ist ein<br />
maßgebliches Entscheidungskriterium,<br />
die es vor Auftragsvergabe zu<br />
hinterfragen und zu prüfen gilt. Für<br />
die Prüfung der Bieter stellt die<br />
Güte<strong>sich</strong>erung RAL-GZ 961 ein neutrales<br />
Instrument zur Verfügung. In<br />
den Güte- und Prüfbestimmungen<br />
finden <strong>sich</strong> detaillierte Anforde-<br />
Maßnahmenbesprechung<br />
vor Ort auf der<br />
Baustelle.<br />
© VOGEL<br />
Ingenieure<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1095
Praxis<br />
Zertifizierten Kanalsanierungsberater<br />
teil. Alle Planer und Bauüberwacher<br />
haben diesen Lehrgang erfolgreich<br />
absolviert. Die weitergehende<br />
regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter<br />
hat für Vogel große Bedeutung,<br />
um technische Neu- und Weiterentwicklungen<br />
von Beginn an<br />
einordnen zu können.<br />
Von dem Fachwissen und der Zertifizierung<br />
mit einem Gütezeichen<br />
profitieren alle Beteiligten. „Unsere<br />
Arbeit entlastet die Gebührenzahler<br />
in Kommunen und die Bilanzen von<br />
Unternehmen“, erklärt Vogel, für den<br />
die wirtschaftliche Instandhaltung<br />
der Infrastruktur eine Daueraufgabe<br />
darstellt. „Heute unterlassene Arbeiten<br />
führen morgen zu höheren Kosten“,<br />
ist Vogel <strong>sich</strong>er. „Sinnvolle Reinvestitionen<br />
in die Entwässerungssysteme<br />
sind Voraussetzung für<br />
langfristig stabile <strong>Abwasser</strong>gebühren<br />
in den Kommunen.“<br />
Wer Geld sinnvoll ausgibt,<br />
spart<br />
Zertifikate für die Qualifikation von<br />
Auftraggebern und Ingenieurbüros<br />
einzurichten, entspricht mittlerweile<br />
den Wünschen vieler Beteiligter<br />
und dem Auftrag der Mitgliederversammlung<br />
der Gütegemeinschaft.<br />
Diesem Auftrag wurde mit<br />
der Einführung der Gütezeichen<br />
ABV – Ausschreibung und Bauüberwachung<br />
bei der grabenlosen Verlegung<br />
und Prüfung von <strong>Abwasser</strong>leitungen<br />
und -kanälen sowie ABAK<br />
– Ausschreibung und Bauüberwachung<br />
im offenen Kanalbau Rechnung<br />
getragen. Auch in diesen<br />
Bereichen sind spezielle und vertiefte<br />
Kenntnisse bei den Personen<br />
erforderlich, die mit der Ausschreibung<br />
und Bauüberwachung beauftragt<br />
sind. Die bei der Bearbeitung<br />
von Ausschreibungen und der<br />
Durchführung der Bauüberwachung<br />
zu beachtenden Punkte sind für die<br />
Beurteilungsgruppen in den entsprechenden<br />
„Leitfäden zur Eigenüberwachung“<br />
niedergeschrieben.<br />
Sie enthalten Mindestanforderungen<br />
an den Umfang der Eigenüberwachung,<br />
die <strong>sich</strong> aus den einschlägigen<br />
Normen und Regelwerken<br />
ergeben.<br />
Allerdings kann eine wirtschaftliche<br />
Sanierung nur durch eine in -<br />
tensive und sachgerechte Planung<br />
erreicht werden. „Wer Geld sparen<br />
will, muss Geld für eine qualifizierte<br />
Sanierungsplanung ausgeben“, lautet<br />
dementsprechend das Fazit von<br />
Markus Vogel. Die hierdurch entstehenden<br />
Kosten sind bereits mit dem<br />
Planungsergebnis und der Wirtschaftlichkeit<br />
der Sanierungsmaßnahme<br />
wieder refinanziert. Nach<br />
Auffassung Vogels können selbst<br />
bei umfangreichen Schäden durch<br />
eine intelligent geplante Sanierung<br />
erhebliche Kosteneinsparungen<br />
erzielt werden.<br />
Kontakt:<br />
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau,<br />
Postfach 1369,<br />
D-53583 Bad Honnef,<br />
Tel. (02224) 9384-0,<br />
Fax (02224) 9384-84,<br />
E-Mail: info@kanalbau.com,<br />
www.kanalbau.com<br />
Grabenlose Bauweise in schwierigem Gelände<br />
Anspruchsvolles Verfahren schont Natur und Zeitbudget<br />
Es ist ein Projekt mit Superlativen:<br />
Rund 500 Meter Leitungen mit<br />
der Nennweite DN 700 wurden im<br />
Berliner Südwesten im Grunewald<br />
im Horizontalspülbohrverfahren<br />
grabenlos verlegt. Die Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
(BWB) erneuern hier zur<br />
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung<br />
Berlins die Rohrwasserleitungen<br />
des <strong>Wasser</strong>werkes Tiefwerder.<br />
Die Gegebenheiten der Örtlichkeit<br />
bestimmten die ungewöhnliche<br />
Vorgehensweise: Die Trasse zum<br />
<strong>Wasser</strong>werk führt durch Waldwege<br />
mit beidseitigem Baumbestand, die<br />
für Baufahrzeuge schwer zugänglich<br />
sind. Im Bereich der Trasse sind<br />
außerdem Geländeabschnitte mit<br />
starken Höhenunterschieden zu<br />
finden. Letztlich erfordert die Lage<br />
des Projektes in der Trinkwasserschutzzone<br />
die Einhaltung besonderer<br />
wasserbehördlicher Auflagen.<br />
Diese Rahmenbedingungen stellen<br />
an den Planer der Sanierungsmaßnahme<br />
bereits vorab außerordentlich<br />
hohe Anforderungen. Die Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe beauftragten<br />
mit der Hyder Consulting GmbH<br />
Deutschland einen erfahrenen<br />
Generalplaner mit der gesamten<br />
Planung der Maßnahme sowie der<br />
Vorbereitung der Vergabe. Hyder<br />
Consulting ist seit vielen Jahren in<br />
ganz unterschiedlichen Bereichen<br />
Auftragnehmer der BWB, auch im<br />
Bereich Werke, in den dieses Projekt<br />
einzuordnen ist.<br />
<strong>Wasser</strong>werk Tiefwerder –<br />
seit 1914 in Betrieb<br />
Das <strong>Wasser</strong>werk Tiefwerder wurde<br />
im Jahr 1914 in Betrieb genommen.<br />
Es verfügt über eine Aufbereitungskapazität<br />
von 100 000 Kubikmetern<br />
pro Tag. Zwei Rohwasserleitungen<br />
transportieren das <strong>Wasser</strong> nach<br />
Tiefwerder. Die Rohwasserleitung<br />
Schildhorn mit einer Länge von<br />
5050 Metern und Nennweiten zwischen<br />
DN 400 und DN 1200 und die<br />
Rohwasserleitung Rupenhorn, 930<br />
Meter lang mit Nennweiten zwischen<br />
DN 300 und DN 600. Hiervon<br />
November 2011<br />
1096 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
waren im ersten Abschnitt 1,8 Kilometer<br />
bzw. 200 Meter zu erneuern.<br />
Für diesen zweiten und dritten<br />
Bauabschnitt beauftragten die Berliner<br />
<strong>Wasser</strong>betriebe Hyder Consulting<br />
mit den Leistungsphasen 1 bis<br />
6 nach HOAI für den Neubau einer<br />
Rohwasserleitung, die die vorhandenen<br />
Leitungen Schildhorn und<br />
Rupenhorn ersetzen sollte. Als<br />
externer Fachplaner bzw. in der<br />
Bauausführung als externe Fachauf<strong>sich</strong>t<br />
unterstützte Dipl.-Ing. Gerhard<br />
Herrmann den Planungsprozess.<br />
Eckpunkte bei der Planung:<br />
Kostenrahmen und<br />
schwieriges Gelände<br />
Die Planung der Erneuerungsmaßnahme<br />
war durch die Randbedingungen<br />
eine besonders anspruchsvolle<br />
Aufgabe. Es musste im Kostenrahmen<br />
eine Lösung gefunden<br />
werden, die in dem schwierigen<br />
Gelände technisch realisierbar war<br />
und gleichzeitig die Umwelt schonte.<br />
Im Rahmen der Vorplanung erstellte<br />
Hyder Consulting zunächst eine<br />
umfangreiche Variantenuntersuchung.<br />
Anhand einer auf der Basis<br />
dieser Untersuchung erstellten<br />
Bewertungsmatrix entschieden die<br />
Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe über das zu<br />
verwendende Material, die Trassierung<br />
und das Verlegeverfahren.<br />
Die Besonderheiten bei der<br />
Durch führung der Maßnahme sollen<br />
im Folgenden beschrieben werden.<br />
Technologie<br />
Die vorgesehene Technologie in<br />
geschlossener Bauweise (HDD Horizontal<br />
Directional Drilling) erforderte<br />
bei allen Arbeitsschritten eine<br />
hohe Leistung von den Ausführenden.<br />
So galt es bei der Pilotbohrung,<br />
den Pilotbohrkopf an der Spitze des<br />
Bohrgestänges so zu steuern, dass<br />
er genau auf der geplanten Bohrgradiente<br />
läuft. Dazu musste ständig<br />
die genaue Lage des im Bohrkopf<br />
befindlichen Empfängers in Lage,<br />
Höhe und Verrollung be stimmt werden.<br />
Zum Aufweiten des Bohrloches<br />
werden Räumer mit dem Bohrgestänge<br />
drehend durch das Bohrloch<br />
gezogen. Der Abbau der Formation<br />
vor dem Räumer erfolgt hydraulisch<br />
durch die Spülung und mechanisch.<br />
Dieser Vorgang wird so oft wiederholt,<br />
bis der erforderliche Enddurchmesser<br />
erreicht ist. Der Aufweitdurchmesser<br />
wird bei den<br />
Guss rohren bestimmt durch den<br />
Rohr durchmesser der nicht biegbaren<br />
6 Meter langen Rohre, den<br />
Muffendurchmesser, die Abwinkelbarkeit<br />
der Rohre in den Muffen,<br />
dem Überschnitt und den mitzuziehenden<br />
Rohren für das Verdämmen<br />
des Ringraumes (Tabelle 1).<br />
Für die Endaufweitung wurde<br />
ein Räumer mit einem Durchmesser<br />
von 1100 mm verwendet.<br />
Damit die Räumvorgänge in<br />
dem anstehenden Sandboden nicht<br />
zusätzlich unkontrolliert aufgeweitet<br />
werden, wurden die Räumer mit<br />
einem vorgebauten Räumer im<br />
Bohrloch zentriert (Bild 1).<br />
Beim Einziehvorgang wurde aus<br />
Platzgründen auf der Rohrseite das<br />
Anlegeverfahren gewählt. Bei diesem<br />
Verfahren wird beim Rohreinzug<br />
jedes Rohr erst mit dem bereits<br />
eingezogenen Rohrstrang am Bohrlochmund<br />
montiert. Diese Technologie<br />
erfordert einen sehr hohen<br />
Zeitaufwand, da die formkraftschlüssige<br />
Rohrverbindung mit Verriegelungen<br />
und dem Muffenschutz<br />
mit einer Schrumpfmanschette hergestellt<br />
werden muss. Für eine<br />
Rohrleitung von 500 Metern Länge<br />
sind 84 Rohrverbindungen erforderlich.<br />
Die Montagezeit pro Verbindung<br />
wird vom Hersteller mit 37<br />
Tabelle 1. Berechnung der Aufweitdurchmesser.<br />
Max. Abwinklung a = 1,50°<br />
entspricht r Bohrung = 229,18 m<br />
Rohrlänge L = 6,00 m<br />
Durchmesser Rohr D R = 0,748 m<br />
Durchmesser Muffe D M = 0,849 m<br />
Überschnitt Faktor ü 1,2<br />
Gewählter Radius r proj 230,21 m<br />
Erreichte Abwinkelung a erreicht 1,493°<br />
Bild 1. Räumer mit Zentrierung.<br />
Minuten angegeben. Hieraus ergibt<br />
<strong>sich</strong> allein für die Montage bereits<br />
eine Montagezeit von 52 Stunden<br />
für die erforderlichen Rohre. Die<br />
er<strong>rechnet</strong>e Zeit von knapp 82 Stunden<br />
für den gesamten Einziehvor-<br />
<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1097<br />
Bild 2.<br />
Muffenschutz<br />
aufschrumpfen.
Praxis<br />
gang stellte ein sehr hohes Risiko<br />
dar, da das Bohrloch während der<br />
gesamten Zeit stabil gehalten werden<br />
musste. Letztlich konnte die<br />
Einziehzeit jedoch bei der Montage<br />
unterschritten werden (Bild 2).<br />
Bild 3. Kaliber zum Prüfen des Bohrloches.<br />
Tabelle 3. Abschätzung der erforderlichen Zugkraft.<br />
F kN =G · l · f<br />
Gewichtskraft/Auftrieb G<br />
Länge l<br />
Zugkräfte<br />
Die erforderliche Zugkraft zum Einziehen<br />
des Rohres kann durch Minderung<br />
des Auftriebes des Rohres in<br />
der Spülung mit einer Ballastierung<br />
erreicht werden. In diesem Fall<br />
Tabelle 2. Die Grunddaten für die Ballastierung.<br />
Druckstufe PN K 9<br />
Durchmesser Rohr D R m 0,748<br />
Volumen m³/m 0,439<br />
Σ Masse Rohr (lt. Hersteller) M kg/m 256,83<br />
Gewichtskraft Rohr nach unten kN/m 2,52<br />
Bohrspülung, Dichte r kg/m³ 1.275<br />
Gewichtskraft Spülung kN/m³ 12,51<br />
Auftrieb im Bentonit nach oben kN/m 5,496<br />
resultierende Kraft g a -Rohr nach oben kN/m 2,98<br />
Vollwasserfüllung Di = 0,7 m kg/m 384,85<br />
Ballastierung kN/m 3,78<br />
resultierende Kraft g a -Rohr nach unten kN/m 0,80<br />
0,80 kN/m<br />
496 m<br />
Ermittlung des Faktors „f“<br />
Orientierungswerte<br />
Radien f R = am Min. 9,0 0,6 sonst 0,9<br />
Winkelsumme f W = < 30°; 0,6 – 0,9; >15° 0,7<br />
Hindernisse im Bohrverlauf f H = vorh. 0,6 – 0,9 sonst 0,7<br />
Baugrund-Reibung f B = schwierig 0,9 0,6 gut 0,7<br />
Bohrlochaufweitung (Rechenwert) f B = am Min. 0,9 0,6 sonst 0,8<br />
Spül.-Schubsp. t; bei Ø >500 mm f s = hoch 0,9- 0,6 niedrig 0,9<br />
F = 311 kN Mittelwert 0,78<br />
wurde eine Vollwasserfüllung während<br />
des Rohreinzuges gewählt<br />
(Tabelle 2).<br />
Für die erforderliche Zugkraft<br />
wurde abgeschätzt (s. Tabelle 3).<br />
Bei einem Sicherheitsbeiwert<br />
von S i = 1,5 ergibt <strong>sich</strong> eine zu<br />
erwartende Zugkraft von 467 kN.<br />
Um diese Zugkräfte zu erreichen,<br />
müssen jedoch ideale Bedingungen<br />
vorhanden sein. Das bedeutet, dass<br />
das Bohrloch frei von zusätzlichen<br />
Richtungsänderungen sein muss.<br />
Das gelöste Bohrklein muss vollständig<br />
aus dem Bohrloch ausgetragen<br />
sein. Und die Kaliberhaltigkeit<br />
des Bohrlochs muss durchgängig<br />
vorhanden sein. Zur Prüfung der<br />
Beziehbarkeit des Bohrlochdurchmessers<br />
wurde ein Kaliber mit<br />
einem Durchmesser der Rohrmuffe<br />
und der Rohrlänge vor dem<br />
Rohreinzug durch das Bohrloch<br />
gezogen (Bild 3).<br />
Die abgeschätzten erforderlichen<br />
Zugkräfte wurden beim Einziehen<br />
nicht erreicht. Eine genaue<br />
Messung war aufgrund eines Defektes<br />
am Messgerät nicht möglich.<br />
Anforderung an die Spülung<br />
An die Spülung mussten besondere<br />
Anforderungen hin<strong>sich</strong>tlich<br />
des Einsatzes im Trinkwassereinzugsgebietes<br />
Schutzzone I, II und<br />
IIIA gestellt werden. Außerdem<br />
mussten die Spülung und die beigesetzten<br />
Additive den Abtrag der<br />
Formation und Bohrlochreinigung,<br />
die Bohrlochstabilisierung, die<br />
Schmierung und Kühlung sowie<br />
den Schutz vor Korrosion <strong>sich</strong>ern.<br />
Vor der Freigabe waren umfangreiche<br />
Untersuchungen erforderlich.<br />
Die Dichte r der mit Bohrklein<br />
beladenen Bentonit-Spülung<br />
betrug 1,275 [kg/dm³].<br />
Dimensionierung<br />
der Bohrmaschine<br />
Um die Bohrmaschinengröße festzulegen,<br />
mussten verschiedene Kriterien<br />
beachtet werden. Die erforderliche<br />
Zugkraft musste ge<strong>sich</strong>ert<br />
sein sowie das erforderliche Drehmoment<br />
zum Drehen eines Räu-<br />
November 2011<br />
1098 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
INFO<br />
Auftraggeber:<br />
Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe<br />
Planungszeitraum:<br />
Mai 2009 bis Oktober 2010<br />
Informationen zum Projekt:<br />
berlin@hyderconsulting.com<br />
oder<br />
www.hyderconsulting.de<br />
mers von 1100 mm Durchmesser<br />
und einer Länge von 500 Metern.<br />
Die Bohrmaschine musste ein drahtgebundenes<br />
Ortungssystem aufnehmen<br />
können, wozu das Bohrgestänge<br />
über einen Durchmesser von<br />
über 85 mm verfügen muss. Letztlich<br />
war eine Pumpleistung der Spülungspumpe<br />
zum Austragen des<br />
gelösten Bohrkleins mit einer Leistung<br />
von über 800 Litern pro Minute<br />
erforderlich. Ausgewählt wurde<br />
eine Bohrmaschine mit 100 kN Zugkraft<br />
(Bild 4).<br />
Trassierung<br />
Für die Trassierung von Gussrohrleitungen<br />
sind der Radius der Bohrgradiente<br />
und die Bohrlänge die<br />
bestimmenden Parameter. In der<br />
Trassierung waren sowohl vertikale<br />
als auch horizontale Richtungsänderungen<br />
an der Grenze der zulässigen<br />
Biegeradien vorhanden. Die<br />
vorhandenen Zwangspunkte und<br />
das <strong>Wasser</strong>einzugsgebiet boten<br />
wenig Spielraum für die Planung<br />
der Bohrgradiente. Zwangspunkte<br />
für die Planung der Bohrgradiente<br />
waren die vorhandenen Grunddienstbarkeiten,<br />
die Bebauung<br />
unmittelbar neben der Trasse auf<br />
einer Länge von 70 Metern sowie<br />
diverse Fremdanlagen in einer<br />
Länge von 210 m, 5 m über geplanter<br />
Leitung, darunter eine Rohwasserleitung,<br />
vier Stromkabel, eine<br />
Gasleitung DN 100, eine TW-Leitung<br />
Grauguss DN 100 sowie Telekom-<br />
Kabel. Es musste also eine Ortung<br />
unter den zahlreichen Fremdanlagen<br />
mit sehr großen ferromagnetischen<br />
Massen und elektromagnetischen<br />
Feldern vorgenommen<br />
werden. Hierfür wurde ein Ortungssystem<br />
auf der Basie elektromagnetischer<br />
Messung eingesetzt,<br />
das „DIGITRAK ECLIPSE Steuerungs-System<br />
SST“, mit erstaunlich<br />
guten Messergebnissen, was durch<br />
die Nachmessung mit einem Kreiselkompass<br />
in dem verlegten Rohr<br />
bestätigt wurde.<br />
Bauablauf<br />
Der Bauablauf wurde durch die Witterungsbedingungen<br />
stark beeinflusst.<br />
Das Bauvorhaben wurde im<br />
November 2010 begonnen und<br />
musste im Dezember wegen zu<br />
niedrigen Temperaturen (unter<br />
–10 °C) abgebrochen werden. Eine<br />
besondere Herausforderung be -<br />
stand in der Spülungsrückführung<br />
von der Zielseite zu der Recyclinganlage<br />
auf der Startseite. Die oberirdisch<br />
verlegte Leitung fror trotz<br />
Einhausung mit Heizung und Mehrschichtbetrieb<br />
immer wieder ein.<br />
Bis zu diesem Zeitpunkt war die<br />
Aufweitung des Bohrloches auf<br />
einen Durchmesser von 1100 mm ø<br />
abgeschlossen. Die nun folgende<br />
Unterbrechung barg die Gefahr,<br />
dass das Bohrloch bei längerer<br />
Standzeit zusammenfällt, das Bohrgestänge<br />
fest wird und Setzungen<br />
entstehen können. Die Arbeiten<br />
wurden im Februar 2011 wieder<br />
aufgenommen – das Bohrloch<br />
stand, es war kein Schaden eingetreten.<br />
Dazu war es notwendig, die<br />
entsprechenden Maßnahmen zum<br />
Arbeiten bei Dauerfrost zu treffen.<br />
So wurde zum Beispiel die gesamte<br />
Bohrmaschine mit einem Zelt eingehaust.<br />
Erschwerend war auch das<br />
Hochwasser der Havel, was bis zur<br />
Zielgrube reichte (Bild 5).<br />
Fazit<br />
Durch das von Hyder Consulting<br />
entwickelte Konzept und hierin<br />
umgesetzte Verfahren, wurden die<br />
Eingriffe in Natur und Landschaft<br />
trotz der schwierigen Randbedingungen<br />
in der Umgebung auf ein<br />
Bild 4. Verankerte Bohrmaschine.<br />
Bild 5. Trasse zum Vorstrecken bei Hochwasser.<br />
Minimum reduziert und die Bauzeit<br />
deutlich verringert. Zudem konnte<br />
die Baumaßnahme in diesem sensiblen<br />
Umweltbereich erfolgreich<br />
abgeschlossen werden, obgleich<br />
die extreme Witterung für eine zeitweise<br />
Unterbrechung und immer<br />
neue Probleme sorgte.<br />
Autoren:<br />
Dipl.-Ing. (FH) André Beutler,<br />
Hyder Consulting GmbH Deutschland<br />
Dipl.-Ing. Gerhard Herrmann<br />
Barbara Olfe-Kräutlein,<br />
Hyder Consulting GmbH Deutschland<br />
Kontakt:<br />
Hyder Consulting GmbH Deutschland,<br />
Grunewaldstraße 61–62, D-10825 Berlin,<br />
Tel. (030) 670521-0, Fax (030) 670521-11,<br />
E-Mail: berlin(at)hyderconsulting.com,<br />
www.hyderconsulting.de<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1099
Praxis<br />
Duktile Guss-Rohrsysteme: Nachhaltig überlegen<br />
Bild 1.<br />
Gussrohre<br />
benötigen<br />
keine<br />
Sandbettung.<br />
Vor etwa 150 Jahren wurde in<br />
Europa die städtische Versorgungsinfrastruktur<br />
für Gas und<br />
Trinkwasser beinahe ausschließlich<br />
mit Gussrohren aufgebaut. Ein<br />
wesentlicher Teil der heutigen Versorgungsnetze<br />
stammt noch aus<br />
jener Zeit. In den Jahren hat <strong>sich</strong> das<br />
Gussrohr-System entscheidend weiterentwickelt:<br />
Die Herstellverfahren<br />
haben <strong>sich</strong> den gestiegenen Anforderungen<br />
an Maßhaltigkeit, Wanddickenverminderung,<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
angepasst. Die Verbindungstechnik<br />
wurde <strong>sich</strong>erer und einfacher.<br />
Der Siegeszug des Gussrohrs vom<br />
damaligen Graugussrohr bis hin<br />
zum modernen, duktilen Gussrohr<br />
spiegelt Industriegeschichte wider<br />
und zeigt eindrücklich die Qualitäten<br />
und die vielen unübersehbaren<br />
Vorteile des duktilen Gusseisens,<br />
das wie kein anderer Rohrwerkstoff<br />
den belegbaren Beweis seiner Langlebigkeit<br />
angetreten hat.<br />
Im Laufe der Jahre sind neben<br />
dem duktilen Gusswerkstoff eine<br />
Reihe anderer Werkstoffe für Rohre<br />
entwickelt worden, die Trink- und<br />
<strong>Abwasser</strong> transportieren, die aber<br />
bei näherer Betrachtung keine<br />
wesentlichen Vorteile gegenüber<br />
dem Traditionswerkstoff vorweisen<br />
können. Im Gegenteil, in puncto<br />
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit,<br />
Schadensanfälligkeit und Nachhaltigkeit<br />
gibt es derzeit keinen Rohrwerkstoff,<br />
der eine höhere Leistungsfähigkeit<br />
besitzt als duktiles<br />
Gusseisen. Dies gilt für Rohre für<br />
Trinkwasser als Leitungsmedium,<br />
dessen höchste Qualität und Reinheit<br />
gewährleistet sein muss, ebenso<br />
wie für <strong>Abwasser</strong>, das <strong>sich</strong>er zu<br />
den Klär- und Reinigungsanlagen<br />
zu transportieren ist. Es gilt gleichermaßen<br />
für Formstücke und<br />
Armaturen aus duktilem Gusseisen,<br />
die durch ihre Zuverlässigkeit den<br />
Leitungsbau unterstützen und<br />
nachhaltig <strong>sich</strong>er machen.<br />
Klare Kostenvorteile<br />
Gerade in jüngster Vergangenheit<br />
wird seitens einiger Konkurrenzwerkstoffe<br />
das Argument eines<br />
preislichen Vorteils ins Feld geführt.<br />
Ein vermeintlicher Vorteil, der Kommunen<br />
und Versorgungsunternehmen<br />
in Zeiten knapper Budgets<br />
zu kurzfristigen Entscheidungen<br />
bewegt. Bei näherem Hinsehen<br />
erweist <strong>sich</strong> das Preisargument<br />
jedoch als Trugschluss, weil oftmals<br />
mittel- bis langfristige Effekte übersehen<br />
werden und dadurch die Verantwortung<br />
für kommende Generationen<br />
außer Acht gerät.<br />
Wie beispielsweise Untersuchungen<br />
zum Kostenvergleich zwischen<br />
Kunststoffrohren und Rohren aus<br />
duktilem Gusseisen über einen<br />
Nutzungszeitraum von 15 Jahren<br />
gezeigt haben, überwiegen spätestens<br />
ab der Nennweite DN 200 die<br />
Vorteile von duktilen Gussrohren<br />
ganz deutlich und heben <strong>sich</strong> bei<br />
größeren Nennweiten immer weiter<br />
ab. Bei DN 400 kann <strong>sich</strong> beim<br />
Einsatz von duktilen Gussrohren<br />
gegenüber Rohren aus Kunststoffen<br />
innerhalb dieses Zeitraums ein Kostenvorteil<br />
von mehr als 20 % errechnen<br />
[1]. Dieser wird unter anderem<br />
durch eine höhere Einbauleistung<br />
erreicht. Gussrohrleitungen mit<br />
ihrer einfach zu handhabenden Verbindungstechnik<br />
können schnell<br />
und witterungsunabhängig eingebaut<br />
werden. PE-Rohre dagegen,<br />
deren Verbindungen geschweißt<br />
werden müssen, generieren einen<br />
deutlich höheren Aufwand u. a. für<br />
das dafür notwendige, zertifizierte<br />
November 2011<br />
1100 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
Fachpersonal. Zudem sind wegen<br />
der Schweißarbeiten trockene Wetterverhältnisse<br />
notwendig, was bei<br />
ungünstigen Bedingungen zu Mehraufwendungen<br />
bei den Schweißarbeiten<br />
führt und damit die Einbauleistung<br />
herabsetzt.<br />
Das robuste Guss-Rohrsystem<br />
benötigt keine Sandbettung (Bild 1).<br />
Je nach Art des Außenschutzes<br />
kann der Grabenaushub sogar mit<br />
Korngrößen bis 100 mm zum Einbau<br />
wieder verwendet werden [2].<br />
Bei den Kunststoffrohren ist diese<br />
Frage noch immer umstritten: Während<br />
laut Anhang G des DVGW-<br />
Arbeitsblattes W 400-2 für PE-Rohre<br />
> DN 200 die Korngröße auf 40 mm<br />
(Rundkorn) begrenzt wird, werden<br />
laut [3] „Kunststoffrohre entsprechend<br />
dem aktuellen Regelwerk<br />
zum Schutz vor mechanischen<br />
Beschädigungen in einem Sandbett<br />
verlegt. Ohne dieses Sandbett würden<br />
die Rohre durch äußere Belastungen<br />
oder Druckänderungen<br />
zum Teil sehr stark beansprucht“ [3].<br />
Das Rohrumhüllungsmaterial muss<br />
hier also so beschaffen sein, dass<br />
das druckbeaufschlagte Medienrohr<br />
vor äußeren Beschädigungen<br />
geschützt ist. So entstehen zusätzliche<br />
Material- und Transportkosten,<br />
die bei Gussrohren entfallen.<br />
Gussrohrleitungen kommen bei<br />
normalen Einbaubedingungen und<br />
mit schubge<strong>sich</strong>erten Verbindungen<br />
ohne Betonwiderlager aus – ein<br />
weiterer Kostenvorteil, der <strong>sich</strong> auf<br />
die Wirtschaftlichkeit der Rohrleitung<br />
auswirkt (Bild 2).<br />
Langfristig, wie die oben ge -<br />
nannten Untersuchungen und auch<br />
die Schadensstatistik des DVGW<br />
ausweisen, haben Gussrohre zudem<br />
erheblich niedrigere Fehler- und<br />
Schadensquoten. Die DVGW-Schadensstatistik<br />
<strong>Wasser</strong> [4] (Erhebungsjahr<br />
1997 bis 2004, Bundesrepublik<br />
Deutschland gesamt) gibt eine<br />
Schadensrate (Anzahl Schäden pro<br />
100 km) von 4 bei duktilen Gussrohren<br />
im Jahr 2004 an. Bei PE-HD liegt<br />
die Rate um 50 % höher, nämlich bei<br />
6. Der Anteil Beschädigungen durch<br />
Fremdeinwirkung liegt bei Gussrohren<br />
lediglich bei etwa 5 %, während<br />
er bei PE-HD bei ungefähren 18 %<br />
liegt.<br />
Deutlicher können die Vorteile<br />
von Gussrohrleitungen kaum be -<br />
schrieben werden.<br />
Die Entscheidung für duktile<br />
Gussrohr-Systeme liefert daher ein<br />
nachhaltiges Investitionsergebnis,<br />
da auch Kosten für Wartung und<br />
Reparaturen langfristig eingespart<br />
werden.<br />
Hinzu kommen „nicht rechenbare“<br />
Vorteile in ökologischer und<br />
hygienischer Hin<strong>sich</strong>t, die das Gussrohr<br />
auch in den kleinsten Nennweiten<br />
zur überlegenen Investitionsalternative<br />
werden lassen.<br />
Sicherheit im Untergrund –<br />
Verantwortung für die<br />
Umwelt<br />
Der Grundstoff für duktiles Gusseisen<br />
ist recycelter, vorsortierter<br />
Stahlschrott. Anders als bei Rohren<br />
aus Kunststoffen müssen dafür<br />
praktisch keine originären oder fossilen<br />
Rohstoffe eingesetzt werden,<br />
sodass die Inanspruchnahme natürlicher<br />
Ressourcen und CO 2 -Emissionen<br />
gesenkt werden. Duktile Gussrohre<br />
leisten einen positiven Beitrag<br />
zur Ökobilanz.<br />
Von Wichtigkeit bei der ökologischen<br />
und hygienischen Betrachtung<br />
ist die Diffusionsdichtigkeit<br />
des duktilen Gusseisens. Dies ist für<br />
den Trinkwasserschutz und für<br />
<strong>Abwasser</strong>leitungen ein unschlagbares<br />
Argument. PE-Rohre sind z. B.<br />
bei der Diffusion gegenüber Chlorkohlenwasserstoffen<br />
etwa 1000-<br />
mal durchlässiger als duktiles Gusseisen<br />
[5].<br />
Bild 2. Gussrohr mit Zementmörtel-Umhüllung<br />
und längskraftschlüssiger Verbindung<br />
Duktile Gussrohre geben darüber<br />
hinaus durch ihre Auskleidungen<br />
(Polyurethan nach EN 15655 [6]<br />
sowie Mörtel auf Basis Hochofenzement<br />
für die Trinkwasserversorgung<br />
[7] bzw. Tonerdezement [8] für die<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung) eine Garantie<br />
für hygienisch-ökologische Betriebsweise.<br />
Lange Lebensdauer –<br />
vermiedene Aufwendungen<br />
in der Zukunft<br />
Wie kein anderer Rohrwerkstoff<br />
kann duktiles Gusseisen seine Langlebigkeit<br />
und damit seine über<br />
Generationen andauernde Sicherheit<br />
praktisch beweisen. Die technische<br />
Nutzungsdauer für duktile<br />
Gussrohre beträgt bis zu 140 Jahre.<br />
Legt man duktile Gussrohre mit<br />
ihren hochwertigen Umhüllungen<br />
""<br />
Zementmörtel-Umhüllung<br />
(ZM-U) nach EN 15542 [9] und<br />
""<br />
Polyurethan (PUR) nach<br />
EN 15189 [10]<br />
zugrunde, wird diese Lebensdauer<br />
besonders eindrücklich unterstrichen.<br />
So wurden in einer systematischen<br />
Untersuchung die äußeren<br />
Oberflächen von Rohren nach bis zu<br />
32 Jahren Betriebsdauer untersucht<br />
und Proben des jeweils anstehenden<br />
Bodens und des verwendeten<br />
Umhüllungsmaterials zur Untersuchung<br />
nach DIN 50929, Teil 3, entnommen.<br />
Bei allen Ausgrabungen<br />
zeigte <strong>sich</strong>, dass die mit Zementmörtel<br />
umhüllten Rohre nach 25 bis<br />
32 Jahren Nutzungsdauer dem Neuzustand<br />
entsprachen und keinerlei<br />
Korrosionsschäden aufwiesen [11].<br />
Ähnliche Untersuchungen zum<br />
praktischen Nachweis der Langzeit-<br />
<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1101
Praxis<br />
beständigkeit der PUR-Umhüllung<br />
laufen in der Schweiz. Seit über<br />
20 Jahren werden in Zürich zwei<br />
Versuchsstrecken betrieben. Sie stehen<br />
kontinuierlich unter Überwachung<br />
durch die Schweizerische<br />
Bild 3. Montage einer Muffenverbindung DN 125 in<br />
einem Berstlining-Projekt.<br />
Zugkraft [kN]<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
zulässige Zugkräfte (GW 323)<br />
PE-Xa<br />
SDR 11<br />
PE 100<br />
SDR 11<br />
Werkstoff<br />
St 37<br />
GGG<br />
400<br />
300<br />
200<br />
150<br />
100 Nennweite<br />
Bild 4. Zulässige Zugkräfte von Rohrleitungen bei<br />
den grabenlosen Einbau- und Erneuerungsverfahren.<br />
Bild 5. Formstücke und Armaturen aus duktilem<br />
Gusseisen.<br />
Gesellschaft für Korrosionsschutz<br />
SGK. Dabei werden die Schutzpotenziale<br />
und die Erdübergangswiderstände<br />
der mit PUR umhüllten<br />
Rohre in verschiedenen Böden<br />
gemessen. Diese Felduntersuchungen<br />
zeigen in allen untersuchten<br />
Bettungen ein konstant gutes Verhalten<br />
der mit Polyurethan umhüllten<br />
duktilen Gussrohre [12].<br />
Alle Untersuchungen erlauben<br />
den Schluss, dass diese hochwertig<br />
umhüllten Guss-Rohrsysteme eine<br />
technische Nutzungsdauer von 100<br />
bis 140 Jahren mit Sicherheit erreichen<br />
werden.<br />
Ein Blick in die vorindustrielle<br />
Zeit fördert ein weiteres beachtliches<br />
Ergebnis zu Tage: Im Jahre<br />
1783 veranlasste Clemens Wenzeslaus,<br />
Erzbischof und Kurfürst von<br />
Trier, den Bau einer <strong>Wasser</strong>leitung<br />
zur Versorgung der öffentlichen<br />
Brunnen für die Stadt Koblenz. Die<br />
so genannte Metternicher <strong>Wasser</strong>leitung<br />
bestand aus gusseisernen<br />
Muffenrohren in Baulängen von<br />
1,5 Metern mit einem Durchmesser<br />
von 80 Millimetern. Als diese Leitung<br />
nach mehr als 150 Jahren 1934<br />
freigelegt wurde, stellte <strong>sich</strong> heraus,<br />
dass das Rohrmaterial nach der langen<br />
Betriebszeit noch in bestem<br />
Zustand war. Der damalige Oberbürgermeister<br />
bestätigte dies in<br />
einem offiziellen Schreiben an den<br />
„Deutschen Gußrohr-Verband“<br />
(heute: die europäische Fachgemeinschaft<br />
Guss-Rohrsysteme EADIPS®,<br />
www.eadips.org) [13].<br />
PE-Rohren wird eine Nutzungsdauer<br />
von rund 60 Jahren unterstellt.<br />
Das ist weniger als die Hälfte der<br />
beweisbaren Lebensdauer von duktilen<br />
Gussrohren. Reinvestitions- und<br />
Sanierungsbudgets können beim<br />
Einsatz von Gussrohren demnach<br />
deutlich geringer angesetzt werden.<br />
Grabenlose Einbautechniken<br />
und Leitungen mit hoher<br />
Beanspruchung<br />
Grabenlose Einbautechniken haben<br />
europaweit mittlerweile eine große<br />
Bedeutung erlangt. Zur Vermeidung<br />
von Baulärm und Verkehrsbehinderungen<br />
in innerstädtischen<br />
Bereichen und bei der Unterquerung<br />
von Hindernissen wie Straßen<br />
oder Flüssen sind grabenlose<br />
Bauweisen bei der Erneuerung von<br />
Druckrohrleitungen nicht mehr<br />
wegzudenken. Sie sind kostengünstig<br />
und umweltschonend. Ihre Entwicklung<br />
ist untrennbar mit dem<br />
duktilen Gussrohr und dessen Verbindungen<br />
und Außenschutzarten<br />
verbunden. Aufgrund ihrer hohen<br />
mechanischen Belastbarkeit sind<br />
duktile Gussrohre mit längskraftschlüssigen<br />
Verbindungen beim<br />
grabenlosen Einbau (Bild 3) jedem<br />
anderen Werkstoff deutlich überlegen,<br />
was <strong>sich</strong> auch in der zulässigen<br />
Zugkraft zeigt (Bild 4).<br />
Diese Überlegenheit zeigt <strong>sich</strong><br />
auch bei anderen Hochleistungsanwendungen.<br />
Da die Druckstabilität bei Kunststoffrohren<br />
limitiert ist, können sie<br />
beispielsweise für Turbinenleitungen,<br />
die hohen Drücken standhalten<br />
müssen und meist in topografisch<br />
schwierigem Gelände eingebaut<br />
werden, nur sehr bedingt oder<br />
gar nicht eingesetzt werden.<br />
Duktile Gussrohre dagegen sind<br />
aufgrund ihrer Werkstoffeigenschaften<br />
und der zur Verfügung stehenden<br />
Außenschutzvarianten selbst in<br />
felsigem Gelände problemlos einbaubar<br />
und für Betriebsdrücke von<br />
bis zu über 100 bar geeignet. Diese<br />
Vorteile werden nicht nur bei Leitungen<br />
für Beschneiungsanlagen,<br />
die <strong>sich</strong> meist im alpinen Gelände<br />
befinden, und bei Feuerlöschleitungen,<br />
die ein feuerfestes Rohrmaterial<br />
voraussetzen, deutlich, sondern<br />
gelten im Grundsatz für die Sicherheitsreserven<br />
jeder Druckleitung<br />
aus duktilem Gusseisen in der kommunalen<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft.<br />
Fazit<br />
Duktiles Gusseisen ist ein in allen<br />
Anwendungen der Rohrleitungstechnik<br />
und der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
einsetzbarer Werkstoff und kann<br />
aufgrund seiner überlegenen technischen<br />
Eigenschaften, der Kosten<br />
sparenden Beschichtungs- und Ver-<br />
November 2011<br />
1102 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Praxis<br />
bindungstechnik sowie des zur Verfügung stehenden<br />
kompletten Formstück- und Armaturensortiments in<br />
allen Bereichen langfristige Sicherheit garantieren<br />
(Bild 5).<br />
Der Traditionswerkstoff Guss ist moderner denn je,<br />
weil er den Anforderungen der Zukunft auf Ressourcenschonung<br />
und auf langfristige Kostenvorteile und damit<br />
echter Nachhaltigkeit entspricht.<br />
Literatur<br />
[1] Wegener, Th. und Böge, M.: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
an Rohrleitungen. GUSSROHR-TECHNIK 41 (2007), S. 45.<br />
[2] DVGW Arbeitsblatt W 400-2: Technische Regeln <strong>Wasser</strong>verteilungsanlagen<br />
(TRWV); Teil 2: Bau und Prüfung 2004-09 .<br />
[3] DVGW Technologie Report Nr. 4/ 2008: Kunststoffmaterialien<br />
in der Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung.<br />
[4] Niehues, B.: DVGW-Schadensstatistik <strong>Wasser</strong>. Ergebnisse aus<br />
den Jahren 1997 bis 2004. energie wasser-praxis 10 (2006),<br />
S.18–23.<br />
[5] Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und<br />
Forsten des Landes Baden-Württemberg (Hrsg.): Umgang<br />
mit leichtflüchtigen chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen<br />
– Leitfaden. H. 15, Stand Dezember 1984,<br />
Nachdruck Dezember 1986.<br />
[6] EN 15655: Rohre, Formstücke und Zubehörteile aus duktilem<br />
Gusseisen – Polyurethan-Auskleidung von Rohren und<br />
Formstücken – Anforderungen und Prüfverfahren – 2009.<br />
[7] EN 545: Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen<br />
und ihre Verbindungen für <strong>Wasser</strong>leitungen – Anforderungen<br />
und Prüfverfahren – 2010.<br />
[8] EN 598: Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen<br />
und ihre Verbindungen für die <strong>Abwasser</strong>-Entsorgung<br />
– Anforderungen und Prüfverfahren – 2009.<br />
[9] EN 15542: Rohre, Formstücke und Zubehör aus duktilem<br />
Gusseisen – Zementmörtelumhüllung von Rohren – Anforderungen<br />
und Prüfverfahren – 2008.<br />
[10] EN 15189: Rohre, Formstücke und Zubehör aus duktilem<br />
Gusseisen – Polyurethanumhüllung von Rohren – Anforderungen<br />
und Prüfverfahren – 2006.<br />
[11] Rink, W.: Untersuchungen an Rohren aus duktilem Gusseisen<br />
mit Zementmörtel-Umhüllung nach drei Jahrzehnten<br />
Betriebszeit. FGR®/EADIPS® GUSS-ROHRSYSTEME 45 (2011),<br />
S. 29.<br />
[12] SGK (Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz),<br />
unveröffentlichter Bericht 07’044-2, ecopur-Rohre in der<br />
Grossmannstraße, Messergebnisse bis 2007, Zürich 27.07.07.<br />
[13] Gußeiserne Druckrohre – Entwicklung · Herstellung · Verwendung.<br />
Herausgeber: Fachgemeinschaft Gußeiserne<br />
Rohre, Köln, 1954.<br />
Autor:<br />
Dipl.-Kfm. Ulrich Päßler,<br />
Vorsitzender des Vorstandes der<br />
Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme (FGR®)/<br />
European Association for Ductile Iron Pipe Systems EADIPS®,<br />
Im Leuschnerpark 4, D-64347 Griesheim,<br />
www.eadips.org<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und<br />
Verfahren im Bereich der Gas- und <strong>Wasser</strong>versorgung, der<br />
<strong>Abwasser</strong>entsorgung, der Nah- und Fernwärmeversorgung,<br />
des Anlagenbaus und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.3r-rohre.de<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-rohre.de<br />
3R erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen
Produkte und Verfahren<br />
Neue, hochdynamische Rückschlagarmatur für<br />
optimalen Schutz wichtiger Anlagen-Komponenten<br />
und höhere Effizienz<br />
Clasar-Armatur.<br />
Über Tyco Flow Control<br />
Mit der neuen Clasar-Rückschlagarmatur<br />
stellt Tyco<br />
Valves & Controls einen innovativen<br />
Rückflussverhinderer vor, der <strong>sich</strong><br />
durch besseres Leistungsverhalten,<br />
höhere Standzeiten und niedrigere<br />
Betriebskosten auszeichnet. Dank<br />
einer speziellen Konstruktion mit<br />
hervorragendem Dynamikverhalten<br />
minimiert die neue Armatur den<br />
Rückfluss und reduziert so das<br />
Tyco Flow Control, eine Geschäftseinheit von<br />
Tyco International Ltd. (NYSE: TYC), ist ein weltweit<br />
führender Hersteller und Anbieter von Armaturen<br />
und Antriebstechnik, <strong>Wasser</strong>- und Umweltsystemen<br />
sowie Wärmemanagementlösungen. Das<br />
Unternehmen bedient zentrale Branchen wie den<br />
Energiesektor, die <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Bergbau,<br />
Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie das<br />
Bauwesen. Tyco Flow Control beschäftigt über<br />
15 000 Mitarbeiter an über 300 Standorten auf der<br />
ganzen Welt.<br />
Risiko von Druckstoßschäden. Der<br />
Anwender profitiert dadurch von<br />
einer höheren Gesamteffizienz im<br />
Anlagenbetrieb.<br />
Die Clasar-Armatur ist mit einer<br />
leichten, federbelasteten Axialscheibe<br />
aus Polyurethan ausgestattet,<br />
die dank kurzem Stellweg sehr<br />
kurze Schließzeiten sowie ein dynamisches,<br />
schlagfreies Schließverhalten<br />
ermöglicht.<br />
Dank der Federkonstruktion eignet<br />
<strong>sich</strong> die Clasar-Armatur für eine<br />
horizontale, vertikale oder diagonale<br />
Einbaulage. Ihre hohe Durchflusskapazität<br />
und die sehr robuste<br />
Bauweise für Drücke bis 50 bar sorgen<br />
für verbesserte Zuverlässigkeit<br />
sowie niedrigere Energiekosten und<br />
bieten dem Anbieter somit entscheidende<br />
Vorteile gegenüber herkömmlichen<br />
Rückschlagklappen.<br />
Mit ihrem dynamischen Schließverhalten<br />
eignet <strong>sich</strong> die neue Armatur<br />
ideal für Risikoanwendungen mit<br />
großer Druckhöhe, etwa bei Stationen<br />
aus mehreren Pumpen. Die spezielle<br />
Bauart mit reibungsfrei schließender<br />
Axialscheibe reduziert dabei<br />
die Instandhaltungskosten und steigert<br />
gleichzeitig die Zuverlässigkeit.<br />
Die hohe Korrosionsbeständigkeit<br />
der Clasar-Armaturen ermöglicht<br />
einen vielfältigen Einsatz in<br />
<strong>Wasser</strong>leitungen einschließlich Seewasser<br />
und Betriebswasser für<br />
industrielle Anwendungen. Sie ist<br />
für den Einsatz im Trinkwasser<br />
geeignet und ist WRAS und ACS<br />
zugelassen. Die in Nennweiten bis<br />
DN 1800 lieferbaren Rückschlagarmaturen<br />
werden typischerweise<br />
hinter einer Pumpe installiert, um<br />
Schäden durch Rückströme zu verhindern.<br />
Ihr Anwendungsbereich<br />
erstreckt <strong>sich</strong> dabei von Standard-<br />
Einsatzfällen bis hin zu Hochrisiko-<br />
Aufgabenstellungen an Leitungen<br />
mit mehreren Pumpen.<br />
Rückschlagarmaturen zählen zu<br />
den wichtigsten Schutzkomponenten<br />
für mechanische Apparate und<br />
werden in vielen Systemen zur<br />
Rückflussverhinderung eingesetzt.<br />
Spezifikationsfehler können dabei<br />
zu schwerwiegenden Schäden am<br />
Leitungssystem führen. Eine falsche<br />
Auslegung der Armatur birgt das<br />
Risiko kostspieliger Schäden an<br />
Pumpen, Rohrleitungen, Halterungen<br />
und anderen Anlagenkomponenten<br />
durch plötzlichen Druckanstieg<br />
und Druckstoß. Die unter der<br />
Marke SAPAG vertriebene Clasar-<br />
Armatur von Tyco Valves & Controls<br />
wurde speziell entwickelt, um das<br />
Risiko derartiger Schäden zu minimieren.<br />
René van der Gaag, Produktmanager<br />
Special Service Valves bei Tyco<br />
Flow Control, kommentiert die Einführung<br />
wie folgt: „Mit ihrer in -<br />
telligenten Konstruktion und Tech -<br />
no logie stellen die Clasar-Armaturen<br />
unsere neueste Innovation im<br />
Bereich der Rückschlagarmaturen<br />
dar. Insbesondere für Anwendungen<br />
im Versorgungssektor und in der<br />
Prozessindustrie bieten sie eine<br />
Reihe klarer Vorteile. Viele Problempunkte<br />
herkömmlicher Rückschlagklappen<br />
sind hier durch die spezielle<br />
Bauart von vornherein ausgeschlossen.<br />
Unsere Kunden profitieren<br />
dadurch mit besserem Leistungsverhalten,<br />
höheren Standzeiten und<br />
niedrigeren Betriebskosten.“<br />
Weitere Informationen:<br />
www.tycoflowcontrol.com<br />
November 2011<br />
1104 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Heute schon Know-how geshoppt?
Produkte und Verfahren<br />
Bürkert entwickelt neue Serie von Magnetventilen<br />
für Flüssigkeiten und Gase<br />
Der Fluidtechnikspezialist Bürkert<br />
erweitert sein Magnetventilprogramm<br />
mit der neuen Serie 6200<br />
und setzt damit neue Maßstäbe in<br />
der Aktorik. Die ersten beiden Ventile<br />
der Serie, die Typen 6213EV und<br />
6281EV, sind jetzt lieferbar.<br />
Die Ventile des Typs 6213EV werden im Standardprogramm<br />
aus Messing und Edelstahl angeboten<br />
und öffnen ohne Differenzdruck.<br />
Die Ventile des Typs 6281EV werden im Standardprogramm<br />
aus Messing und Edelstahl angeboten<br />
und lassen <strong>sich</strong> zudem auch in explosionsgefährdeten<br />
Bereichen einsetzen.<br />
Die Magnetventile der neuen<br />
Produktserie 6200 von Bürkert eignen<br />
<strong>sich</strong> für ein breites Spektrum<br />
von Standardanwendungen mit<br />
flüssigen und gasförmigen Medien.<br />
Typische Einsatzbereiche sind <strong>Wasser</strong>-<br />
und Druckluft- oder Vakuumanlagen<br />
wie beispielsweise Waschstraßen,<br />
die Trinkwasseraufbereitung,<br />
die Schwimmbadtechnik<br />
oder Heiz- und Kühlaggregate. Bei<br />
geeigneter Werkstoffwahl stehen<br />
auch Lösungen für aggressive<br />
Medien zur Verfügung. Die Serie<br />
6200 ist modular aufgebaut und<br />
bietet maximale Flexibilität mit<br />
maßgeschneiderten Lösungen für<br />
eine Vielzahl von Anwendungen.<br />
Das über<strong>sich</strong>tlich und einheitlich<br />
strukturierte Produktprogramm er -<br />
möglicht Anwendern die schnelle<br />
und <strong>sich</strong>ere Auswahl des richtigen<br />
Ventils.<br />
Dank minimierter Einbaulängen<br />
und extrem kompaktem Design lassen<br />
<strong>sich</strong> die neuen Magnetventile<br />
auch unter beengten Einbauverhältnissen<br />
vielseitig einsetzen. Das<br />
spezielle Bürkert-Ventildesign ga -<br />
rantiert auch bei kleinen Prozessanschlüssen<br />
einen maximalen Durchflusswert<br />
bei geringem Druckverlust.<br />
Ausführungen in Messing<br />
oder Edelstahl<br />
Die Ventile der Typen 6213EV und<br />
6281EV werden im Standardprogramm<br />
aus Messing und Edelstahl<br />
angeboten. Insbesondere für<br />
Anwendungen mit erhöhten Anforderungen<br />
an die chemische Beständigkeit<br />
stellt Edelstahl häufig die<br />
einzige Lösung dar. Das Ventil<br />
6281EV lässt <strong>sich</strong> zudem auch in<br />
explosionsgefährdeten Bereichen<br />
einsetzen.<br />
Verlängerte Intervalle beim<br />
Service sparen Kosten<br />
Die modifizierte Membranform mit<br />
seiner speziellen Membranabstützung<br />
ist Basis für eine erhöhte<br />
A usfall<strong>sich</strong>erheit. Die Membran<br />
schmiegt <strong>sich</strong> auch bei schnellen<br />
Schaltvorgängen immer vollständig<br />
an die Abstützung an und wird<br />
somit weniger gestresst. Dadurch<br />
erhöht <strong>sich</strong> die Lebensdauer der<br />
Membran. Das bedeutet verlängerte<br />
Serviceintervalle und geringere<br />
Wartungs- und Betriebskosten.<br />
Daten und Fakten<br />
2/2-Wege Magnetventile<br />
6213EV und 6281EV<br />
""<br />
Besonders kompaktes Design<br />
""<br />
Modulare Bauweise<br />
""<br />
Für Flüssigkeiten und<br />
gasförmige Medien<br />
""<br />
Ohne Druckdifferenz schaltend<br />
""<br />
Gekoppeltes Membransystem<br />
""<br />
Hoher Durchfluss (K v -Wert)<br />
Kontakt:<br />
Bürkert Fluid Control Systems,<br />
Bürkert Werke GmbH,<br />
Christian-Bürkert-Straße 13-17,<br />
D-74653 Ingelfingen,<br />
Tel. (07940) 10-91 111,<br />
Fax (07940) 10-91 448,<br />
E-Mail: info@buerkert.de,<br />
www.buerkert.de<br />
November 2011<br />
1108 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Impressum<br />
Information<br />
Das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong> | <strong>Abwasser</strong><br />
Die technisch-wissenschaftliche Zeitschrift für<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung und <strong>Wasser</strong>versorgung, Gewässerschutz,<br />
<strong>Wasser</strong>reinigung und <strong>Abwasser</strong>technik.<br />
Organschaften:<br />
Zeitschrift des DVGW Deutscher Verein des Gas- und <strong>Wasser</strong>faches e. V.,<br />
Technisch-wissenschaftlicher Verein,<br />
des Bundesverbandes der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft e. V. (BDEW),<br />
der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach e. V.<br />
(figawa),<br />
der DWA Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und<br />
Abfall e. V.<br />
der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und <strong>Wasser</strong>fach<br />
(ÖVGW),<br />
des Fachverbandes der Gas- und Wärme versorgungsunternehmen,<br />
Österreich,<br />
der Arbeitsgemeinschaft <strong>Wasser</strong>werke Bodensee-Rhein (AWBR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Rhein-<strong>Wasser</strong>werke e. V. (ARW),<br />
der Arbeitsgemeinschaft der <strong>Wasser</strong>werke an der Ruhr (AWWR),<br />
der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)<br />
Herausgeber:<br />
Dr.-Ing. Rolf Albus, Gaswärme Institut e.V., Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Harro Bode, Ruhrverband, Essen<br />
Dipl.-Ing. Heiko Fastje, EWE Netz GmbH, Oldenburg<br />
Prof. Dr. Fritz Frimmel, Engler-Bunte-Institut, Universität (TH) Karlsruhe<br />
Prof. Dr. -Ing. Frieder Haakh, Zweckverband Landeswasserversorgung,<br />
Stuttgart (federführend <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>)<br />
Prof. Dr. Winfried Hoch, EnBW Regional AG, Stuttgart<br />
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Klaus Homann (federführend Gas|Erdgas),<br />
Thyssengas GmbH, Dortmund<br />
Dipl.-Ing. Jost Körte, RMG Messtechnik GmbH, Butzbach<br />
Prof. Dr. Matthias Krause, Stadtwerke Halle, Halle<br />
Dipl.-Ing. Klaus Küsel, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau<br />
GmbH, Erkrath<br />
Prof. Dr.-Ing. Hans Mehlhorn, Zweckverband Bodensee-<strong>Wasser</strong>versorgung,<br />
Stuttgart<br />
Prof. Dr.-Ing. Rainer Reimert, EBI, Karlsruhe<br />
Dr. Karl Roth, Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Hans Sailer, Wiener <strong>Wasser</strong>werke, Wien<br />
Dipl.-Ing. Otto Schaaf, Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR<br />
BauAss. Prof. Dr.-Ing. Lothar Scheuer, Aggerverband, Gummersbach<br />
Dr.-Ing. Walter Thielen, DVGW e. V., Bonn<br />
Dr. Anke Tuschek, BDEW e. V., Berlin<br />
Martin Weyand, BDEW e. V., Berlin<br />
Redaktion:<br />
Hauptschriftleitung (verantwortlich):<br />
Dipl.-Ing. Christine Ziegler, Oldenbourg Industrieverlag GmbH,<br />
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München,<br />
Tel. (0 89) 4 50 51-3 18, Fax (0 89) 4 50 51-3 23,<br />
e-mail: ziegler@oiv.de<br />
Redaktionsbüro im Verlag:<br />
Sieglinde Balzereit, Tel. (0 89) 4 50 51-2 22,<br />
Fax (0 89) 4 50 51-3 23, e-mail: balzereit@oiv.de<br />
Redaktionsbeirat:<br />
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Jan-Ulrich Arnold, Technische Unternehmens -<br />
beratungs GmbH, Bergisch Gladbach<br />
Prof Dr. med. Konrad Botzenhart, Hygiene Institut der Uni Tübingen,<br />
Tübingen<br />
Prof. Dr.-Ing. Frank Wolfgang Günthert, Universität der Bundeswehr<br />
München, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und<br />
Abfall technik, Neubiberg<br />
Dr. rer. nat. Klaus Hagen, Krüger WABAG GmbH, Bayreuth<br />
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann, Andechs<br />
Dipl.-Volksw. Andreas Hein, IWW GmbH, Mülheim/Ruhr<br />
Dr. Bernd Heinzmann, Berliner <strong>Wasser</strong>betriebe, Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Ruhrverband, Essen<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel, TU Berlin, Berlin<br />
Dr. Josef Klinger, DVGW-Technologiezentrum <strong>Wasser</strong> (TZW), Karlsruhe<br />
Dipl.-Ing. Reinhold Krumnack, DVGW, Bonn<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Merkel, Wiesbaden<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Meyer, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen<br />
Dipl.-Ing. Karl Morschhäuser, FIGAWA, Köln<br />
Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Bieske und Partner GmbH, Lohmar<br />
Dr. Matthias Schmitt, RheinEnergie AG, Köln<br />
Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Institut für <strong>Wasser</strong>wirtschaft,<br />
Universität Hannover<br />
RA Jörg Schwede, Kanzlei Doering, Hannover<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Uhl, Techn. Universität Dresden, Dresden<br />
Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann, DVGW-Forschungsstelle TUHH,<br />
Hamburg<br />
Verlag:<br />
Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Straße 145,<br />
D-81671 München, Tel. (089) 450 51-0, Fax (089) 450 51-207,<br />
Internet: http://www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Carsten Augsburger, Jürgen Franke, Hans-Joachim Jauch<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil:<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Essen,<br />
Tel. (0201) 82002-35 e-mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Mediaberatung:<br />
Inge Matos Feliz, im Verlag,<br />
Tel. (089) 45051-228, Fax (089) 45051-207,<br />
e-mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Anzeigenverwaltung:<br />
Brigitte Krawzcyk, im Verlag,<br />
Tel. (089) 450 51-226, Fax (089) 450 51-300,<br />
e-mail: krawczyk@oiv.de<br />
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 61.<br />
Bezugsbedingungen:<br />
„<strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong>“ erscheint monatlich<br />
(Doppelausgabe Juli/August). Mit regelmäßiger Verlegerbeilage<br />
„R+S – Recht und Steuern im Gas- und <strong>Wasser</strong>fach“ (jeden 2. Monat).<br />
Jahres-Inhaltsverzeichnis im Dezemberheft.<br />
Jahresabonnementpreis:<br />
Inland: € 360,– (€ 330,– + € 30,– Versandspesen)<br />
Ausland: € 365,– (€ 330,– + € 35,– Versandspesen)<br />
Einzelheft: € 37,– + Versandspesen<br />
ePaper als PDF € 330,–, Einzelausgabe: € 37,–<br />
Heft und ePaper € 429,–<br />
(Versand Deutschland: € 30,–, Versand Ausland: € 35,–)<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Studentenpreis: 50 % Ermäßigung gegen Nachweis.<br />
Bestellungen über jede Buchhandlung oder direkt an den Verlag.<br />
Abonnements-Kündigung 8 Wochen zum Ende des Kalenderjahres.<br />
Abonnement/Einzelheftbestellungen:<br />
Leserservice <strong>gwf</strong> – <strong>Wasser</strong>|<strong>Abwasser</strong><br />
Postfach 91 61<br />
D-97091 Würzburg<br />
Tel. +49 (0) 931 / 4170-1615, Fax +49 (0) 931 / 4170-492<br />
e-mail: leserservice@oldenbourg.de<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen<br />
Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages<br />
strafbar. Mit Namen gezeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt<br />
der Meinung der Redaktion.<br />
Druck: Druckerei Chmielorz GmbH<br />
Ostring 13, 65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
© 1858 Oldenbourg Industrieverlag GmbH, München<br />
Printed in Germany<br />
November 2011<br />
<strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong> 1109
INFormation Termine<br />
""<br />
Schlammfaulung statt aerober Stabilisierung – Trend der Zukunft?<br />
22.11.2011, Kaiserslautern<br />
TU Kaiserslautern, Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft & Universität Luxemburg, Paul-Ehrlich-Straße,<br />
67663 Kaiserslautern, Dipl.-Ing. Oliver Gretzschel, Tel. (0631) 205-3831, E-Mail: oliver.gretzschel@bauing.uni-kl.de,<br />
www.siwawi.arubi.uni-kl.de<br />
""<br />
<strong>Wasser</strong>entgelte – So kalkulieren Sie richtig<br />
22.11.2011, Düsseldorf<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
Preiskalkulationstool <strong>Wasser</strong> (PkW)<br />
23.11.2011, Düsseldorf<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
Praxisfragen zur Umsetzung des neuen EnWG<br />
23.–24.11.2011, Leipzig<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
AGE-Seminar – Technik der Trinkwasserversorgung für Kaufleute<br />
28.–29.11.2011, Köln<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
""<br />
Streitpunkt <strong>Wasser</strong>zähler<br />
08.12.2011, Erfurt<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
2012<br />
""<br />
42. Internationales <strong>Wasser</strong>bau-Symposium und <strong>Wasser</strong>wirtschaft (IWW) der RWTH Aachen –<br />
Hochwasser, eine Daueraufgabe<br />
12.–13.01.2012, Aachen<br />
Institut für <strong>Wasser</strong>bau und <strong>Wasser</strong>wirtschaft, Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 52056 Aachen,<br />
Dipl.-Hydrol. Sabine Jenning, Tel. (0241) 80 25923, E-Mail: jenning@iww.rwth-aachen.de,<br />
www.iww.rwth-aachen.de<br />
""<br />
Gebäude- und Grundstücksentwässerung – Ge<strong>sich</strong>erte Qualität durch RAL-Gütezeichen<br />
16.–17.01.2012, Fulda<br />
Deutsche Vereinigung für <strong>Wasser</strong>wirtschaft, <strong>Abwasser</strong> und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef,<br />
Sarah Heimann, Tel. (02242) 872-192, E-Mail: heimann@dwa.de<br />
""<br />
E-world energy & water<br />
07.–09.02.2012, Essen<br />
www.e-world-2012.com<br />
""<br />
Weibliche Führungskräfte in der Energie- und <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
07.–08.02.2012, Leipzig<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Josef-Wirmer-Straße 1, 53123 Bonn, Tel. (0228) 2598-100, Fax (0228) 2598-120,<br />
E-Mail: info@ew-online.de, www.ew-online.de<br />
" " 26. Oldenburger Rohrleitungsforum – Rohrleitungen – in neuen Energieversorgungskonzepten<br />
09.–10.02.2012, Oldenburg<br />
Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg e.V., Ofener Straße 18, 26121 Oldenburg, Tel. (0441) 36 10 39-0,<br />
Fax (0441) 36 10 39-10, E-Mail: info@iro-online.de, www.iro-online.de<br />
November 2011<br />
1110 <strong>gwf</strong>-<strong>Wasser</strong> <strong>Abwasser</strong>
Einkaufsberater<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser.de/einkaufsberater<br />
Ansprechpartnerin für den<br />
Eintrag Ihres Unternehmens<br />
Inge Matos Feliz<br />
Telefon: 0 89/4 50 51-228<br />
Telefax: 0 89/4 50 51-207<br />
E-Mail: matos.feliz@oiv.de<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.<strong>gwf</strong>-wasser-abwasser.de<br />
Die technisch-wissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift für <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
und <strong>Abwasser</strong>behandlung
Armaturen<br />
Brunnenservice<br />
Absperrarmaturen<br />
Automatisierung<br />
Prozessleitsysteme<br />
Armaturen<br />
Chemikalien<br />
Be- und Entlüftungsrohre
Energie aus <strong>Abwasser</strong><br />
Kompressoren<br />
Drehkolbengebläse<br />
Drehkolbenverdichter<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Fernwirktechnik<br />
Schraubenverdichter
Korrosionsschutz<br />
Aktiver Korrosionsschutz<br />
Regenwasser-Behandlung,<br />
-Versickerung, -Rückhaltung<br />
Kunststoffschweißtechnik<br />
Rohrhalterungen und<br />
Stützen<br />
Rohrhalterungen<br />
Passiver Korrosionsschutz<br />
Schachtabdeckungen<br />
Rohrleitungen<br />
Kunststoffrohrsysteme<br />
Leckortung<br />
Smart Metering
Umform- und<br />
Befestigungstechnik<br />
Filtermaterialien<br />
von Anthrazit bis Zeolith<br />
Rohrleitungs- und Kanalbau<br />
<strong>Wasser</strong>aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitung<br />
Sonderbauwerke<br />
Biologische <strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung und<br />
<strong>Abwasser</strong>ableitung<br />
Rohrdurchführungen<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Chemische <strong>Wasser</strong>- und <strong>Abwasser</strong>aufbereitungsanlagen
Beratende Ingenieure (für das <strong>Wasser</strong>-/<strong>Abwasser</strong>fach)<br />
Ing. Büro CJD Ihr Partner für <strong>Wasser</strong>wirtschaft und<br />
Denecken Heide 9 Prozesstechnik<br />
30900 Wedemark Beratung / Planung / Bauüberwachung /<br />
www.ibcjd.de Projektleitung<br />
+49 5130 6078 0 Prozessleitsysteme<br />
<strong>Abwasser</strong>reinigung<br />
Grundwasserbehandlung<br />
Kanalsanierung<br />
Regenwasserbewirtschaftung<br />
Schmutz-/Regenwasserableitung<br />
<strong>Wasser</strong>gefährdende Stoffe<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung<br />
<strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
Wirtschaftlichkeitsberechnungen<br />
Regenerative Energien<br />
Darmstadt l Freiburg l Homberg l Mainz<br />
Offenburg l Waldesch b. Koblenz<br />
Rockenhausen<br />
Erfurt<br />
igr AG<br />
Luitpoldstraße 60 a<br />
67806 Rockenhausen<br />
Tel.: +49 (0)6361 919-0<br />
Fax: +49 (0)6361 919-100<br />
Baden-Airpark<br />
Leipzig<br />
Berlin<br />
Lichtenstein<br />
Bitburg<br />
Zagreb<br />
E-Mail: info@igr.de<br />
Internet: www.igr.de<br />
Herzogenaurach<br />
Niederstetten<br />
• Beratung<br />
• Planung<br />
• Bauüberwachung<br />
• Betreuung<br />
• Projektmanagement<br />
Beratende Ingenieure für:<br />
<strong>Wasser</strong>gewinnung<br />
Aufbereitung<br />
<strong>Wasser</strong>verteilung<br />
Telefon 0511/284690<br />
Telefax 0511/813786<br />
30159 Hannover<br />
Kurt-Schumacher-Str. 32<br />
• Beratung<br />
• Gutachten<br />
• Planung<br />
• Bauleitung<br />
info@scheffel-planung.de<br />
www.scheffel-planung.de<br />
<strong>Wasser</strong> Abfall Energie Infrastruktur<br />
UNGER ingenieure l Julius-Reiber-Str. 19 l 64293 Darmstadt<br />
www.unger-ingenieure.de<br />
DVGW-zertifizierte Unternehmen<br />
Zertifizierung_<strong>gwf</strong>_20101110_.qxd 10.11.2010 08:33 Seite 1<br />
Die STREICHER Gruppe steht für Innovation und Qualität. Mit knapp 3.000 Mitarbeitern werden<br />
anspruchsvolle Projekte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene durchgeführt.<br />
Die Zertifizierungen der STREICHER Gruppe umfassen:<br />
DIN EN ISO 9001 GW 11 G 468-1 WHG § 19 I<br />
DIN EN ISO 14001 GW 301: G1: st, ge, pe G 493-1 AD 2000 HPO<br />
SCC** W1: st, ge, gfk, pe, az, ku G 493-2 DIN EN ISO 3834-2<br />
OHSAS 18001 GN2: B W 120 DIN 18800-7 Klasse E<br />
FW 601: FW 1: st, ku<br />
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA, Rohrleitungs- und Anlagenbau<br />
Schwaigerbreite 17 Tel.: +49(0)991 330-231 rlb@streicher.de<br />
94469 Deggendorf Fax: +49(0)991 330-266 www.streicher.de<br />
Das derzeit gültige Verzeichnis der Rohrleitungs-Bauunternehmen<br />
mit DVGW-Zertifikat kann im Internet unter<br />
www.dvgw.de in der Rubrik „Zertifizierung/Verzeichnisse“<br />
heruntergeladen werden.
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
Seite<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 1025<br />
Aquadosil <strong>Wasser</strong>aufbereitung GmbH, Essen 1034<br />
ecwatech 2012, Moskau, Rußland 1031<br />
Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG, Weil am Rhein<br />
Einhefter<br />
EW Medien und Kongresse GmbH, Bonn 1051<br />
E-WORLD 2012, Essen 1023<br />
Ing. Büro Fischer-Uhrig, Berlin 1051<br />
FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH, Berlin 1005<br />
GfG-Gesellschaft für Gerätebau mbH, Dortmund 1021<br />
Grundfos GmbH, Erkrath 1007<br />
Horlemann Gesellschaft für Elektroanlagen mbH,Uedem 1015<br />
Hans Huber AG, Berching 1009<br />
Hydrometer GmbH, Ansbach 1003<br />
IFA Ingenieuergesellschaft für Automation mbH,Heddesheim 1027<br />
KELLER AG für Druckmesstechnik, Winterthur, Schweiz<br />
2. Umschlagseite<br />
Krohne Messtechnik GmbH, Duisburg 993<br />
KRYSCHI <strong>Wasser</strong>hygiene, Kaarst 998<br />
Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen 1011<br />
Thüga Aktiengesellschaft, München<br />
4. Umschlagseite<br />
VEGA Grieshaber KG, Schiltach<br />
Titelseite<br />
Fritz Wiedemann & Sohn GmbH, Wiesbaden 1029<br />
Einkaufsberater / Fachmarkt 1111–1116<br />
<strong>gwf</strong><strong>Wasser</strong><br />
<strong>Abwasser</strong><br />
3-Monats-<strong>Vorschau</strong> 2011/2012<br />
Ausgabe Dezember 2011 Januar 2012 Februar 2012<br />
Erscheinungstermin:<br />
Anzeigenschluss:<br />
15.12.2011<br />
24.11.2011<br />
23.01.2011<br />
16.12.2011<br />
17.02.2012<br />
23.01.2012<br />
Themenschwerpunkt<br />
<strong>Abwasser</strong>behandlung<br />
Produkte und Verfahren<br />
• Hochbelastete Abwässer<br />
• Mechanische Reinigung<br />
• Biologische Stufe, Belebtschlammverfahren,<br />
Nitrifikation, Denitrifikation<br />
• Chemische Verfahren<br />
• Membrantechnik<br />
• Klärschlammbehandlung<br />
Vorbericht zum IRO „26. Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum: Rohrleitungen in<br />
neuen Energieversorgungskonzepten“<br />
• Energie aus <strong>Abwasser</strong><br />
• Trinkwasserspeichersysteme<br />
• Bau und Sanierung unterirdischer<br />
Infrastruktur<br />
• Strategien gegen Infiltration von<br />
Fremdwasser<br />
• Korrosionsschutz<br />
• Digitale Videoinspektion, Kanal-TV<br />
• Geoinformationssystems (GIS) in der<br />
Siedlungswasserwirtschaft<br />
Energie aus <strong>Wasser</strong> und <strong>Abwasser</strong><br />
Nachhaltig Wärme und Strom<br />
erzeugen, energieeffizient einsetzen<br />
• Wärme aus dem Kanal<br />
• Abwärmekataster<br />
• Co-Vergärung und Biogaserzeugung<br />
• Klärschlammbehandlung<br />
• Stromproduzent Kläranlage<br />
• Klärgas für Brennstoffzellen<br />
• Rohstoffe aus <strong>Abwasser</strong><br />
• Geothermie<br />
• Stromerzeugung im <strong>Wasser</strong>werk<br />
Fachmessen/<br />
Fachtagungen/<br />
Veranstaltung<br />
(mit erhöhter Auflage<br />
und zusätzlicher<br />
Verbreitung)<br />
POLLUTEC Intern. Fachmesse für <strong>Wasser</strong>,<br />
Lyon (Frankreich) – 30.11.–03.12.2010<br />
19. Tagung Rohrleitungsbau –<br />
Berlin, 24.01.–25.01.2012<br />
Symposium <strong>Wasser</strong>versorgung 2012 –<br />
Wien (A), 25.01.–26.01.2012<br />
E-world energy & water –<br />
Intern. Fachmesse und Kongress –<br />
Essen, 07.02.–09.02.2012<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum –<br />
Oldenburg, 09.02.–10.02.2012<br />
12. Göttinger <strong>Abwasser</strong>tage –<br />
Göttingen, 28.02.–29.02.2012<br />
GeoTHERM – expo & congress –<br />
Offenburg, 01.03.–02.03.2012<br />
AQUA Ukraine – Intern. <strong>Wasser</strong> Forum –<br />
Donezk (UA), März 2012<br />
SHK – Essen, 07.03.–10.03.2012<br />
45. Essener Tagung für <strong>Wasser</strong>- und<br />
<strong>Abwasser</strong>wirtschaft – Aachen, 14.03.–<br />
16.03.2012<br />
Änderungen vorbehalten
HEUTE MORGEN<br />
Erfurt: Die Stadtwerke Erfurt Gruppe, Teil der Thüga-Gruppe,<br />
versorgt die 201.000 Einwohner der Stadt mit Erdgas, Strom, <strong>Wasser</strong> und Wärme.<br />
Flexibel sein oder flexibel bleiben<br />
ist für manche Energieversorger die große Frage.<br />
Für andere das große Plus.<br />
Ein kommunaler Lebensraum trägt nicht nur Sorge für ein erfolgreiches<br />
Miteinander im Heute: Sich zukunftsfähig aufzustellen<br />
ist eine von vielen Fragen, die z. B. in Erfurt neu beantwortet<br />
wurden: Durch die Zusammenarbeit im starken Stadtwerke-Netz<br />
der Thüga-Gruppe schöpfen kommunale Unternehmen wie die<br />
Stadtwerke Erfurt Gruppe Kraft, um die Energie- und <strong>Wasser</strong>versorgung<br />
nachhaltig zu <strong>sich</strong>ern. Selbstständig, marktgerecht und<br />
zukunftsorientiert – das große Plus für bereits 450 Städte mit über<br />
8 Mio. Menschen. Mehr über Ihre Möglichkeiten unter thuega.de