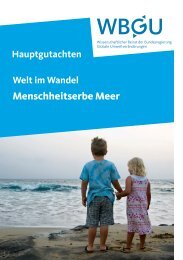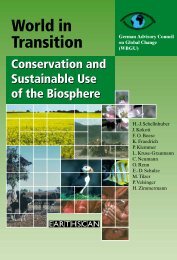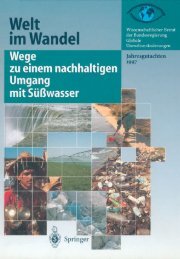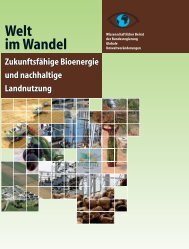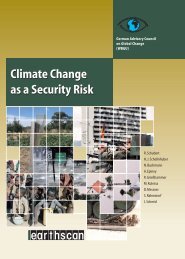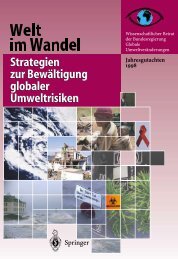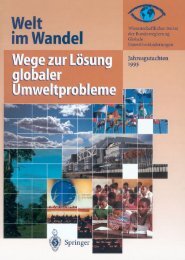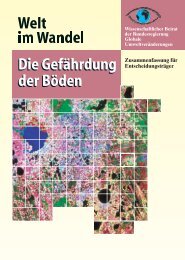Handlungs- und Forschungsempfehlungen - WBGU
Handlungs- und Forschungsempfehlungen - WBGU
Handlungs- und Forschungsempfehlungen - WBGU
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7 <strong>Handlungs</strong>empfehlungen<br />
36<br />
der zurückgesetzt werden. Um die Verluste an mariner<br />
Biodiversität durch Beifang zu verringern, sollten<br />
ökosystemgerechte, d. h. umweltschonende Fanggeräte<br />
<strong>und</strong> -praktiken verpflichtend eingeführt werden.<br />
Fischereimethoden, bei denen hohe Anteile von Beifang<br />
von Nichtzielarten (Fische, aber auch u. a. Seevögel,<br />
Meeresschildkröten, Meeressäuger) technisch nicht<br />
vermeidbar sind, sollten verboten <strong>und</strong> durch andere<br />
Methoden ersetzt werden. Durch das Anlandungsgebot<br />
werden zudem die Unsicherheiten bei den Bestandsabschätzungen<br />
verringert. Der durch technische Maßnahmen<br />
nicht zu vermeidende Beifang sollte nicht nur<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich angelandet, sondern auch verwertet werden,<br />
wenn möglich für den direkten menschlichen Verzehr.<br />
Wo dies nicht möglich ist, kann die Verarbeitung<br />
des Beifangs zu Fischmehl oder -öl eine Futterquelle für<br />
nachhaltige Aquakultur sein <strong>und</strong> so die Futterfischerei<br />
vermindern (Kap. 7.4.2.2). Die Rahmenbedingungen<br />
sollten so gestaltet sein, dass der Anreiz besteht, Beifang<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich zu minimieren, so dass auch der Beifang<br />
von Nichtzielarten innerhalb nachhaltiger Grenzen<br />
bleibt. Die Herausforderung besteht darin, trotz möglichst<br />
sinnvoller Nutzung keine Anreize zu einer Steigerung<br />
des Beifangs zu schaffen. Zu diesen wichtigen Fragen<br />
besteht Forschungsbedarf (Kap. 8.3.3.1).<br />
Zerstörerische <strong>und</strong> verschwenderische Fischerei<br />
verbieten <strong>und</strong> Verbote durchsetzen<br />
Zerstörerische Fischereitechniken sollten sowohl im<br />
Küstenmeer, in der AWZ als auch auf Hoher See verboten<br />
<strong>und</strong> diese Verbote auch effektiv durchgesetzt<br />
werden. Dazu gehört nicht nur das Fischen mit Dynamit<br />
oder Gift, das vor allem im Küstenbereich der Tropen<br />
immer noch vorkommt, sondern auch die habitatschädigende<br />
Fischerei (z. B. Gr<strong>und</strong>schleppnetzfischerei,<br />
Baumkurren) in sensiblen Ökosystemen, wie z. B.<br />
Riffen, Seegraswiesen, Sandbänken <strong>und</strong> in Meeressschutzgebieten.<br />
Dies gilt insbesondere für Tiefseegebiete<br />
mit fragilen Habitaten <strong>und</strong> reicher Biodiversität<br />
(z. B. Kaltwasserkorallenriffe, Unterwasserberge). Die<br />
FAO-Leitlinien für die Tiefseefischerei im Bereich der<br />
Hohen See sollten daher vordringlich umgesetzt werden<br />
(FAO, 2009b). Nachhaltige Alternativen zur gr<strong>und</strong>berührenden<br />
Fischerei sollten erforscht <strong>und</strong> angewandt<br />
werden (z. B. Elektro- oder Puls fischerei; Kap. 8.3.3.1).<br />
Verschwenderische Fischereimethoden, bei denen<br />
nur ein kleiner Bruchteil der gefangenen Biomasse Verwendung<br />
findet, sollten verboten werden. Ein Beispiel<br />
ist das shark finning, bei dem nur die Flossen von Haien<br />
für die Zubereitung einer Suppe verwendet werden <strong>und</strong><br />
der tödlich verletzte Hai ungenutzt wieder über Bord<br />
geht. Hier ist die Ausweitung der bestehenden Regelungen<br />
vieler Länder (u. a. EU, USA) <strong>und</strong> Institutionen<br />
(RFMO, FAO, CITES) in Richtung eines globalen<br />
Verbots erforderlich, weil Haie eine wichtige Rolle in<br />
Meeresökosystemen einnehmen <strong>und</strong> viele Haiarten<br />
durch Fischerei akut gefährdet sind (Kap. 4.2.2.3). Das<br />
Memorandum of Understanding on Migratory Sharks<br />
der Bonner Konvention (CMS, 2010) hat für die Untergruppe<br />
der wandernden Haiarten einen Schutzplan<br />
vereinbart. Allerdings haben die Länder, in denen Haifischerei<br />
eine große Rolle spielt, sowie die wichtigen<br />
asiatischen Importländer das Memorandum bislang<br />
nicht gezeichnet.<br />
Futterfischerei reglementieren<br />
Etwa ein Drittel der marinen Fangmenge wird zur<br />
Erzeugung von Fischmehl <strong>und</strong> -öl vor allem für Tierfutter<br />
genutzt. Ein großer Teil davon wird zu Futter für<br />
Aquakultur von Raubfischen mit einem Effizienzverlust<br />
von bis zu 1:5 (vereinzelt sogar mehr) verarbeitet<br />
(„Reduktion“; Kap. 4.4). Der Fang von Wildfischen für<br />
die Aquakultur von Raubfischen („Reduktionsfischerei“)<br />
stellt keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung<br />
dar <strong>und</strong> sollte verringert werden. Stattdessen<br />
sollten Alternativen entwickelt <strong>und</strong> gefördert werden<br />
(Kap. 7.4.2.2). Es sollten konservative ökosystembasierte<br />
Fangbeschränkungen für Reduktions-, Futterbzw.<br />
Industriefischereien auf niedriger trophischer<br />
Ebene vereinbart, umgesetzt <strong>und</strong> durchgesetzt werden,<br />
um die Nahrungsversorgung für natürliche Prädatoren<br />
im Nahrungsnetz zu sichern <strong>und</strong> gegen Unsicherheiten<br />
etwa auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel<br />
vorzusorgen (Kap. 4.4). Es sollten Initiativen<br />
hinzukommen, Futterfischereien möglichst vollständig<br />
in Bezug auf Nachhaltigkeit <strong>und</strong> Herkunft zu zertifizieren.<br />
Je nach lokalem Kontext kann es auch sinnvoll<br />
sein, lokale Fischmehlindustrien für lokale Aquakulturfarmen<br />
aufzubauen. Alternativ zur Verarbeitung dieser<br />
Erträge zu Tierfutter sollten Forschung, Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Infrastruktur gefördert werden, um neue Wege<br />
zur direkten Nutzung der Futterfischbestände für den<br />
menschlichen Verzehr zu finden, wie es z. T. bereits<br />
geschieht (Kap. 4.4.2; 8.3.3.1).<br />
7.4.1.5<br />
Illegale, nicht gemeldete <strong>und</strong> unregulierte<br />
Fischerei bekämpfen<br />
Etwa ein Siebtel bis ein Drittel des globalen Fischfangs<br />
geht auf das Konto des illegalen, nicht gemeldeten <strong>und</strong><br />
unregulierten Fischfangs (illegal, unreported and unregulated<br />
fisheries, IUU-Fischerei; Kap. 4.2.2.3). Das<br />
politische Ziel der Beendigung der IUU-Fischerei, insbesondere<br />
auf Hoher See, ist seit Jahren Konsens der<br />
Staatengemeinschaft <strong>und</strong> wurde auf der Rio+20-Konferenz<br />
erneut bekräftigt.<br />
Die Empfehlungen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei<br />
sollten an den wichtigsten Ursachen ansetzen: die