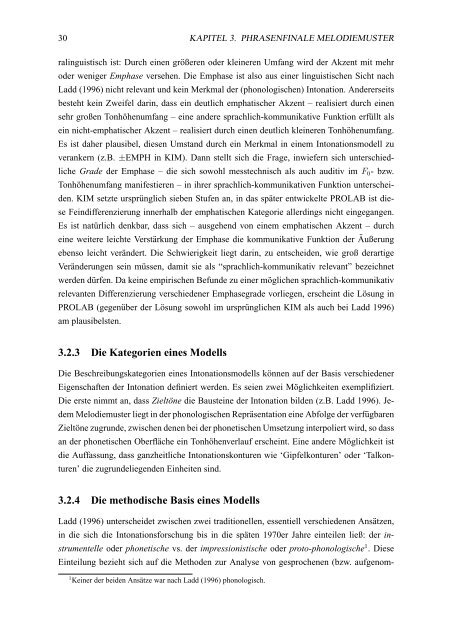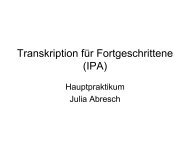Experimentelle Untersuchungen zu phonetischen und semantischen
Experimentelle Untersuchungen zu phonetischen und semantischen
Experimentelle Untersuchungen zu phonetischen und semantischen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
30 KAPITEL 3. PHRASENFINALE MELODIEMUSTER<br />
ralinguistisch ist: Durch einen größeren oder kleineren Umfang wird der Akzent mit mehr<br />
oder weniger Emphase versehen. Die Emphase ist also aus einer linguistischen Sicht nach<br />
Ladd (1996) nicht relevant <strong>und</strong> kein Merkmal der (phonologischen) Intonation. Andererseits<br />
besteht kein Zweifel darin, dass ein deutlich emphatischer Akzent – realisiert durch einen<br />
sehr großen Tonhöhenumfang – eine andere sprachlich-kommunikative Funktion erfüllt als<br />
ein nicht-emphatischer Akzent – realisiert durch einen deutlich kleineren Tonhöhenumfang.<br />
Es ist daher plausibel, diesen Umstand durch ein Merkmal in einem Intonationsmodell <strong>zu</strong><br />
verankern (z.B. ±EMPH in KIM). Dann stellt sich die Frage, inwiefern sich unterschiedliche<br />
Grade der Emphase – die sich sowohl messtechnisch als auch auditiv im F 0 - bzw.<br />
Tonhöhenumfang manifestieren – in ihrer sprachlich-kommunikativen Funktion unterscheiden.<br />
KIM setzte ursprünglich sieben Stufen an, in das später entwickelte PROLAB ist diese<br />
Feindifferenzierung innerhalb der emphatischen Kategorie allerdings nicht eingegangen.<br />
Es ist natürlich denkbar, dass sich – ausgehend von einem emphatischen Akzent – durch<br />
eine weitere leichte Verstärkung der Emphase die kommunikative Funktion der Äußerung<br />
ebenso leicht verändert. Die Schwierigkeit liegt darin, <strong>zu</strong> entscheiden, wie groß derartige<br />
Veränderungen sein müssen, damit sie als “sprachlich-kommunikativ relevant” bezeichnet<br />
werden dürfen. Da keine empirischen Bef<strong>und</strong>e <strong>zu</strong> einer möglichen sprachlich-kommunikativ<br />
relevanten Differenzierung verschiedener Emphasegrade vorliegen, erscheint die Lösung in<br />
PROLAB (gegenüber der Lösung sowohl im ursprünglichen KIM als auch bei Ladd 1996)<br />
am plausibelsten.<br />
3.2.3 Die Kategorien eines Modells<br />
Die Beschreibungskategorien eines Intonationsmodells können auf der Basis verschiedener<br />
Eigenschaften der Intonation definiert werden. Es seien zwei Möglichkeiten exemplifiziert.<br />
Die erste nimmt an, dass Zieltöne die Bausteine der Intonation bilden (z.B. Ladd 1996). Jedem<br />
Melodiemuster liegt in der phonologischen Repräsentation eine Abfolge der verfügbaren<br />
Zieltöne <strong>zu</strong>gr<strong>und</strong>e, zwischen denen bei der <strong>phonetischen</strong> Umset<strong>zu</strong>ng interpoliert wird, so dass<br />
an der <strong>phonetischen</strong> Oberfläche ein Tonhöhenverlauf erscheint. Eine andere Möglichkeit ist<br />
die Auffassung, dass ganzheitliche Intonationskonturen wie ‘Gipfelkonturen’ oder ‘Talkonturen’<br />
die <strong>zu</strong>gr<strong>und</strong>eliegenden Einheiten sind.<br />
3.2.4 Die methodische Basis eines Modells<br />
Ladd (1996) unterscheidet zwischen zwei traditionellen, essentiell verschiedenen Ansätzen,<br />
in die sich die Intonationsforschung bis in die späten 1970er Jahre einteilen ließ: der instrumentelle<br />
oder phonetische vs. der impressionistische oder proto-phonologische 1 . Diese<br />
Einteilung bezieht sich auf die Methoden <strong>zu</strong>r Analyse von gesprochenen (bzw. aufgenom-<br />
1 Keiner der beiden Ansätze war nach Ladd (1996) phonologisch.