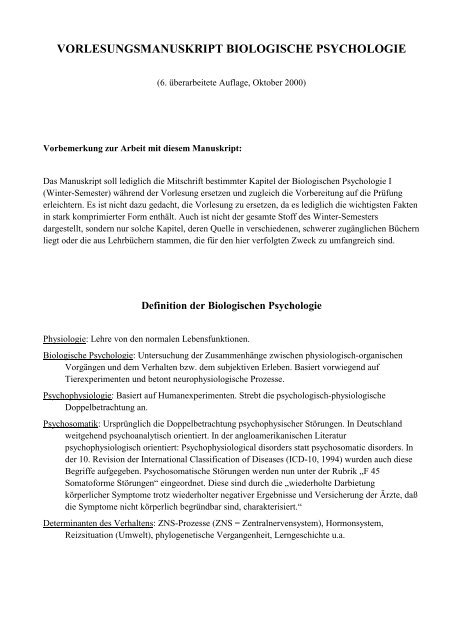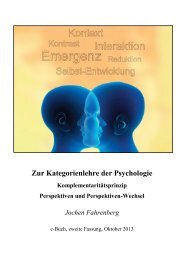VORLESUNGSMANUSKRIPT BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE
VORLESUNGSMANUSKRIPT BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE
VORLESUNGSMANUSKRIPT BIOLOGISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>VORLESUNGSMANUSKRIPT</strong> <strong>BIOLOGISCHE</strong> <strong>PSYCHOLOGIE</strong><br />
(6. überarbeitete Auflage, Oktober 2000)<br />
Vorbemerkung zur Arbeit mit diesem Manuskript:<br />
Das Manuskript soll lediglich die Mitschrift bestimmter Kapitel der Biologischen Psychologie I<br />
(Winter-Semester) während der Vorlesung ersetzen und zugleich die Vorbereitung auf die Prüfung<br />
erleichtern. Es ist nicht dazu gedacht, die Vorlesung zu ersetzen, da es lediglich die wichtigsten Fakten<br />
in stark komprimierter Form enthält. Auch ist nicht der gesamte Stoff des Winter-Semesters<br />
dargestellt, sondern nur solche Kapitel, deren Quelle in verschiedenen, schwerer zugänglichen Büchern<br />
liegt oder die aus Lehrbüchern stammen, die für den hier verfolgten Zweck zu umfangreich sind.<br />
Definition der Biologischen Psychologie<br />
Physiologie: Lehre von den normalen Lebensfunktionen.<br />
Biologische Psychologie: Untersuchung der Zusammenhänge zwischen physiologisch-organischen<br />
Vorgängen und dem Verhalten bzw. dem subjektiven Erleben. Basiert vorwiegend auf<br />
Tierexperimenten und betont neurophysiologische Prozesse.<br />
Psychophysiologie: Basiert auf Humanexperimenten. Strebt die psychologisch-physiologische<br />
Doppelbetrachtung an.<br />
Psychosomatik: Ursprünglich die Doppelbetrachtung psychophysischer Störungen. In Deutschland<br />
weitgehend psychoanalytisch orientiert. In der angloamerikanischen Literatur<br />
psychophysiologisch orientiert: Psychophysiological disorders statt psychosomatic disorders. In<br />
der 10. Revision der International Classification of Diseases (ICD-10, 1994) wurden auch diese<br />
Begriffe aufgegeben. Psychosomatische Störungen werden nun unter der Rubrik „F 45<br />
Somatoforme Störungen“ eingeordnet. Diese sind durch die „wiederholte Darbietung<br />
körperlicher Symptome trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, daß<br />
die Symptome nicht körperlich begründbar sind, charakterisiert.“<br />
Determinanten des Verhaltens: ZNS-Prozesse (ZNS = Zentralnervensystem), Hormonsystem,<br />
Reizsituation (Umwelt), phylogenetische Vergangenheit, Lerngeschichte u.a.
Anatomischer Aufbau des menschlichen Organismus<br />
2<br />
Literatur: Faller, A. & Schünke, M. (1999). Der Körper des Menschen. Stuttgart: Thieme.<br />
Sobotta-Becher: Atlas der Anatomie des Menschen Bd. I und II.<br />
Einteilung der deskriptiven Anatomie: Knochen; Bänder, Muskeln und Schleimbeutel; Gefäße;<br />
Eingeweide; Zentralnervensystem; peripheres Nervensystem; Sinnesorgane und Haut.<br />
Knochen: Ursprünglich Knorpel. Reste des embryonalen Knorpelskeletts beim Erwachsenen: Z.B.<br />
Rippenknorpel, Gelenkknorpel. Setzt sich aus kalkhaltiger Knochensubstanz und Weichteilen<br />
(Gelenkknorpel, Knochenhaut = Periost, Knochenmark, Blutgefäße und Nerven) zusammen.<br />
Knochensubstanz in zwei Modifikationen: Substantia compacta (zylindrischer Mantel um den<br />
Markraum der Röhrenknochen) und Substantia spongiosa (Endstücke der Röhrenknochen, kurze<br />
und platte Knochen; Sitz des roten Knochenmarks).<br />
Knochenmark: Rotes Knochenmark (Blutbildung) und gelbes Knochenmark (reines Fettgewebe), das<br />
sich im Laufe der Entwicklung aus dem roten Mark bildet.<br />
Wirbelsäule: Besteht aus 24 freien Wirbeln (7 Hals-, 12 Brust- und 5 Lendenwirbel), Kreuzbein und<br />
Steißbein. Wirbelkörper durch Bandscheiben miteinander verbunden. Zwischen je 2 Wirbeln<br />
befinden sich die Zwischenwirbellöcher = foramen intervertebrale, die in den Rückenmarkskanal<br />
führen (ermöglichen die Verbindung zwischen ZNS und peripheren Nerven).<br />
Thorax (Brustkorb): Gebildet aus Brustwirbelsäule, 12 Rippenpaaren und Brustbein.<br />
Schädel: Besteht aus Stirnbein, Scheitelbein, Hinterhauptsbein, Schläfenbein, Keilbein, Tränenbein,<br />
Siebbein, Jochbein, Nasenbein, Unter- und Oberkiefer.<br />
Schädel des Neugeborenen: Vordere Fontanelle (zwischen Stirnnaht, Kranznaht und Pfeilnaht) = große<br />
Fontanelle; hintere Fontanelle = kleine Fontanelle; vordere und hintere Seitenfontanellen<br />
(paarig).<br />
Skelett der oberen Extremität: Schultergürtel (Schlüsselbein und Schulterblatt), freie obere Extremität<br />
(Oberarm = Humerus; Unterarm mit Radius = Speiche und Ulna = Elle; Hand mit<br />
Handwurzelknochen, Mittelhandknochen und Fingerknochen).<br />
Skelett der unteren Extremität: Beckengürtel (zwei Hüftbeine bestehend jeweils aus Darmbein,<br />
Schambein und Sitzbein; Kreuzbein); freie untere Extremität (Oberschenkel = Femur;<br />
Kniegelenk mit Menisken; Unterschenkel mit Tibia = Schienbein und Fibula = Wadenbein; Fuß<br />
mit Fußwurzelknochen, Mittelfußknochen und Zehen).<br />
Gelenke: Bestehend aus Kopf, Pfanne und Kapsel, welche die Gelenkhöhle nach außen abschließt.<br />
Schleimbeutel befinden sich an Stellen, wo Sehnen über Knochen gleiten, Sehnenscheiden<br />
dienen zur Führung der Sehnen über Knochen.<br />
Gelenkformen: Kugelgelenk (z.B. Schultergelenk), Eigelenk (z.B. hinteres Handwurzelgelenk),<br />
Scharniergelenk (z.B. Kniegelenk), Zapfengelenk (z.B. zwischen erstem und zweitem<br />
Halswirbel), Sattelgelenk (z.B. Carpometacarpalgelenk des Daumens = Verbindung zwischen<br />
Handwurzel und Mittelhandknochen des Daumens), flaches Gelenk (z.B. Kehlkopf).<br />
Muskel: Bestehend aus proximaler Ursprungssehne(näher zum Rumpf liegend), Muskelbauch und<br />
distaler Ansatzsehne(entfernter zum Rumpf liegend). Gleichsinnig arbeitende Muskeln =
Synergisten, ungleichsinnig arbeitende Muskeln = Antagonisten. Sechs Hauptbewegungen<br />
möglich: Beugung (Flexion), Streckung (Extension), Anziehen (Adduktion), Abspreizen<br />
(Abduktion), Außenrollung (Exorotation) und Innenrollung (Endorotation).<br />
Mundhöhle: Schneidezähne, Mahlzähne und Speicheldrüsen zur Verflüssigung der Nahrung und<br />
Beginn der Kohlenhydratverdauung. Am Übergang zwischen Mundhöhle und Pharynx liegen<br />
vordere und hintere Gaumenbögen mit Gaumenmandeln = Tonsillen.<br />
Pharynx (Schlund): Hier kreuzen sich Atemweg und Speiseweg. Berührung der hinteren Rachenwand<br />
löst Schluckreflex aus. Schluckzentrum in der Medulla oblongata (Teil des Gehirns).<br />
Oesophagus (Speiseröhre): Verbindet den Pharynx mit dem Magen. Liegt zwischen Luftröhre und<br />
Wirbelsäule.<br />
Magen: Links im Oberbauch zwischen Leber und Milz. Rechte Magenkante = kleine Curvatur, linke<br />
Magenkante = große Curvatur. Oberer Teil des Magens liegt als Magengrund (Fundus) in der<br />
linken Zwerchfellkuppel. Magengrund und Magenkörper (Corpus) bilden den verdauenden<br />
Magenabschnitt. Am Magenmund (Cardia) mündet die Speiseröhre in den Magen. Der<br />
Pförtnermuskel (Pylorus) schließt den Magen gegen den Zwölffingerdarm ab.<br />
Zwölffingerdarm (Duodenum): Gestalt eines liegenden nach links offenem U. Umrandet den Kopf der<br />
Bauchspeicheldrüse.<br />
Jenunum (Leerdarm) und Ileum (Krummdarm): Schließen sich an das Duodenum an. Schlingen des<br />
Darmes an Gekröse aufgehängt, das Gefäße, Nerven, Venen und Lymphgefäße führt.<br />
Dickdarm (Colon): Besteht aus Blinddarm mit Wurmfortsatz (Appendix), aufsteigendem Dickdarm,<br />
Quercolon, absteigendem Dickdarm und Sigmaschleife.<br />
Mastdarm (Rectum): Schließt sich an Sigmaschleife an und geht in den Analkanal über, der mit dem<br />
After (Anus) endet.<br />
Brusthöhle: Enthält die Brusteingeweide: Lungen mit zuführenden Luftwegen (Bronchien),<br />
Speiseröhre und Herz mit Venen und Arterien. Der Boden der Brusthöhle wird durch das<br />
Zwerchfell gebildet.<br />
Embryonaler Kreislauf: Nabelvene leitet das im Placentarkreislauf arterialisierte Blut dem Embryo zu.<br />
Diese mündet sowohl direkt in die untere Hohlvene als auch indirekt über das Pfortadersystem.<br />
In der unteren Hohlvene mischt sich das arterielle Blut der Nabelvene mit dem venösen Blut der<br />
Hohlvene. Aus der unteren Hohlvene gelangt das Blut in den rechten Vorhof. Ab hier zwei<br />
Wege: (1) rechter Vorhof ---> linker Vorhof über Foramen ovale ---> linker Ventrikel ---><br />
Aorta ---> Körperkreislauf. (2) rechter Vorhof ---> rechter Ventrikel ---> Lungenarterien ---><br />
Aorta über Ductus arteriosus. Nur 4 % des vom rechten Ventrikel ausgeworfenen Blutes gehen<br />
durch die embryonalen Lungen. Mit dem ersten Atemzug nimmt der Widerstand im<br />
Lungenkreislauf ab. Blut aus dem rechten Ventrikel fließt nun in die Lungenkapillaren. Druck im<br />
linken Vorhof übersteigt Druck im rechten Vorhof, wodurch sich das Foramen ovale schließt.<br />
Umkehr der Strömungsrichtung im Ductus arteriosus mit Verengung und Verschluß desselben.<br />
Kreislauf nach der Geburt: Linker Ventrikel---> Aorta ---> großer Kreislauf ---> Kapillargebiete ---><br />
Venen ---> rechter Vorhof ---> rechter Ventrikel ---> Lungenarterien ---> Kapillaren der Lunge --<br />
-> Lungenvenen ---> linker Vorhof ---> linker Ventrikel, etc.<br />
3
Zellen, Gewebe und Organe<br />
4<br />
Literatur: Faller & Schünke<br />
Grundeigenschaften der Zelle: Stoffwechsel, Wachstum, Empfindlichkeit (Reizaufnahme aus der<br />
Umwelt), Bewegung und Fortpflanzung.<br />
Zytoplasma: Kolloid von gelartiger Beschaffenheit, 3/4 Wasser, 1/4 Eiweiß, Lipoide und<br />
Kohlenhydrate.<br />
Zellorganellen: Endoplasmatisches Reticulum (System von Spalten, in denen rascher Transport<br />
gelöster Stoffe im Inneren des Zytoplasmas gewährleistet ist), Ribosomen (sitzen der<br />
Außenfläche der Lamellen des endoplasmatischen Reticulums auf; Orte der Eiweißbildung),<br />
Golgi-Feld (Lamellensystem; Aufgabe Sekretbildung), Zentrosomen (aus zylindrischen Röhren<br />
aufgebaut; für Zellteilung wichtig), Mitochondrien (längliche, von einer Doppelmembran<br />
umgebene Gebilde; Träger der Atmungsenzyme, Umwandlung von ADP in ATP), Lysosomen<br />
(enthalten Enzyme für den Abbau großer Moleküle).<br />
Zellmembran: Besteht aus innerer und äußerer Eiweißschicht mit dazwischenliegender Lipoidschicht.<br />
Regelt den Stoffaustausch zwischen Zelle und zwischenzelligem Raum. Die Zelloberfläche<br />
verfügt über besondere Rezeptoren, welche die Unterscheidung von körpereigen und<br />
körperfremd gestatten. Mit Hilfe auflösender Enzyme (Lysozyme) und Eiweiß verdauender<br />
Enzyme (Proteasen), die von der Zellmembran abgegeben werden, zerstört die Zelle fremde<br />
Substanzen. Sie kann kleine Partikel umfließen und sie durch Phagozytose in sich aufnehmen.<br />
Die Einverleibung kleiner Tröpfchen wird als Pinozytose bezeichnet.<br />
Zellkern (Nucleus): Mit Doppelmembran umgeben, deren Spalt mit dem endoplasmatischen Reticulum<br />
zusammenhängt. Kernporen gestatten Austausch mit dem Zytoplasma. Im Kern die<br />
Kernkörperchen (Nucleolen). Der Kern besteht aus Nucleinsäuren: RNS in den Nucleolen und<br />
DNS im übrigen Kernraum. DNS läßt sich anfärben, daher auch als Chromatin bezeichnet. Aus<br />
dem Chromatin gehen bei der Zellteilung die Chromosomen hervor.<br />
Elektrolyte: Im Wasser gelöste Salze, Säuren und Basen in Form elektrisch geladener Teilchen (Ionen).<br />
Filtration: Durchpressen kleinster Teilchen, die in einem Lösungsmittel gelöst sind, durch eine<br />
Membran mit entsprechender Porengröße (z.B. Kapillaren, Nieren).<br />
Diffusion: Langsame Durchdringung und Mischung von Flüssigkeiten oder Gasen bis zur völligen<br />
Durchmischung bei direkter Berührung von Gasen bzw. Flüssigkeiten unterschiedlicher<br />
Konzentration (z.B. Durchtreten von Sauerstoff durch die Wände der Lungenbläschen).<br />
Osmose: Diffusion durch eine semipermeable Membran. Dabei zieht die höher konzentrierte Lösung<br />
Wasser an ---> osmotischer Druck. Der osmotische Druck der Gewebeflüssigkeit hängt vom<br />
Eiweiß- und Salzgehalt ab und entspricht etwa einer Lösung von 0,9 % NaCl (= physiologische<br />
Kochsalzlösung).<br />
Gewebe: Verband gleichartig gebauter Zellen und ihrer Abkömmlinge in Hinblick auf eine oder<br />
mehrere gleichartige Funktionen.<br />
Epithelgewebe: Auskleidung einer äußeren oder inneren Oberfläche. Funktionen: Schutzfunktion (z.B.<br />
Epidermis der Haut), Sekretion (Drüsen; endokrine und exokrine; vom Bau her tubulöse,
alveoläre und azinöse Drüsen), Resorption (Epithel der Darmzotten), Reizaufnahme<br />
(Sinnesepithelien, z.B. Netzhaut des Auges).<br />
Unterscheidung der Epithelien nach der Form: Plattenepithel (z.B. Bauchfell), kubisches Epithel (z.B.<br />
Sammelrohre der Nieren), Zylinderepithel (z.B. Darmepithel).<br />
Unterscheidung der Epithelien nach der Anordnung: Einschichtiges Epithel (z.B. Darmepithel),<br />
mehrschichtiges Epithel (z.B. Epidermis = Oberhaut), mehrstufiges Epithel (z.B.<br />
Respirationstrakt; alle Zellen sitzen der Basalmembran auf, erreichen aber nicht alle die<br />
Oberfläche), Übergangsepithel (z.B. ableitende Harnwege; sehr dehnbar).<br />
Bindegewebe: Funktion: Stützfunktion und Stoffwechselfunktion. Bau: Zellen, zwischenzellige<br />
Substanz (Interzellulärsubstanz) und Fasern. Formen: Embryonales Bindegewebe, retikuläres<br />
Bindegewebe, Bindegewebe des Erwachsenen, Fettgewebe, Knorpel, Knochen.<br />
Embryonales Bindegewebe (Mesenchym): Hiervon stammen alle Stützgewebe ab. Mesenchymzellen<br />
bilden einen lockeren Zellschwamm, in den Lücken befindet sich flüssige Zwischensubstanz.<br />
Zellen können sich aus dem Verband lösen ---> Wanderzellen (Makrophagen).<br />
Retikuläres Bindegewebe: Ähnlich dem embryonalen mit Gitterfasern. Kann geformte Stoffe<br />
aufnehmen (Phagozytose) und speichern. Grundlage von Lymphknoten, Milz und Knochenmark.<br />
Retikuloendotheliales System (RES): Alle Zellen des Körpers, die phagozytieren und speichern. Zum<br />
RES gehören die Retikulumzellen des retikulären Bindegewebes und auch die Endothelzellen<br />
(Wandzellen) gewisser Kapillaren z.B. Kupffersche Sternzellen der Leber. Funktion:<br />
Abwehrtätigkeit (Bildung von Antikörpern).<br />
Bindegewebe der Erwachsenen: Anordnung: Locker (z.B. interstitielles Bindegewebe) oder straff (z.B.<br />
Sehnengewebe). Bindegewebszellen teils ortsbeständig (Fibrozyten) teils beweglich<br />
(Histiozyten). Fasern: Kollagene und elastische Fasern. Funktion: Bindefunktion, Wundheilung.<br />
Fettgewebe: Braunes (zahlreiche kleine Fettröpfchen) und gelbes Fettgewebe (ein einziger großer<br />
Tropfen Fett). Funktion: Speicherfett (Brennstoffvorrat), Baufett (z.B. Fettpolster an der Ferse),<br />
Isolationsfett (Subkutanfett der Haut zum Wärmeschutz).<br />
Knorpelgewebe: Knorpelzellen und Knorpelgrundsubstanz mit Bindegewebsfasern. Formen: Hyaliner<br />
Knorpel (z.B. Gelenkflächen), elastischer Knorpel (mit elastischen Fasern, z.B. Ohrknorpel),<br />
Faserknorpel (mit kollagenen Fasern, z.B. Bandscheiben).<br />
Knochen: Knochenbildungszellen (Osteoblasten) scheiden Knochengrundsubstanz ab, Knochenzellen<br />
(Osteozyten) sind vollständig von der Grundsubstanz eingeschlossen und Knochenabbauzellen<br />
(Osteoklasten) bauen den Knochen ab. Knochengrundsubstanz: 1/3 Ossein (organisch), 2/3<br />
Mineralsalze; enthält zahlreich kollagene Bindegewebsfasern.<br />
Röhrenknochen: Schaft (Diaphyse) und Gelenkenden (Epiphysen). Knochenanbauten für Sehnen =<br />
Apophysen. Beim Jugendlichen zwischen Epiphysen und Diaphysen die Epiphysenfugen =<br />
Zonen des Längenwachstums.<br />
Muskelgewebe: Gekennzeichnet durch Kontraktilität, Reizbarkeit und Leitfähigkeit für den gesetzten<br />
Reiz. Formen: Glatte Muskulatur (Hohlorgane, Gefäße; Arbeitsweise langsam, wiederkehrend,<br />
unwillkürlich und autonom), quergestreifte Skelettmuskulatur (Arbeitsweise rasch, an keinen<br />
Rhythmus gebunden, willkürlich beeinflußbar und dem ZNS unterstellt), Herzmuskulatur<br />
(Arbeitsweise rasch, wiederkehrend, unwillkürlich und autonom).<br />
5
Nervengewebe: Funktionen: Erregungsleitung (periphere Nerven mit afferenter und efferenter Leitung)<br />
und Reizverarbeitung (nervöse Zentren, vor allem ZNS). Baueinheit: Neuron mit Zelle,<br />
Dendriten und Neuriten (Axon). Vorkommen: Graue Substanz von Rückenmark und Gehirn.<br />
Formen: Unipolare, bipolare und multipolare Zellen. Im Zellkörper Nissl-Schollen und<br />
Neurofibrillen.<br />
Tumoren: Treten bei jedem 3. Menschen auf, 2/3 der Erkrankten sterben daran. Maligner Tumor =<br />
Ansammlung von Krebszellen. Benigne Tumoren wachsen nur begrenzt. Krebs (Carcinom) kann<br />
in jeder Art von Körpergewebe vorkommen. Kennzeichen: Ungehemmtes Wachstum, dadurch<br />
Verdrängung des gesunden Gewebes und Beanspruchung großer Nährstoffanteile. Mögliche<br />
Ursachen: Mutation (Produktionsfehler bei der täglichen Zellherstellung), Chemikalien (z.B.<br />
Teer im Tabak), elektromagnetische Strahlen (ultraviolette, Röntgenstrahlen, radioaktive<br />
Strahlen), Viren.<br />
Krebsbehandlung: Chirurgisches Entfernen vor Metastasenbildung (wichtig die<br />
Vorsorgeuntersuchungen) und Wachstumshemmung (Röntgenstrahlen, Zytostatika, Hormone).<br />
6<br />
Menschliche Ontogenese<br />
Literatur: Sadler, T.W. (1998). Medizinische Embryologie. Stuttgart: Thieme (begründet von J.<br />
Langman).<br />
Ontogenese: Keimesentwicklung des Einzelwesens.<br />
Phylogenese: Stammesentwicklung der Menschen und Tiere.<br />
Gametogenese: Entwicklung der männlichen (Spermatozyte) und weiblichen Geschlechtszellen<br />
(Oozyte) aus den Keimzellen.<br />
Chromosomen des Menschen: Die normale Körperzelle enthält 46 Chromosomen: 44 Autosomen und<br />
2 Geschlechtschromosomen. Weibliche Geschlechtschromosomen bestehen aus 2 X-<br />
Chromosomen, männliche aus 1 X- und 1 Y-Chromosom. Jedes Autosom besitzt ein<br />
Partnerchromosom mit den gleichen morphologischen Merkmalen, sie bilden jeweils ein Paar<br />
von Homologen. Obwohl X- und Y-Chromosom nicht identisch sind, spricht man beim<br />
Menschen von 23 Chromosomenpaaren = diploider Chromosomensatz.<br />
Mitose: Normale Zellteilung. Phasen: (1) Verdoppelung des DNS-Gehalts in der Zelle, (2) Prophase<br />
(Chromosomen werden im Lichtmikroskop sichtbar), (3) Prometaphase (Chromosomen<br />
kontrahieren sich. Jedes Chromosom besteht infolge der DNS-Verdoppelung aus zwei<br />
Chromatiden, die am Zentromer zusammengehalten werden), (4) Metaphase (Chromosomen<br />
ordnen sich in der Äquatorialplatte an), (5) Anaphase (Teilung des Zentromers und<br />
Auseinanderrücken der Tochterchromosomen), (6) Telophase (Bildung der Tochterzellen,<br />
Durchschnürung des Zytoplasmas).<br />
Meiose = Reifeteilungen: Phasen: (1) Verdoppelung der DNS wie bei der Mitose, (2) Prophase (Im<br />
Unterschied zur Mitose paaren sich in der sog. 1. Reifeteilung die homologen Chromosomen. Da
jedes einzelne Chromosom zwei Chromatiden enthält, bestehen die homologen<br />
Chromosomenpaare aus 4 Chromatiden. Es erfolgt der Austausch von Chromatidabschnitten<br />
zwischen den gepaarten homologen Chromosomen = Crossing over. Dabei findet ein Austausch<br />
von Gengruppen zwischen den homologen Chromosomen statt). Phasen (3) - (6) wie bei Mitose.<br />
Am Ende der 1. Reifeteilung enthält jede Tochterzelle eine Hälfte von jedem Chromosomenpaar,<br />
wobei jedes Chromosom jedoch aus 2 Chromatiden besteht. Der Gesamtgehalt an DNS in jeder<br />
Tochterzelle entspricht also noch dem der übrigen Körperzellen.<br />
Im Anschluß an die 1. Reifeteilung treten die Zellen sofort in die 2. Reifeteilung ein. Der 2.<br />
Reifeteilung geht keine DNS-Synthese voraus. Phasen: Wie bei Mitose ohne (1). Am Ende der 2.<br />
Reifeteilung ist der DNS-Gehalt nur noch halb so groß wie in den normalen Körperzellen<br />
(haploider Chromosomensatz).<br />
Meiose der weiblichen Keimzelle: Es entstehen 4 Tochterzellen mit je 22 Autosomen und 1 X-<br />
Chromosom. Nur eine Tochterzelle entwickelt sich zur Eizelle, die anderen drei (Polkörperchen)<br />
erhalten kaum Zytoplasma und degenerieren.<br />
Meiose der männlichen Keimzelle: Es entstehen 2 Tochterzellen mit 22 Autosomen + 1 X-Chromosom<br />
und 2 Tochterzellen mit 22 Autosomen + 1 Y-Chromosom.<br />
Non-disjunction: Störung bei der 1. Reifeteilung. Trennung eines homologen Chromosomenpaares<br />
bleibt aus, und beide Glieder wandern in eine Zelle. Dadurch erhält eine Zelle 24, die andere 22<br />
Chromosomen statt - wie normal - 23 Chromosomen. Wenn bei der Befruchtung ein Gamet mit<br />
23 Chromosomen mit einem Gameten verschmilzt, der 24 oder 22 Chromosomen besitzt,<br />
entsteht ein Organismus mit 47 Chromosomen (Trisomie) oder mit 45 Chromosomen<br />
(Monosomie).<br />
Entwicklung der Oozyte: (1) Urkeimzelle (beim Embryo in der 4. Woche bereits sichtbar), (2) Oogonie<br />
(entstehen durch Mitose aus den Urkeimzellen), (3) primäre Oozyte (entstehen aus den Oogonien<br />
im 3. Monat. Replikation der DNS und Eintreten in die Prophase der 1. Reifeteilung. Primäre<br />
Oozyte mit umgebenden Epithelzellen = Primärfollikel), (4) Ruhestadium (Diktyotänstadium bis<br />
zu 40 Jahre), (5) Reifung des Primärfollikels mit Einsetzen der Pubertät ---> Entstehung des<br />
Graaf-Follikels (besteht aus: Oozyte mit Zona pellucida und Follikelzellen, Follikelhöhle, Theca<br />
interna und Theca externa), (6) Fortsetzung der 1. Reifeteilung ---> sekundäre Oozyte, (7) zweite<br />
Reifeteilung mit der Ovulation = Follikelsprung.<br />
Entwicklung der Spermatozyte: (1) Urkeimzelle, (2) Spermatogonien (entstehen erst mit der Pubertät<br />
aus den Urkeimzellen), (3) primäre Spermatozyten (entstehen durch Mitose aus den<br />
Spermatogonien. Replikation der DNS und Eintreten in die Prophase der 1. Reifeteilung), (4)<br />
erste Reifeteilung nach 16 Tagen beendet ---> sekundäre Spermatozyten, (5) zweite Reifeteilung<br />
mit Bildung der Spermatiden (bestehen aus 23 Chromosomen), (6) Entwicklung des<br />
Spermatozoons aus der Spermatide (Gesamtentwicklungsdauer von Spermatogonie bis<br />
Spermatozoon 90 Tage).<br />
Mißgebildete Gameten: Primärfollikel besitzt statt einer primären Oozyte zwei oder drei. Entstehen<br />
von Zwillingen oder Drillingen möglich. Beim Mann mißgebildete Spermatozoen häufig.<br />
Beeinträchtigung der Fertilität bei mehr als 25 % mißgebildeten Spermatozoen.<br />
Hormonelle Steuerung des Ovarialzyclus: Zyklische Veränderungen gehen vom Hypothalamus mit<br />
Beginn der Pubertät aus: Releasing-Faktoren des Hypothalamus ---> Sekretion von<br />
Gonadotropinen im Hypophysenvorderlappen (FSH = Follikelstimulierendes Hormon, LH =<br />
7
luteinisierendes Hormon) ---> Wachstum des Primärfollikels unter dem Einfluß von FSH in den<br />
ersten Tagen des Ovarialzyklus ---> Vermehrung der Follikelzellen, die Progesteron produzieren<br />
und Vermehrung der Zellen der Theca interna, die Östrogene produzieren ---> Östrogenanstieg<br />
kurz vor der Ovulation ---> Ausschüttung von LH aus der Hypophyse ---> Ovulation ---><br />
Umwandlung der im Ovar verbleibenden Follikelzellen (Granulosazellen) zum Corpus luteum,<br />
das Progesteron erzeugt ---> Überführung der Uterusschleimhaut in die Sekretionsphase ---> bei<br />
Nichtbefruchtung aufhören der Progesteronbildung im Corpus luteum ---> Periodenblutung. Bei<br />
Befruchtung wird Degeneration des Corpus luteum durch gonadotropes Hormon verhindert, das<br />
im Trophoblast des Embryos gebildet wird ---> Corpus luteum graviditatis ---> am Ende des 4.<br />
Monats Übernahme der Progesteronproduktion durch die Plazenta.<br />
Zeitverhältnisse bei der Ovulation: Ovulation 14 Tage ± 1 Tag vor der nächsten Periodenblutung<br />
(konstante Phase). Variable Phase, je nach Zyklusdauer, zwischen Ovulation und vorhergehender<br />
Menstruation.<br />
Hormonale Kontrazeption: Hemmende Wirkung von mit der Pille zugeführtem Östrogen und<br />
Progesteron auf Hypophyse und Hypothalamus. Dadurch wird die zur Ovulationsauslösung<br />
notwendige LH-Ausschüttung unterdrückt; Ruhigstellung des Ovars. Entzugsblutung bei<br />
Pilleneinnahme nur menstruationsähnlich.<br />
Befruchtung: Verschmelzung des männlichen (Spermatozoon) und weiblichen Gameten (Oozyte) im<br />
Eileiter. Spermien machen vor Befruchtung Kapazitation im weiblichen Genitaltrakt durch<br />
(Entfernung von Hemmfaktoren, die auf der Oberfläche der Spermien sitzen), anschließend<br />
erfolgt Akrosomreaktion (dient zur Auflösung der die Oozyte umgebenden Corona radiata). Bei<br />
Berührung der Membran der Eizelle durch den Kopf des Spermiums entsteht Reaktion der Zona<br />
pellucida, die das Eindringen weiterer Spermien verhindert. Bildung des männlichen und<br />
weiblichen Vorkernes, Reduplikation der DNS in jedem Vorkern, Verschmelzung der Vorkerne,<br />
Bildung der 2-zelligen Zygote.<br />
Furchungsteilungen: Die zweizellige Zygote durchläuft eine Reihe von Mitosen, wodurch die Zellzahl<br />
rasch ansteigt. Diese Zellen nennt man Blastomeren. Es entsteht die Morula mit innerer<br />
Zellschicht (Gewebe für den Embryo) und äußerer Zellschicht (Trophoblastzellen, die später die<br />
Plazenta entwickeln). Nach 60 Stunden ist die Morula im Uterus.<br />
Entwicklung der Blastozyste: Interzellularräume der Morula fließen zusammen und bilden die<br />
Blastozystenhöhle. Die Zygote heißt jetzt Blastozyste mit Embryoblast (innere Zellschicht) und<br />
Trophoblast (äußere Zellschicht). Trophoblastzellen beginnen am 6. Tag in die<br />
Uterusschleimhaut einzudringen.<br />
Veränderungen der Uterusschleimhaut: Uteruswand aus 3 Schichten gebildet: Endometrium (innere<br />
Schleimhautauskleidung), Myometrium (dicke Schicht aus glatter Muskulatur) und Perimetrium<br />
(Peritonealüberzug = Bauchfellüberzug auf der Außenfläche). Bei der Implantation der<br />
Blastozyste befindet sich Schleimhaut in der Sekretionsphase, die durch das Progesteron des<br />
Corpus luteum hervorgerufen wird. Schleimhaut ist aus 3 Schichten aufgebaut: Oberflächliche<br />
Zona compacta, lockere Zwischenschicht = Zona spongiosa und Zona basalis. Bei<br />
Nichtbefruchtung erfolgt die Abstoßung von Kompakta und Spongiosa im Rahmen der<br />
Menstruation. Ausfluß besteht aus Blut, Epithelzellen und Zerfallsprodukten von abgestorbenen<br />
Zellen. Die Basalis stellt die Regenerationsschicht dar, aus der die Drüsen und Arterien in der<br />
Proliferationsphase wieder aufgebaut werden.<br />
8
Abweichende Implantationsorte: Normalerweise hintere oder vordere Wand des Uterus. Bei Einnistung<br />
im Bereich des Muttermundes schwere Blutungen in der 2. Hälfte der Schwangerschaft und bei<br />
der Geburt (Plazenta praevia). Ektopische Schwangerschaften (extrauterine Gravidität) in<br />
Bauchhöhle, Ovar oder Eileiter. Bei Tubargravidität platzt der Eileiter im 2.<br />
Schwangerschaftsmonat mit starker innerer Blutung.<br />
Entwicklung zur zweiblättrigen Keimscheibe: Der Trophoblast entwickelt zwei Schichten:<br />
Synzytiotrophoblast und Zytotrophoblast. Aus dem Embryoblast entwickeln sich das Ektoderm<br />
und Entoderm, die beiden Schichten der zweiblättrigen Keimscheibe. Zwischen Ektoderm und<br />
Zytotrophoblast entsteht die Amnionhöhle. Im Synzytiotrophoblast entstehen Hohlräume<br />
(Lakunen), die schließlich mit den mütterlichen Sinusoiden (gestaute Kapillaren) in Verbindung<br />
treten; es entsteht der utero-plazentare Kreislauf. Die Blastozystenhöhle wird zum primären<br />
Dottersack. Aus dem Zytotrophoblast entstehen mesenchymale Zellen (Bindegewebszellen,<br />
Mesoderm). In diesem Mesoderm bildet sich die Chorionhöhle bzw. das extraembryonale<br />
Zölom. Schließlich ist die zweiblättrige Keimscheibe mit ihrer Amnionhöhle und ihrem<br />
Dottersack ganz von der Chorionhöhle umgeben und hat nur noch über den Haftstiel - der<br />
späteren Nabelschnur - Verbindung mit dem Trophoblast. Im Verlauf der 3. Entwicklungswoche<br />
entsteht die dreiblättrige Keimscheibe, wobei Zellen des Mesoderms zwischen die Zellen des<br />
Ektoderms und Entoderms einwandern.<br />
Embryonalperiode: Zeitraum zwischen der 4. und 8. Entwicklungswoche. Entwicklung der<br />
Organanlagen (Organogenese). Die meisten angeborenen Mißbildungen entstehen in dieser<br />
kritischen Entwicklungsperiode. Abkömmlinge des Ektoderm: ZNS, peripheres Nervensystem,<br />
Sinnesepithelien, Epidermis einschließlich Haare und Nägel, subkutane Drüsen. Abkömmlinge<br />
des Mesoderm: Bindegewebe, Knorpel und Knochen; quergestreifte und glatte Muskulatur;<br />
Wandungen des Herzens und der Gefäße; Zellen des Blutes und der Lymphe; Niere und<br />
Keimdrüsen; Milz; Rinde der Nebenniere. Abkömmlinge des Entoderm: Magen-Darm-Kanal;<br />
epitheliale Auskleidung des Respirationstraktes; Parenchym der Tonsillen, Schilddrüse, Leber<br />
und Pankreas; epitheliale Auskleidung der Harnblase und Harnröhre.<br />
Fetalperiode: Zeitraum vom Beginn des 3. Monats bis zur Geburt. Schnelles Wachstum des Körpers<br />
bei relativer Verlangsamung des Kopfwachstums. Am Ende des 3. Monats lassen sich bei<br />
abortierten Feten bereits Reflexe auslösen. Im 5. Monat werden Kindsbewegungen von der<br />
Mutter deutlich wahrgenommen. Mit 28 Wochen ist der Fetus im Prinzip lebensfähig<br />
(Frühgeburt). Normales Geburtsgewicht 3000 - 3500 g, Scheitel-Fersen-Länge 50 cm.<br />
Berechnung des Geburtstermins: Gerechnet vom ersten Tag der letzten Regel beträgt die<br />
Schwangerschaftsdauer 280 Tage = 40 Wochen = 10 Lunarmonate = 9 Kalendermonate. Die<br />
Berechnung des Geburtstermins ist am genauesten, wenn man vom Tag der Befruchtung ausgeht<br />
und 266 Tage oder 38 Wochen hinzurechnet.<br />
Funktionen der Plazenta: Austausch von Stoffwechselprodukten und Gasen zwischen mütterlichem<br />
und fetalem Blut bei vollständiger Trennung der beiden Kreislaufsysteme (Plazentaschranke);<br />
Hormonbildung (Choriongonadotropin, Progesteron, Östrogene); Übertragung von Antikörpern<br />
(passive Immunisierung des Kindes). Die Plazentaschranke kann durch Viren (Röteln, Pocken<br />
etc.) und Medikamente (z.B. Thalidomid = Contergan, Drogen und Psychopharmaka)<br />
überwunden werden, was zu Mißbildungen führt.<br />
9
Zwillinge: Zwillingshäufigkeit zwischen 0,7 - 1,5 % aller Geburten, 70 % sind zweieiige und 30 %<br />
eineiige = identische Zwillinge. Eineiige Zwillinge entwickeln sich beide aus einer einzigen<br />
befruchteten Eizelle, wobei sich die Zygote im Laufe der Entwicklung durchschnürt. Bei<br />
zweieiigen Zwillingen werden zwei Oozyten gleichzeitig ausgestoßen und von zwei<br />
verschiedenen Spermatozoen befruchtet (genetisch keine größere Ähnlichkeit als bei üblichen<br />
Geschwistern).<br />
Angeborene Mißbildungen: Auffallende morphologische Defekte, die zum Zeitpunkt der Geburt<br />
vorliegen bei ca. 2 - 3 % aller lebend Geborenen. Ursachen: 10 % Umweltfaktoren, 10 %<br />
genetische und chromosomale Faktoren, 80 % Wechselwirkung zwischen genetischen Faktoren<br />
und Umwelt. Beispiele für Ursachen: Röteln bei Frauen in der Frühschwangerschaft<br />
(Linsentrübungen des Auges, angeborene Taubheit, Mißbildungen des Herzens und der Zähne;<br />
Gegenmaßnahme: Aktive Immunisierung der Frauen), Röntgen- oder Radiumstrahlen<br />
(Schädelmißbildungen, Blindheit, Gaumenspalten, Mißbildung der Extremitäten, Spina bifida.<br />
Eine Dosis, die noch als ungefährlich angesehen werden kann, ist nicht bekannt!), Arzneimittel<br />
(Thalidomid = Contergan ---> völliges oder partielles Fehlen der Extremitäten; Zytostatika;<br />
Chinin; Antiepileptika; Cortison), Genußmittel (durch Rauchen Minderdurchblutung der<br />
Plazenta ---> niedriges Geburtsgewicht. Alkohol ---> geistiger und körperlicher Rückstand der<br />
Kinder, Fehlbildungen), Krankheiten der Mutter (bei Diabetes überdurchschnittlich große Kinder<br />
mit erhöhter Mißbildungsrate), Hypoxie (= Sauerstoffmangel, große Höhen, Frauen mit<br />
Herzkrankheiten).<br />
Mongolismus: Trisomie 21 (Down-Syndrom). Bei Müttern bis zu 25 Jahren Häufigkeit 1 : 2000, bei<br />
Müttern über 40 Jahre 1 : 100. Non-disjunction während der Oogenese. Breites Gesicht, große<br />
Zunge, Mongolenfalte, Affenhand, Schwachsinn, Herzmißbildungen.<br />
Trisomie 18: Symptome: Schwachsinn, angeborene Herzfehler, Abknickung der Finger und Hände.<br />
Häufigkeit 0,3 : 1000. Kinder sterben meist mit 2 Monaten.<br />
Klinefelter-Syndrom: Nur bei Männern, Häufigkeit 1 : 500. Geschlechtschromosomenkombination<br />
vom Typus XXY. In 80 % der Fälle ist ein Geschlechtschromatin-Körperchen nachweisbar.<br />
Symptome: Sterilität, Hodenatrophie, Gynäkomastie.<br />
Turner-Syndrom: Nur bei Frauen, Häufigkeit 1 : 4000. Chromosomensatz 45,XO. Non-disjunction<br />
beim männlichen Gameten. Symptome: Flügelhaut, Lymphödem der Extremitäten,<br />
Mißbildungen des Skelettsystems, Sterilität.<br />
Rh-Inkompatibilität: Erythrozyten des Fetus tragen das Rh-Antigen (Rh-positiv) und die der Mutter<br />
nicht (Rh-negativ). Kleine Blutungen an der Oberfläche der Zotten in der Plazenta erzeugen<br />
Antikörperbildung bei der Mutter. Antikörper gelangen über die Plazenta in den Fetus und lösen<br />
Hämolyse = Blutzerfall aus. Fruchttod, besonders bei der zweiten Schwangerschaft möglich.<br />
10
Grundlagen der Humangenetik und Erbpsychologie<br />
11<br />
Literatur: Merz, F. & Stelzl, I. (1977). Einführung in die Erbpsychologie. Stuttgart: Kohlhammer).<br />
Schilcher, F. von (1988). Vererbung des Verhaltens. Stuttgart: Thieme.<br />
Abbildungen z.T. aus Kühn, A. (1973). Grundriß der Vererbungslehre. Heidelberg: Quelle &<br />
Meyer.<br />
Mendel's Methode (1866): Versuchsmaterial verschiedene Erbsensorten (Selbst- und<br />
Fremdbefruchtung kann hier leicht kontrolliert werden). Wahrscheinlichkeitstheoretische<br />
Modellvorstellung: Empirisch gefundene Zahlenverhältnisse werden auf theoretisch<br />
angenommene Elementarfaktoren = Erbfaktoren = Gene zurückgeführt. Gesamtheit der Gene,<br />
welche ein Individuum in seinem Erbgut enthält, nennt man seinen Genotypus. Mendel hat den<br />
Erbgang von Einzelmerkmalen in aufeinanderfolgenden Generationen verfolgt. Ausgangsrassen<br />
= P-Generation (Parental-Generation), Nachkommen = 1. Bastardgeneration = F 1 -Generation (1.<br />
Filial-Generation), Nachkommen der F 1 -Generation = F 2-Generation etc. Rückkreuzung =<br />
Kreuzung der F 1 -Generation mit einer der Ausgangsrassen (R). Monohybriden = Bastarde einer<br />
Kreuzung von zwei Rassen, die sich nur in einem Merkmalspaar voneinander unterscheiden<br />
(z.B. rot- und weißblühende Rasse einer Pflanze). Di-, Tri- oder Polyhybriden unterscheiden sich<br />
in zwei, drei oder vielen Merkmalspaaren.<br />
Uniformitäts- oder Reziprozitätsgesetz: Die F 1 -Bastarde sind gleich (uniform), was bedeutet, daß die<br />
männlichen und die weiblichen Gameten für die Übertragung der Mendel'schen Erbfaktoren<br />
gleichwertig sind (Reziprozität).<br />
Spaltungsgesetz: Die F 2 -Individuen sind unter sich nicht alle gleich, sondern es spalten verschiedene<br />
Phänotypen heraus. Bei intermediärer Merkmalsausbildung (F 1 -Bastard steht zwischen der P-<br />
Generation) erscheint jeder der gegensätzlichen Merkmale der P-Rassen in 1/4 der Fälle neben<br />
2/4 intermediärer Individuen. Bei Dominanz eines Merkmals in F 1 spalten in F 2 3/4 mit dem<br />
dominanten Merkmal und 1/4 mit dem rezessiven Merkmal heraus. Ein Bastard erhält für ein<br />
bestimmtes Merkmal (z.B. Blütenfarbe) vom Vater und von der Mutter je eine Erbanlage, ein<br />
Gen. Bei der Keimzellenbildung wird dieses Genpaar getrennt, und jede Keimzelle erhält<br />
entweder das eine Gen A, oder das andere a. Ein Gamet hat in Bezug auf ein Genpaar nie<br />
Bastardnatur (Gesetz der Reinheit der Gameten). Man bezeichnet die einander entsprechenden<br />
Gene eines Paares als Allele. Wenn Individuen in dem einen Merkmal zugeordneten Genpaar<br />
gleiche Allele besitzen (AA oder aa), nennt man sie reinerbig = homozygot, wenn sie in dem<br />
Genpaar verschiedene Allele besitzen (Aa), mischerbig = heterozygot in Bezug auf dieses<br />
Merkmal.<br />
Gesetz der Neukombination der Gene: Bei Kreuzungen von Rassen, die sich in mehr als einem<br />
Merkmal voneinander unterscheiden, werden die Allele verschiedener Paare unabhängig<br />
voneinander verteilt (Gesetz der Neukombination oder Unabhängigkeitsgesetz). Hierdurch wird<br />
bewiesen, daß die Erbveranlagung, die von einem Elter dem Bastard zugeführt wird, nicht ein<br />
unteilbares Ganzes ist, sondern voneinander trennbare Einzelerbfaktoren (Gene) enthält.<br />
Modifikationen: Abweichungen des Phänotyps aufgrund verschiedener Umweltbedingungen bei<br />
gleichem Genotyp (z.B. Abhängigkeit des Farbmusters bestimmter Blüten von der<br />
Außentemperatur, die in einem bestimmten Entwicklungsstadium herrscht). Die phänotypischen<br />
Modifikationen bleiben ohne Einfluß auf den Genotyp. Vererbt wird also nicht das Merkmal,
sondern die Reaktionsweise einer bestimmten genetischen Konstitution auf bestimmte<br />
Umweltbedingungen.<br />
Phänokopie: Durch Umweltmodifikationen können Merkmale auftreten, welche bei einem anderen<br />
Genotyp genetisch fixiert sind.<br />
Reaktionsnorm: Genotyp und Phänotyp stimmen oft nicht überein, sind jedoch gesetzmäßig<br />
aufeinander bezogen. Die Gesetzmäßigkeit, welche angibt, welcher Phänotypus unter<br />
bestimmten Umweltbedingungen dem vorliegenden Genotypus entspricht, nennt man<br />
Reaktionsnorm (Beispiel: Rattenversuch von Tryon).<br />
Genkoppelung: Da bei der Meiose die Aufteilung der homologen Chromosomen auf die Gameten<br />
zufällig erfolgt, werden alle Merkmale, die auf verschiedenen Chromosomen lokalisiert sind,<br />
unabhängig voneinander vererbt (Gesetz der Neukombination). Gene, die auf demselben<br />
Chromosom vererbt werden, werden nur dann getrennt, wenn es auf dem Chromosomenabschnitt<br />
zwischen den beiden Genloci zu einem crossing-over kommt. Das wird um so seltener der Fall<br />
sein, je enger die beiden Genloci nebeneinander liegen (= Genkoppelung). Im Laufe von<br />
Generationen ist jedoch zu erwarten, daß auch zwischen eng benachbarten Genloci gelegentlich<br />
ein crossing-over stattfindet, daß also die beiden Gene in der genannten Population frei<br />
kombiniert werden.<br />
Pleiotropie (synonym Polyphänie): Ein Gen wirkt sich zugleich auf mehrere Merkmale aus (genetisch<br />
bedingte Korrelation von Merkmalen).<br />
Polygenie: Abhängigkeit eines Merkmals von vielen Genen.<br />
Selektive Partnerwahl: Homogamie = es bevorzugen sich phänotypisch ähnliche Partner, Heterogamie<br />
= es bevorzugen sich phänotypisch unähnliche Partner. Führt zu positiven bzw. negativen<br />
Merkmalskorrelationen.<br />
Geschlechtsgebundener Erbgang: Merkmale, die auf ein Gen auf dem X-Chromosom zurückgehen,<br />
können vom Vater nur an die Tochter, nicht aber an den Sohn, weitergegeben werden (z.B.<br />
Leistung beim räumlichen Vorstellen; Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter sowie Mutter<br />
und Kindern hoch, zwischen Vater und Sohn gering).<br />
Erbpsychologie (Verhaltensgenetik): Anwendung der Erblehre auf Verhaltensmerkmale.<br />
Forschungsgebiet zwischen Genetik und Psychologie (angloamerikanisch: Behavioral genetics<br />
oder behavior genetics).<br />
Selektion: Methode zur Feststellung, ob ein Merkmal eine genetische Komponente enthält. Dabei<br />
werden über eine Reihe von Generationen hinweg Tiere gezüchtet, welche das Merkmal<br />
besonders ausgeprägt oder besonders schwach zeigen. Unterscheiden sich die beiden gezüchteten<br />
Stämme überzufällig, so muß es in der Ausgangspopulation Tiere mit unterschiedlicher<br />
genetischer Ausstattung gegeben haben.<br />
Inzucht: Methode zur Erforschung des Erbgangs eines Merkmals. Hierzu benötigt man für die<br />
Kreuzungsexperimente genetisch gleiche Individuen, die man durch Inzucht, etwa über 30<br />
Generationen, erzeugt. Ein Tier, dessen Eltern hochgradig verwandt sind, erhält von den Eltern<br />
dieselbe genetische Information, ist also hinsichtlich aller Merkmale homozygot. Der Grad der<br />
Inzucht, der in einer Inzuchtreihe bereits realisiert ist, läßt sich durch Inzuchtkoeffizienten<br />
12
ausdrücken. Er gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die beiden Gene eines jeden Genlocus<br />
herkunftsgleich sind.<br />
Untersuchung von Mutanten: Mutationen führen oft zu sehr auffälligen Änderungen an den<br />
Versuchstieren (z.B. Albinismus). Die Weitergabe solcher auffälligen Merkmale läßt sich leicht<br />
über die Generationen verfolgen. An ihnen lassen sich pleiotrope Genwirkungen demonstrieren.<br />
Da in einem ingezüchteten Stamm alle Gene außer dem mutierten in beiden Linien gleich sind,<br />
können alle Unterschiede zwischen ihnen als Wirkungen des mutierten Gens interpretiert<br />
werden.<br />
Stammbaumanalyse: Man versucht den Erbgang zu bestimmen, indem man darüber einfache<br />
Hypothesen bildet, z.B. daß das Merkmal nur von einem Gen abhängt und dominant ist, und<br />
dann prüft, ob das Merkmal in den Familienstammbäumen in einer Weise weitergegeben wird,<br />
welche den Hypothesen nicht widerspricht. Besondere Stammbaummuster treten auf, wenn ein<br />
geschlechtsgebundener Erbgang, also Vererbung auf dem X-Chromosom, besteht. Bei<br />
rezessivem geschlechtsgebundenem Erbgang eines Defektes (z.B. Farbenblindheit) kann es<br />
scheinbar zu einer Vererbung vom Großvater auf den Enkel kommen: Großvater hat krankes X,<br />
Tochter erhält ein gesundes X hinzu, ist dadurch phänotypisch unauffällig; Söhne werden zur<br />
Hälfte Merkmalsträger, weil sie von der Mutter das kranke X erhalten haben, vom Vater nur das<br />
Y, welches keinen Ausgleich für das kranke Gen liefert, da ihm die homologen Gene fehlen. Die<br />
Hypothese eines dominanten geschlechtsgebundenen Erbgangs ist zu verwerfen, wenn ein<br />
kranker Vater eine gesunde Tochter hat, oder wenn die gesunde Mutter einen kranken Sohn hat.<br />
Quantitative Merkmale: Da nach der genetischen Theorie für jedes Gen nur zwei Allele existieren,<br />
scheint eine kontinuierliche Variation (z.B. Körpergröße, Persönlichkeitsmerkmale) unerklärlich<br />
zu sein. Die Schwierigkeit läßt sich jedoch beseitigen, wenn man annimmt, daß sehr viele Gene<br />
zusammenwirken und so den Ausprägungsgrad eines Merkmals bestimmen können. Schon bei<br />
einem einfachen intermediären Mendel'schen Erbgang mit den 3 möglichen Genotypen AA, Aa<br />
und aa können drei Grade der Merkmalsausprägung unterschieden werden. Hängt ein Merkmal<br />
von sehr vielen Genen ab, so sind auch sehr viele verschiedene Genotypen möglich.<br />
Genetisches Gleichgewicht: Gleichbleiben der Häufigkeit für die verschiedenen Genotypen über die<br />
Generationen hinweg. Kann durch Homo- oder Heterogamie vorübergehend gestört werden. Bei<br />
Zufallspaarung (Panmixie) ist das genetische Gleichgewicht bereits in der 2. Generation erreicht<br />
(Hardy-Weinberg-Gesetz).<br />
Grad der Erblichkeit (engl. heritability, auch Heritabilität): Relativer Anteil der genetischen Varianz an<br />
der Gesamtvarianz eines Merkmals.<br />
Erbe-Umwelt-Kovarianz: Individuen verteilen sich auf die verschiedenen Umwelten nicht unabhängig<br />
von ihren Genotypen.<br />
Erbe-Umwelt-Wechselwirkung: Auf die Umweltunterschiede reagieren die verschiedenen Genotypen<br />
unterschiedlich (unterschiedliche Reaktionsnormen).<br />
Erbbedingte und umweltbedingte Varianz: Die Aufspaltung der Gesamtvarianz in diese beiden<br />
Varianzanteile ist dann nicht hinreichend, wenn Erbe-Umwelt-Kovarianzen und/oder Erbe-<br />
Umwelt-Wechselwirkungen vorliegen.<br />
Erblichkeitsmaße: Versuchen, den genetischen Anteil an der Merkmalsvarianz anzugeben. Beruhen auf<br />
Intraclass-Koeffizienten, welche die Korrelationen zwischen Zwillingen (EZ und<br />
13
gleichgeschlechtige ZZ) angeben: r = 1 - Var(in)/ Var (x), wobei Var(in) die Varianz innerhalb<br />
der Zwillingspaare, Var(x) die Gesamtvarianz bedeutet. Index von Holzinger: H =(r EZ - r ZZ )/ (1<br />
- r ZZ ).<br />
Zwillingsmethode: Grundannahme: Jeder Unterschied zwischen genetisch identischen Paaren (EZ)<br />
muß von Umwelteinflüssen herrühren, während Unterschiede bei ZZ sowohl von genetischen als<br />
auch Umwelteinflüssen bedingt sein müssen. Einwände gegen diese Grundannahme:<br />
(1) Eiigkeitsbestimmungen: Kein Problem, da sehr genau. Falsche Diagnose erniedrigt relativen<br />
Anteil erbbedingter Varianz.<br />
(2) Genetische Identität der EZ: Gewichtiger Einwand. EZ sind möglicherweise nicht ganz<br />
identisch (zytoplasmatische Differenzen, Genmutation oder chromosomale Aberration bei der<br />
Mitose). Häufig verschiedene intrauterine Verhältnisse (unterschiedliche Blutversorgung,<br />
dadurch verschiedenes Geburtsgewicht). Diese Einflüsse vermindern den relativen Anteil<br />
erbbedingter Varianz.<br />
(3) Einflüsse von Umweltvariablen: Einerseits wird vermutet, daß gerade die genetische<br />
Ähnlichkeit von EZ mit der Zeit zu einer Betonung jeglicher Unterschiede zwischen ihnen führe,<br />
andererseits werden EZ im Unterschied zu ZZ von der Umwelt ähnlicher behandelt. Ähnliche<br />
Behandlung würde zu einer Verstärkung des relativen Anteils erbbedingter Varianz führen.<br />
(4) Generalisierungsprobleme: Üblicherweise wird von Ergebnissen der Zwillingsforschung auf<br />
die Gesamtpopulation generalisiert. Jedoch ist nicht sichergestellt, ob die Zwillinge repräsentativ<br />
sind.<br />
Erblichkeit der Intelligenz: Hängt davon ab, welche Population man in Betracht zieht. Erblichkeit muß<br />
groß sein, wenn eine genetisch uneinheitliche Population unter weitgehend übereinstimmenden<br />
Umweltbedingungen betrachtet wird; sie muß gering sein, wenn die Population genetisch<br />
einheitlich ist oder die Umweltbedingungen für die einzelnen Individuen stark verschieden sind.<br />
Aus der Literatur (Newman, Shields, Juel-Nielsen, Burt) ergibt sich eine Schätzung der<br />
Erblichkeit der Intelligenzleistungen von 80 %. Meßfehler, Umweltbedingungen und Erbe-<br />
Umwelt-Wechselwirkungen, wenn man von der Kovarianz absieht, müssen auf die restlichen 20<br />
% aufgeteilt werden.<br />
Kritik: Datenfälschungen bei Burt; Zwillinge nicht ganz repräsentativ; Korrelationen, welche bei<br />
nichtverwandten Adoptivkindern gefunden wurden, die in der gleichen Familie aufgewachsen<br />
sind, sind höher als erwartet (Koeffizienten müßten deutlich unter .20 liegen, tatsächlich .20 -<br />
.30). Untersuchungen über familiäre Ähnlichkeiten zeigen, daß eine Erblichkeit von 80 % sicher<br />
zu hoch gegriffen ist. Vermutlich ist eine Erblichkeit von 50 % realistisch.<br />
Erblichkeit morphologischer Merkmale: Körpergröße H = .76 - .93, Körpergewicht H = .38 - .77 (H =<br />
Index nach Holzinger = relativer Anteil der Erblichkeit in %, also Körpergröße je nach<br />
Untersuchung zu 76 - 93 % erblich bedingt).<br />
Erblichkeit physiologischer Merkmale: Deutlich geringer als bei den morphologischen Merkmalen.<br />
Systolischer Blutdruck .00 - .56, EEG .76 - .83.<br />
Erblichkeit von Persönlichkeitsmerkmalen: Neurotizismus: Eysenck und Prell .81, Young .46;<br />
Extraversion (Young) .43; Angst (Gottesman, MMPI) .43.<br />
14
Grundlagen der Verhaltensbiologie<br />
15<br />
Literatur: Franck, D. (1985). Verhaltensbiologie. Stuttgart: Thieme. Abbildungen z.T. aus Eibl-<br />
Eibesfeldt, I. (1967). Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung - Ethologie. München:<br />
Piper.<br />
Verhaltensbiologie: Erforscht tierisches und weiterführend menschliches Verhalten mit biologischen<br />
Methoden, auch vergleichende Verhaltensforschung oder Ethologie genannt. Fragestellungen:<br />
Physiologische Verursachung, Ontogenese und Evolution des Verhaltens.<br />
Verhaltensphysiologie: Fragt nach verursachenden, steuernden und regelnden Mechanismen, die dem<br />
Verhalten der Tiere zugrunde liegen.<br />
Ethogramm: Qualitative und quantitative Beschreibung der Verhaltensweisen einer Art.<br />
Erbkoordination: Formstarre, leicht wiedererkennbare, artspezifische Verhaltensweise, die bei jedem<br />
einzelnen Individuum der Art in gleicher Form auslösbar ist. Dies ist für die Ethologie die<br />
wichtigste Verhaltenseinheit. Der koordinierte Ablauf der Muskelkontraktionen ist genetisch<br />
vorprogrammiert, dadurch extreme Umweltstabilität.<br />
Taxiskomponente: Eine im Raum gerichtete Bewegungskomponente, die meist die Erbkoordination<br />
überlagert (Beispiel Beutefang des Frosches: Zunächst orientierende Wendung =<br />
Taxiskomponente, dann Erbkoordination = eigentliche Beutefanghandlung). Erbkoordination<br />
und Taxis zusammen werden häufig als Instinkthandlung bezeichnet.<br />
Funktionskreise: Hierzu zählen funktionell zusammengehörige Verhaltensweisen wie Aggressions-,<br />
Fortpflanzungs-, Brutpflege- oder Nahrungserwerbshandlungen. Dabei folgen die verschiedenen<br />
Erbkoordinationen gesetzmäßig aufeinander. Am Ende solcher Verhaltensfolgen stehen meist<br />
Endhandlungen, die das zu dem betreffenden Funktionskreis gehörige Verhalten zu einem<br />
vorläufigen Abschluß bringen (z.B. Begattung, Nahrungsaufnahme).<br />
Variabilität von Verhaltensfolgen: Bedingt durch Stärke des Auslösereizes und der<br />
Handlungsbereitschaft = Motivation. Letztere kann bei konstanten Umweltbedingungen aus der<br />
Intensität des Bewegungsablaufes, der Häufigkeit und Dauer der Einzelhandlungen und aus der<br />
Latenzzeit (Zeitspanne zwischen dem Beginn der Reizeinwirkung und dem Verhaltensbeginn)<br />
erschlossen werden.<br />
Doppelte Reaktionskette: Z.B. bei Balzhandlungen. Eine männliche Balzhandlung löst eine Antwort<br />
des Weibchens aus, diese wiederum eine des Männchens etc.<br />
Energetisches Motivationsmodell: Danach verbrauchen Erbkoordinationen aktionsspezifische Energie.<br />
Werden sie längere Zeit nicht ausgelöst, so kommt es zu einer Akkumulation endogen im ZNS<br />
produzierter aktionsspezifischer Energie (Triebstauung). Je mehr aktionsspezifische Energie<br />
vorhanden ist, um so schwächer können die Auslösereize sein. Im Extremfall können die<br />
Auslösereize überflüssig werden (Leerlaufhandlung).<br />
Übersprungshandlung: Irrelevante oder deplazierte Verhaltensweisen in einer Konfliktsituation (z.B.<br />
unterbrechen Hähne den Kampf und zeigen unvollkommene Pickbewegungen, obwohl keine<br />
Nahrung vorhanden ist). Zur Erklärung zwei Hypothesen:<br />
(1) Überflußhypothese: Entgegengesetzte Erregungen (Kampf und Flucht) können in der<br />
Konfliktsituation nicht abfließen. Entsprechend dem energetischen Triebmodell werden die
Erregungen gestaut, fließen über und speisen über eine dritte Bahn die Übersprungsaktivität, die<br />
somit fremdbestimmt = allochthon motiviert ist.<br />
(2) Enthemmungshypothese: Sie geht von der Beobachtung aus, daß solche Aktivitäten<br />
besonders häufig im Übersprung auftreten, die von anderen dominierenden Motivationen sehr<br />
leicht gehemmt werden, z.B. Handlungen wie Putzen, Schnabelwetzen etc. Von den beiden am<br />
Konflikt beteiligten Motivationen werden solche Aktivitäten normalerweise getrennt unter<br />
Hemmung gesetzt. Erreichen diese ein Gleichgewicht, so hemmen sie sich gegenseitig, und ihre<br />
hemmenden Einflüsse auf die Übersprungsaktivität werden aufgehoben. Somit wäre für die<br />
Übersprungsaktivität eine eigenbestimmte = autochthone Motivation anzunehmen.<br />
Umadressiertes Verhalten: Wird ein Tier daran gehindert, z.B. eine aggressive Handlungsbereitschaft<br />
abzureagieren, so kann das Aggressionsverhalten gegen ein unbeteiligtes Tier oder auch gegen<br />
leblose Gegenstände gerichtet werden.<br />
Attrappenversuch: Auslösen von Verhaltensweisen durch Attrappen. Durch Modifikation der<br />
Attrappen kann die auslösende Wirksamkeit einzelner Reize bestimmt werden. Dabei wirken die<br />
einzelnen Auslösereize einer Attrappe häufig additiv zusammen (Reizsummenphänomen).<br />
Übertreiben von Einzelreizen (supernormale Reize) lösen das Verhalten stärker aus als die<br />
natürlichen auslösenden Objekte.<br />
Angeborener Auslösemechanismus (AAM): Bestimmten Verhaltensweisen zugeordnete<br />
neurosensorische Filtermechanismen, die das Ansprechen auf die Auslösereize bestimmen,<br />
indem sie alle unwirksamen Reize herausfiltern. Die Auslösereize werden auch als<br />
Schlüsselreize bezeichnet, weil sie allein zu dem Auslösemechanismus passen. Von angeborenen<br />
Auslösemechanismen spricht man, wenn ein Tier unabhängig von Lernerfahrung auf einen<br />
Auslösereiz biologisch sinnvoll reagiert (stammesgeschichtliche Anpassung). Die<br />
Auslösemechanismen erwachsener Wirbeltiere sind i.a. komplexer als die AAM. Das Tier lernt<br />
im Laufe der Verhaltensontogenese in die AAM hinein (durch Erfahrung modifizierte<br />
angeborene Auslösemechanismen EAAM).<br />
Angeborenes Verhalten: Verhaltensweisen, deren Anpassung an die Umwelt stammesgeschichtlichen<br />
Ursprungs ist (Erbanlagen werden durch natürliche Selektion an die artgemäße Umwelt<br />
angepaßt, Artgedächtnis); z.B. können Entenküken sofort schwimmen, sobald sie erstmals mit<br />
dem Wasser in Berührung kommen.<br />
Erfahrungsentzugsexperiment: Dem Tier wird während der Verhaltensontogenese gezielt diejenige<br />
Erfahrungsmöglichkeit entzogen, die eine Anpassung aufgrund von Lernen ermöglichen würde.<br />
So wird im Kaspar-Hauser-Experiment die soziale Erfahrung entzogen, indem das Tier sozial<br />
isoliert aufgezogen wird. Letzteres führt bei Säugetieren zu tiefgreifenden Störungen des<br />
gesamten Verhaltens.<br />
Reifen angeborener Verhaltensweisen: Die von Lernvorgängen unabhängige Ontogenese<br />
stammesgeschichtlicher Anpassungen des Verhaltens wird als Reifen bezeichnet. Werden<br />
Jungtauben in Tonröhren aufgezogen, in denen sie nicht flattern können, so fliegen sie später<br />
trotzdem genauso gut wie normal aufgezogene Tiere. Tauben lernen also nicht das Fliegen,<br />
sondern das Flugvermögen reift allmählich heran.<br />
Angeborene Lerndispositionen: Die Lernfähigkeit einer Art ist ein Ergebnis stammesgeschichtlicher<br />
Anpassung. Z.B. lernen Mäuse und Ratten schnell, sich in einem Labyrinth zurechtzufinden, im<br />
16
Gegensatz zu Tieren, die unter natürlichen Bedingungen nicht in Gangsystemen leben. Hier<br />
erfolgt das Lernen auf der Grundlage einer angeborenen Lerndisposition.<br />
Prägung: Lernprozesse, die an sensible Phasen der Verhaltensontogenese gebunden sind und zu lange<br />
anhaltenden, oft irreversiblen Veränderungen des Verhaltens führen. Prägungsprozessen liegen<br />
also zeitlich begrenzte Lerndispositionen zugrunde. Beispiele: Nachfolgeprägung (bei<br />
Graugänsen wird die Nachfolgereaktion in einem kritischen Alter auf ein bewegtes Objekt<br />
fixiert, z.B. den Menschen, das zu dieser Zeit gerade verfügbar ist = Objektfixierung), sexuelle<br />
Prägung (Objektfixierung für das sexuelle Verhalten), prägungsähnliche Objektfixierungen (z.B.<br />
Aufbau der sozialen Bindung zwischen Mutter und Kind etwa bei Huftieren).<br />
Hospitalismus: Weist beim Menschen deutliche Parallelen zu Prägungsvorgängen auf.<br />
Hospitalismusschäden (Bewegungsstereotypien, verminderte Aktivität, Rückstände der<br />
Intelligenz- und Sprachentwicklung, Störung des sozialen Kontakts) entstehen beim Menschen in<br />
einer sensiblen Phase, die mit 3 Monaten beginnt und nach 2 - 3 Jahren abgeschlossen ist. Zu<br />
diesen Schäden kommt es, wenn die Kinder ohne feste Bezugsperson aufwachsen<br />
(Säuglingsheime).<br />
Habituation (Gewöhnung): Abnahme der Handlungsbereitschaft durch wiederholtes Auslösen einer<br />
Verhaltensweise durch den gleichen Reiz. Gewöhnung an einen Auslösereiz kann man als<br />
einfachsten Lernvorgang auffassen. Beispiel: Stare gewöhnen sich in Kirschplantagen an alle<br />
möglichen Abwehrmaßnahmen.<br />
Klassische Konditionierung: Bildung einer Assoziation zwischen dem unbedingten Reiz und dem<br />
bedingten Reiz (siehe SS).<br />
Operante Konditionierung: Auch als instrumentelle Konditionierung bezeichnet (siehe SS).<br />
Höhere Lernleistungen: Lernen durch Nachahmung (Imitation) ist nur von Vögeln (Lernen des<br />
Gesangs) und Säugetieren bekannt und setzt offenbar eine beträchtliche Leistungsfähigkeit des<br />
Gehirns voraus. Junge Schimpansen können z.B. Teile der Zeichensprache für Taubstumme<br />
lernen. Auch zeigen sich bei den Primaten Ansätze zu einem Verhalten durch Einsicht (Versuche<br />
von W. Köhler an Affen).<br />
Evolution: Genetischer Anpassungsprozeß über Generationen hinweg, bedingt durch die Faktoren<br />
Mutation und Selektion. Grundlage zur Erforschung der Evolution von Verhaltensweisen bildet<br />
der Artenvergleich, der mit der Beschreibung der Erbkoordinationen möglich wurde.<br />
Künstliche Selektion: Besonders gut bei Arten mit rascher Generationsfolge durchführbar (z.B.<br />
Drosophila = Taufliege, Ratte). Verhaltensänderungen bei Haustieren, sind ebenfalls durch<br />
künstliche Selektion bedingt.<br />
Homologe Verhaltensweisen: Lassen sich auf einen gemeinsamen stammesgeschichtlichen Ursprung<br />
zurückführen (Abstammungsähnlichkeit).<br />
Analoge Verhaltensweisen: Ähnliche Verhaltensweisen, die sich auf der Grundlage gleichgerichteter<br />
Selektionsdrucke, jedoch stammesgeschichtlich voneinander unabhängig, entwickeln<br />
(Anpassungsähnlichkeit).<br />
Sozialstrukturen im Tierreich:<br />
(1) Tieransammlungen (Aggregationen): Werden nicht durch soziale Attraktion, sondern<br />
durch äußere Faktoren wie Nahrung, Feuchtigkeit etc. zusammengeführt; keine echten<br />
17
Tiergesellschaften.<br />
(2) Anonyme Verbände: Werden bereits durch soziale Attraktion zusammengehalten. Es handelt<br />
sich um offene Verbände, d.h. fremde Tiere können sich anschließen. Stets wird eine<br />
Individualdistanz eingehalten. Beispiel für anonymen Verband: Fischschwärme.<br />
(3) Individualisierte Verbände: Tiere kennen sich persönlich, Aggressivität ist durch<br />
Rangordnung oder Territorialität herabgesetzt. Fremde Tiere werden nur nach längeren<br />
aggressiven Auseinandersetzungen in den Verband aufgenommen (halboffene Verbände), z.B.<br />
Wolfsrudel.<br />
(4) Tierstaaten: Z.B. Insektenstaaten der Hautflügler (Bienen, Wespen, Ameisen) und der<br />
Termiten. Sie lassen sich stammesgeschichtlich von einfachen Familienstrukturen ableiten und<br />
bilden geschlossene Verbände (Erkennen durch gemeinsamen Geruch). Extreme<br />
Rollenverteilung durch Kastenbildung: Königin, Drohnen (männliche Geschlechtstiere),<br />
Arbeiterkaste, Soldatenkaste, Kastendifferenzierung durch unterschiedliche Ernährung im<br />
Jugendalter bedingt (rein modifikatorisch).<br />
Rangordnungsstruktur (soziale Hierarchie): Jedes Tier hat einen festen sozialen Status. An der Spitze<br />
steht das Alpha-Tier, am Ende das Omega-Tier. Rangordnungen wirken aggressionsbegrenzend<br />
und tragen zum geordneten Zusammenleben bei. Ranghohe Tiere haben Vorrechte (Nahrung,<br />
Fortpflanzung), können aber auch Pflichten übernehmen (Verteidigung der Gruppe).<br />
Territorialität (Reviere): Aggressiv verteidigte Aktionsräume. Ähnlich wie Rangordnungsverhalten<br />
wirkt Territorialität aggressionsbegrenzend. Sobald die Territorien abgegrenzt sind, wird das<br />
Aggressionsverhalten stark reduziert (Nahrungs- und Paarungsterritorien).<br />
Natürliche Selektion: Im „Kampf ums Dasein“ überleben bevorzugt die erfolgreichsten,<br />
bestangepaßten genetischen Varianten, so daß es in der Generationenfolge zu einer immer<br />
besseren Anpassung der Art kommt. Dabei ist nicht das Überleben des Individuums<br />
entscheidend, sondern sein Beitrag, den es zum Genbestand der nächsten Generation liefert. Der<br />
Selektionswert eines Genotyps richtet sich danach, in welchem Umfange er die<br />
Fortpflanzungschancen seines Trägers und diejenigen seiner Nachkommen sichert. Den<br />
Selektionsvorteilen können Selektionsnachteile gegenüber stehen, so daß die Evolution vielfach<br />
zu einem Kompromiß führt. Beispiel: Größe des Hirschgeweihs.<br />
Altruistisches Verhalten: Bringt den Artgenossen Vorteile, ist für das Tier selbst aber ohne Bedeutung<br />
oder sogar nachteilig, z.B. Aufopferung der Eltern für die eigenen Jungen (evolutionstheoretisch<br />
sichert dies das Überleben der eigenen Gene und ist so selektionistisch vorteilhaft). Grundlage<br />
der Evolution altruistischer Verhaltensweisen ist die Sippenselektion, wobei das altruistische<br />
Verhalten nur den Angehörigen der eigenen Sippe zugute kommt (extremes Beispiel:<br />
Insektenstaaten).<br />
Angeborene frühkindliche Verhaltensweisen beim Menschen: Suchautomatismus nach der<br />
mütterlichen Brust, Saugbewegungen, Schreien (Signal, das die Zuwendung der Mutter auslöst)<br />
und Klammerreflexe (Verhaltensrudiment, Säuglinge der Menschenaffen werden ständig von der<br />
Mutter im Bauchfell getragen = Tragling).<br />
Tier-Mensch-Vergleich: Bei Primaten (zu denen zoologisch auch der Mensch gehört) schwierig, da<br />
kaum klar abgrenzbare, formkonstante Verhaltenselemente vorhanden sind. Den<br />
Erbkoordinationen kommen die Elemente der menschlichen Mimik am nächsten. Mimik des<br />
weinenden Menschen findet sich beim Schimpansen als Übergangsform zwischen „Wimmern“<br />
18
und „Schreien mit entblößten Zähnen“ wieder. Das menschliche Lächeln läßt sich<br />
stammesgeschichtlich vom „Furchtgrinsen“ anderer Primaten ableiten (hat dort<br />
Beschwichtigungsfunktion). Dem Menschen angeboren scheint auch der „Augengruß“ beim<br />
Flirten zu sein.<br />
Evolution geistiger Fähigkeiten: Starke Vergrößerung der Großhirnrinde. Selektionsdruck vermutlich<br />
aus der Notwendigkeit sozialen Lernens heraus, da im Primatenverband die Fähigkeit zum<br />
sozialen Lernen entscheidend den Fortpflanzungserfolg der Individuen bedingt.<br />
Kulturelle Evolution: Wird der biologischen Evolution gegenübergestellt. Es handelt sich um durch<br />
individuelle Lernprozesse erworbene Verhaltensanpassungen auf dem Wege der Tradition. Sie<br />
hat den Vorteil, daß sie viel schneller zu Verhaltensanpassungen führt, zumal die genetische<br />
Anpassung des menschlichen Verhaltens jenen Umweltbedingungen entspricht, denen der<br />
Mensch vor etwa 10.000 Jahren ausgesetzt war.<br />
19<br />
Funktion des Blutes<br />
Literatur: Für dieses und alle weiteren Kapitel, sofern nicht anders angegeben: Schmidt, R.F. & Thews,<br />
G. (Hrsg.) Physiologie des Menschen. Berlin: Springer (jeweils neueste Auflagen).<br />
Aufgaben des Blutes: Transportfunktion (Atemgase, Nährstoffe, Stoffwechselprodukte,<br />
Wärmeverteilung), Konstanthaltung des inneren Milieus (Konzentration gelöster Stoffe,<br />
Temperatur, pH-Wert), Schutz vor Blutverlust (Gerinnung), Abwehrfunktion (Phagozytose,<br />
Antikörperbildung).<br />
Zusammensetzung: Plasma, in dem Erythrozyten (rote Blutzellen), Leukozyten (weiße Blutzellen) und<br />
Thrombozyten (Blutplättchen) suspendiert sind. Volumen beim Erwachsenen 4 - 6 Liter. Anteil<br />
der Blutzellen am Blutvolumen wird Hämatokrit genannt, er beträgt ca. 45 Vol% und bestimmt<br />
wesentlich die innere Reibung des Blutes (Viscosität).<br />
Flüssigkeitsräume des Organismus: Blutgefäßsystem, interstitieller Raum (Zwischenzellraum) und<br />
intrazellulärer Raum.<br />
Blutplasma: Zusammensetzung ca. 91 % Wasser, 7 % Eiweiß, 2 % kleinmolekulare Substanzen.<br />
Elektrolytkonzentrationen im Plasma und interstitieller Flüssigkeit ähnlich, wichtigste<br />
Elektrolyte Natrium und Chlorid. Dagegen dominiert im Intrazellularraum anstelle des Natriums<br />
das Kalium. Osmotischer Druck im Plasma (bedingt durch die Konzentration gelöster Stoffe) 7,3<br />
atm. Lösungen, die den gleichen osmotischen Druck haben wie Plasma, bezeichnet man als<br />
isotonisch. Hypotones Plasma führt zum Wassereinstrom in die Zellen (Ödem), hypertones zur<br />
Schrumpfung der Zellen.<br />
Funktion der Plasmaproteine (Plasmaeiweiß): Nährfunktion (Zerlegung der Proteine mittels Enzymen<br />
in Aminosäuren, die als Bausteine für die Zellen dienen), Vehikelfunktion (zum Transport<br />
werden kleinmolekulare Stoffe an Plasmaproteine gebunden), unspezifische Trägerfunktion<br />
(bluteigene Elektrolyte, z.B. Calcium, werden z.T. an Plasmaproteine gebunden), Erzeugung des
kolloidosmotischen Drucks (Regulierung der Wasserverteilung zwischen Plasma und<br />
Interstitium), Pufferfunktion (Plasmaproteine können mit Säuren und Basen Salze bilden,<br />
wichtig für konstanten pH-Wert), Schutz vor Blutverlust (Gehalt an Fibrinogen).<br />
Erythrozyten: Flache, runde, kernlose Scheiben, wobei die Form eine große Diffusionsfläche für die<br />
Atemgase schafft; ca. 5 Mill. im mikrol Blut. Werden im roten Mark der platten Knochen<br />
gebildet und im retikuloendothelialen System abgebaut. Reiz für Neubildung (Erythropoese) ist<br />
das Absinken des O 2 -Partialdruckes, wodurch es zur Ausschüttung von Erythropoetin aus der<br />
Niere kommt. Erythrozyten haben die Fähigkeit zur reversiblen O 2 -Bindung.<br />
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BSG): Erythrozyten sinken im ungerinnbar gemachten,<br />
stehenden Blut langsam ab. Die BSG ist bei Entzündungen und Tumoren erhöht. Ursache ist eine<br />
Veränderung der Plasmaproteine, die zu einer verstärkten Agglomerationsneigung der<br />
Erythrozyten (Senkungsbeschleunigung) führt.<br />
Leukozyten: Sind amöboid beweglich und können phagozytieren. Normal 4.000 - 10.000 im mikrol<br />
Blut. Niedrigere Zahlen = Leukopenie, höhere Zahlen = Leukozytose (besonders bei<br />
Entzündungen). Man unterscheidet Granulozyten (aus dem Knochenmark), Lymphozyten (aus<br />
den Lymphknoten) und Monozyten (aus dem Knochenmark). Granulozyten unterteilt man nach<br />
der Anfärbbarkeit in neutrophile (überwiegend im Eiter enthalten), eosinophile (erhöht bei<br />
allergischen Reaktionen) und basophile Granulozyten. Granulozyten spielen eine Rolle bei der<br />
unspezifischen Abwehr, Lymphozyten bei der spezifischen Abwehr und Monozyten haben eine<br />
hohe Phagozytose-Kapazität.<br />
Thrombozyten: Flach, unregelmäßig rund, kernlos; normal 150.000 - 300.000. Entstehen im<br />
Knochenmark und werden in Leber, Lunge und Milz abgebaut. Funktion: Blutgerinnung und<br />
Phagozytose.<br />
Blutungsstillung und Gerinnung: Nach Verletzungen stoppt die Blutung nach 1 - 3 Minuten (primäre<br />
Hämostase durch Vasokonstriktion und Verschluß durch Thrombozytenpfropf). Danach erst<br />
Blutgerinnung (sekundäre Hämostase). Grundschema der Blutgerinnung: Prothrombin wird<br />
durch Thrombokinase (entsteht beim Zerfall von Thrombozyten) in Gegenwart von ionisiertem<br />
Calcium zu Thrombin umgewandelt. Thrombin bewirkt seinerseits die Umwandlung des<br />
gelösten Plasmaeiweißkörpers Fibrinogen zu Fibrin, das das fädige Gerüst der Blutgerinnsel<br />
bildet. Das Blut geht dabei aus dem flüssigen in einen gallertartigen Zustand über. Später kommt<br />
es zum Zusammenziehen (Retraktion) der Fibrinfäden. Dabei entsteht der halbfeste, rote<br />
Blutkuchen und eine klare gelbliche Flüssigkeit, das Serum (= Plasma ohne Fibrinogen).<br />
Abwehrfunktion des Blutes:<br />
(1) Unspezifische zelluläre Abwehr: Phagozytose durch die Leukozyten.<br />
(2) Unspezifische humorale Abwehr: Vorhandensein von Komplement (Gruppe von 9<br />
Plasmafaktoren, die sich gegenseitig aktivieren; unterstützt die Wirkungen der Antikörper),<br />
Lysozym (in Leukozyten gebildet; hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren), C-reaktivem<br />
Protein (aktiviert das Komplementsystem), Interferon (in Leukozyten gebildet; hemmt das<br />
Wachstum von Viren) und sog. „natürlichen Antikörpern“, die sich aber vermutlich aus dem<br />
frühen Kontakt mit bakteriellen Antigenen aus der Darmflora gebildet haben.<br />
(3) spezifische zelluläre Abwehr (Immunreaktion vom verzögerten Typ): Gegen Antigene (=<br />
potentiell schädigende Substanzen, z.B. Krankheitserreger, artfremdes Eiweiß) werden vom<br />
Organismus Antikörper (Immunglobuline) gebildet, die im Rahmen der Antigen-Antikörper-<br />
20
Reaktion den Antigenen die schädlichen Eigenschaften nehmen. Bei der spezifischen zellulären<br />
Abwehr sind die T-Lymphozyten beteiligt, deren Stammzellen im Knochenmark liegen. Nach<br />
der immunologischen Prägung im Thymus (= T) wandern sie in die lymphatischen Organe<br />
(Lymphknoten, Milz) ein. Beim Kontakt mit einem Antigen werden Tochterzellen von den T-<br />
Lymphozyten gebildet (Primärreaktion), die T-Effectorzellen und die langzeitig im Blut<br />
zirkulierenden T-Gedächtniszellen. Bei den T-Effectorzellen kann man mehrere<br />
Subpopulationen unterscheiden: Z.B. T-Killerzellen (zerstören das Antigen im Zuge der<br />
Antigen-Antikörper-Reaktion), T-Lymphokinzellen (setzen hormonartige Stoffe frei, die<br />
Makrophagen aktivieren), T-Suppressorzellen (hemmen die Aktivitäten von T- und B-<br />
Lymphozyten und verhindern so eine überschießende Immunantwort). Beim zweiten<br />
Antigenkontakt kommt es durch die Vermittlung der T-Gedächtniszellen zu einer raschen<br />
Bildung großer Zahlen von T-Killerzellen (Sekundärreaktion).<br />
(4) spezifische humorale Abwehr (Immunreaktion vom Soforttyp): Abwehr ähnlich wie unter<br />
(3). Aus immunologisch geprägten B-Lymphozyten werden bei Antigen-Exposition einerseits B-<br />
Gedächtniszellen, andererseits Plasmazellen gebildet, wobei letztere die humoralen Antikörper<br />
produzieren. Auch hier erfolgt die Sekundärreaktion bei erneutem Kontakt mit dem Antigen<br />
rascher und intensiver. Da diese Immunantwort schneller erfolgt als unter (3) spricht man vom<br />
Soforttyp.<br />
Aktive-passive Immunisierung: Bei der aktiven Immunisierung (Impfung) nimmt man die<br />
Primärreaktion vorweg und führt dem Organismus unschädliche Mengen eines Antigens zu. Bei<br />
einer Infektion sind dann schon die spezifischen Antikörper vorhanden. Bei der passiven<br />
Immunisierung werden dem Patienten spezifische Antikörper gegen das jeweilige Antigen in<br />
Form von Immunglobulinpräparaten zugeführt.<br />
Allergie: Bei wiederholter Exposition gegenüber einem Antigen führt die Antigen-Antikörper-<br />
Reaktion zu Überempfindlichkeitserscheinungen.<br />
Blutgruppen: An der Zellmembran der Erythrozyten befindet sich eine Anzahl spezifischer Komplexe<br />
mit Antigen-Eigenschaften, die man als Agglutinogene bezeichnet. Die spezifischen Antikörper,<br />
die mit diesen Agglutinogenen reagieren (z.B. bei falscher Bluttransfusion), sind im Blutplasma<br />
gelöst und werden als Agglutinine bezeichnet. Das Blut jedes Menschen ist durch einen<br />
bestimmten Satz spezifischer Agglutinogene charakterisiert: A, B, AB und 0. In diesem AB0-<br />
System richtet sich die Blutgruppenzugehörigkeit also nach den Antigeneigenschaften der<br />
Erythrozyten des Trägers. Im Laufe des ersten Lebensjahres werden Antikörper (Agglutinine)<br />
gegen diejenigen Antigene entwickelt, die die eigenen Erythrozyten nicht besitzen: Anti-A und<br />
Anti-B bei Blutgruppe 0. Anti-B bei Blutgruppe A, Anti-A bei Blutgruppe B und keine<br />
Agglutinine bei Blutgruppe AB. Verteilung der Blutgruppen in Mitteleuropa: 42 % A, 40 % 0,<br />
12 % B und 6 % AB.<br />
21
Funktion des Herzens<br />
22<br />
Systole und Diastole: Die Pumpwirkung des Herzens beruht auf der rhythmischen Zusammenziehung<br />
(Systole) und Erschlaffung (Diastole) der Herzkammern (Ventrikel). In der Diastole füllen sich<br />
die Ventrikel mit Blut. In der Systole werfen sie es in die A. pulmonalis bzw. Aorta aus. Ein<br />
Rückstrom wird durch die Herzklappen verhindert. Jeder Herzkammer ist ein Vorhof (Atrium)<br />
vorgeschaltet, der das Blut aus den großen Venen (Hohlvenen bzw. Venae pulmonales)<br />
aufnimmt.<br />
Arterien und Venen: Die Bezeichnung von Blutgefäßen richtet sich nach der Strömungsrichtung und<br />
nicht nach der Beschaffenheit des enthaltenen Blutes. Venen führen das Blut dem Herzen zu,<br />
Arterien führen es vom Herzen weg.<br />
Funktionselemente des Herzens: Arbeitsmuskulatur (Arbeitsmyokard) und Fasern des spezifischen<br />
Erregungsbildungs- bzw. Erregungsleitungssystems.<br />
Autorhythmie: Die Pulsationen des Herzens werden durch Erregungen ausgelöst, die im Herzen selbst<br />
entstehen. Ein aus dem Körper entnommenes Herz schlägt daher weiter.<br />
Reihenfolge der Erregungsausbreitung: Sinusknoten (im rechten Vorhof, gibt den Anstoß zu einem<br />
Herzschlag mit 70 Pulsen/Min bei Körperruhe) ---> Erregungsausbreitung über<br />
Arbeitsmuskulatur der Vorhöfe ---> Überleitung auf die Ventrikel über den<br />
Atrioventricularknoten (AV-Knoten) mit einer Verzögerung ---> His-Bündel ---> Tawara-<br />
Schenkel (rechter und linker) ---> Pukinje-Fäden (Endaufzweigungen des Reizleitungssystems).<br />
Hierarchie der Erregungsbildung: Sinusknoten ist der primäre Schrittmacher. Fällt die<br />
Erregungsbildung im Sinusknoten aus, so kann ersatzweise der AV-Knoten als sekundäres<br />
Erregungsbildungszentrum die Schrittmacher-Funktion übernehmen (AV-Rhythmus 40 -<br />
60/Min). Im Falle einer kompletten Unterbrechung der Überleitung von den Vorhöfen auf die<br />
Ventrikel (totaler Herzblock) kann schließlich ein tertiäres Zentrum im ventrikulären<br />
Erregungsleitungs-System als Schrittmacher einspringen (30 - 40/Min.).<br />
Aktionspotential: Rasche Umladung vom Wert des Ruhepotentials (-90 mV) bis zum Gipfel der<br />
initialen Spitze (+ 30 mV). An diese schnelle Depolarisationsphase (1 - 2 ms), schließt sich ein<br />
langdauerndes Plateau (ca. 200 ms) an, bevor die Repolarisation zum Ruhepotential erfolgt.<br />
Aktionspotential dauert etwa 100 mal länger als bei der Skelettmuskel- oder Nervenfaser.<br />
Langsame diastolische Depolarisation (Schrittmacherpotential): In allen Herzmuskelzellen mit der<br />
Fähigkeit zur autorhythmischen Erregungsbildung erfolgt die Depolarisation zum<br />
Schwellenpotential, bei dem ein neues Aktionspotential ausgelöst wird, spontan. Es handelt sich<br />
dabei um einen lokalen Erregungsvorgang. Normalerweise sind nur wenige Zellen im<br />
Sinusknoten tatsächlich für die Erregungsbildung verantwortlich. Alle übrigen Fasern des<br />
spezifischen Systems werden von fortgeleiteten Erregungen ergriffen, bevor ihre langsamen<br />
diastolischen Depolarisationen das Schwellenpotential erreichen (potentielle Schrittmacher).<br />
Refraktärperioden: Während der absoluten Refraktärperiode ist keine Neuerregung der Herzmuskulatur<br />
möglich. In der anschließenden relativen Refraktärperiode kehrt die Erregbarkeit allmählich<br />
zurück. Durch die langdauernde Refraktärzeit wird die Muskulatur vor einer schnellen<br />
Wiedererregung geschützt, die ihre Pumpfunktion beeinträchtigen könnte. Im Unterschied zum
Skelettmuskel ist der Herzmuskel nicht in der Lage, eine rasche Folge von Aktionspotentialen<br />
mit der Superposition von Einzelkontraktionen zu beantworten (Nicht-Tetanisierbarkeit des<br />
Myokards).<br />
Parasympathische Innervation: Der Nervus Vagus verbindet die kreislaufregulierenden Zentren in der<br />
Medulla oblongata mit dem Herzen. Fasern des rechten Vagus versorgen den Sinusknoten,<br />
Fasern des linken den AV-Knoten. Reizung des rechten Vagus führt zur Senkung der<br />
Herzfrequenz (negative chronotrope Wirkung) durch Abnahme der Steilheit der diastolischen<br />
Depolarisation. Reizung des linken Vagus verlängert die Überleitungszeit (negativ dromotrope<br />
Wirkung). Zudem wird unter Vaguseinfluß die Kontraktionsstärke der Vorhöfe vermindert durch<br />
Verkürzung der Dauer des Aktionspotentials (negative inotrope Wirkung). Überträgerstoff des<br />
Vagus ist Acetylcholin. Keine parasympathische Innervation der Ventrikel!<br />
Sympathische Innervation: Verlauf der sympathischen Herznerven: Kreislaufzentren (Medulla<br />
oblongata) ---> Umschaltung auf präganglionäre Fasern in den Seitenhörnern des Rückenmarks -<br />
--> Umschaltung auf postganglionäre Fasern im Grenzstrang ---> Herz. Sympathikus versorgt<br />
alle Teile des Herzens. Überträgerstoffe Noradrenalin und Adrenalin. Sympathische Einflüsse<br />
können dem Herzen auch durch die im Blut zirkulierenden Katecholamine aus dem<br />
Nebennierenmark zufließen. Wirkungen des Sympathikus: Zunahme der Herzfrequenz (positiv<br />
chronotrope Wirkung) durch Zunahme der Steilheit der diastolischen Depolarisation, Erhöhung<br />
der Kontraktionskraft in Vorhöfen und Ventrikeln (positive inotrope Wirkung), Beschleunigung<br />
der Überleitung im AV-Knoten (positive dromotrope Wirkung).<br />
Elektrokardiogramm (EKG): Ausdruck der Herzerregung. Im EKG wird der zeitliche Verlauf von<br />
elektrischen Spannungen registriert, die als Folge der Erregungsvorgänge im Herzen zwischen<br />
definierten Stellen der Körperoberfläche auftreten. Das EKG liefert Anhaltspunkte über<br />
Frequenz, Ursprung, Ausbreitung und Rückbildung der Erregung des Herzens. Zacken bzw.<br />
Wellen = Ausschläge in positiver und negativer Richtung, mit den Buchstaben P bis T<br />
bezeichnet; Strecken = Abstand zwischen zwei Zacken (z.B. PQ-Strecke = Ende P bis Anfang<br />
Q); Intervalle = umfassen Zacken und Strecken (z.B. PQ-Intervall = Anfang P bis Anfang Q).<br />
P-Welle: Ausdruck der Erregungsausbreitung über beide Vorhöfe.<br />
PQ-Strecke: Vorhöfe sind als Ganzes erregt.<br />
QRS-Gruppe: Ausdruck der Erregungsausbreitung über beide Ventrikel.<br />
ST-Strecke: Zeigt die Totalerregung des Ventrikelmyokards an.<br />
T-Welle: Ausdruck der ventrikulären Erregungsrückbildung.<br />
PQ-Intervall = Überleitungszeit: Verlängerungen deuten auf Störungen der Erregungsleitung im<br />
Bereich des AV-Knotens bzw. des His-Bündels hin.<br />
Diagnostisch liefert das EKG folgende Informationen: Frequenz, Ursprung der Erregung (Sinus-,<br />
AV-Knoten), Rhythmusstörungen, Leitungsstörungen, Hinweise auf anatomische Herzlage,<br />
Hinweise auf extrakardiale Einflüsse (Stoffwechselstörungen, Vergiftungen etc.), Hinweise auf<br />
primär kardiale Störungen der Erregung (Koronardurchblutung, Entzündungen) und<br />
Myokardinfarkt.<br />
Herzklappen: Atrio-Ventrikularklappen zwischen Vorhöfen und Ventrikeln (Mitralklappe links,<br />
Tricuspidalklappe rechts) dienen zur Abdichtung der Ventrikel gegen die Vorhöfe während der<br />
Systole, auch als Segelklappen bezeichnet. Aorten- und Pulmonalklappen (Taschenklappen oder<br />
Semilunarklappen, so genannt wegen ihres Baus) verhindern den Rückstrom von Blut in die<br />
23
Ventrikel während der Diastole. Durch entzündliche Veränderungen an den Klappen kann eine<br />
ungenügende Öffnung (Stenose) oder ein undichter Verschluß (Insuffizienz) resultieren.<br />
Aktionsphasen des Herzens:<br />
(1) Anspannungsphase: Zu Beginn der Kammersystole führt der Anstieg des intraventrikulären<br />
Drucks zum Verschluß der AV-Klappen. Da zu diesem Zeitpunkt auch die Semilunarklappen<br />
geschlossen sind, spannt sich die Ventrikelmuskulatur um den inkompressiblen Inhalt an und<br />
bewirkt weiteren Druckanstieg.<br />
(2) Austreibungsphase: Wenn der intraventrikuläre Druck den diastolischen Aortendruck von ca.<br />
80 mmHg übertrifft, öffnen sich die Semilunarklappen und die Austreibung beginnt. Der<br />
Ventrikeldruck steigt dabei zunächst noch weiter bis zu einem Maximalwert von ca. 130 mmHg<br />
an und fällt gegen Ende der Systole wieder ab, wobei sich die Semilunarklappen schließen.<br />
(3) Entspannungsphase: Zunächst sind alle Klappen geschlossen, der intraventrikuläre Druck<br />
fällt rasch auf nahezu 0 ab. Beim Unterschreiten des Vorhofdrucks öffnen sich die AV-Klappen.<br />
(4) Füllungsphase: Hierbei steigt der Ventrikeldruck nur wenig an. Die Volumenvergrößerung<br />
geschieht anfangs schnell, dann langsamer. Bei normaler Herzfrequenz ist die Kammerfüllung<br />
z.Zt. der Vorhofkontraktion fast völlig geschlossen. Erst bei höheren Frequenzen wird die<br />
Vorhofkontraktion wirksam, da hierbei die Diastolendauer stark verkürzt wird.<br />
Ventilebenen-Mechanismus: Während der Austreibungsphase pressen die Ventrikel in einem<br />
Arbeitsgang Blut in die großen Arterien aus und saugen gleichzeitig Blut aus den großen Venen<br />
in die Vorhöfe hinein. Die Sogwirkung kommt dadurch zustande, daß sich die Ventilebene (=<br />
Grenzfläche zwischen Vorhöfen und Kammern), in der die Herzklappen liegen, in Richtung zur<br />
Herzspitze verschiebt und die inzwischen erschlafften Vorhöfe dehnt. Am Ende der<br />
Austreibungsphase sind die Vorhöfe prall mit Blut gefüllt. Sobald nun die Ventrikelmuskulatur<br />
erschlafft, kehrt die Ventilebene bei weit geöffneten AV-Klappen in ihre Ausgangslage zurück<br />
und schiebt sich dabei über das Blutvolumen hinweg (= rasche Kammerfüllung).<br />
Herztöne: I. Herzton: Anspannungston, hervorgerufen durch die Anspannung des Ventrikelmyokards<br />
um den inkompressiblen Inhalt zu Beginn der Systole. II. Herzton: Klappenton, hervorgerufen<br />
durch das Zuschlagen der Semilunarklappen zu Beginn der Diastole. Aufzeichnung der Herztöne<br />
= Phonokardiogramm. Herzgeräusche = Veränderungen des normalen Herzschalls (Stenose,<br />
Insuffizienz der Klappen).<br />
Koronare Herzkrankheit: Herzinfarkt (= Myokardinfarkt) und Angina pectoris vera. Beiden liegt eine<br />
Koronarinsuffizienz zugrunde, die man als Mißverhältnis zwischen Bedarf und Angebot an Blut<br />
zur Versorgung der Herzmuskulatur definieren kann. Beim Herzinfarkt liegt meist eine Sklerose<br />
der Herzkranzgefäße (Koronararterien) vor, die über eine Koronarverengung bzw.<br />
Koronarverschluß die Durchblutungsstörungen am Herzmuskel hervorruft. Im nicht mehr<br />
durchbluteten Herzabschnitt kommt es zum Gewebsuntergang (= Nekrose). Bei der Angina<br />
pectoris vera handelt es sich um eine vorübergehende Durchblutungsstörung, mit heftigen<br />
Schmerzen hinter dem Brustbein, die meist in den linken Arm ausstrahlen. Hiervon ist die<br />
Pseudo-Angina pectoris zu unterscheiden, die nicht auf organischer Grundlage beruht, sondern<br />
Ausdruck sog. funktioneller Beschwerden (Somatoforme Störung) ist. - Ist ein größerer<br />
Abschnitt des Myokards von der Durchblutungsstörung (Ischämie) betroffen, so kann es zur<br />
Herzruptur mit Sekundenherztod kommen. Beim Infarkt können die Schmerzen aber auch fehlen<br />
(stummer Infarkt). Diagnose des Infarkts durch EKG und Anstieg bestimmter Enzyme im Serum.<br />
24
25<br />
Die koronare Herzkrankheit ist multifaktoriell bedingt (Risikofaktoren, z.B. Bluthochdruck,<br />
Rauchen).<br />
Das Gefäßsystem<br />
Aufbau der Gefäßwand: Intima: Innere Schicht des Gefäßes mit Endothelzellen (einschichtiges<br />
Pflasterepithel) und elastischen Fasern. Media: Mittlere Schicht mit glatten Muskelzellen<br />
(wichtig für die aktive Spannung, den Gefäßtonus) und kollagenen Fasern. Adventitia: Äußere<br />
Schicht mit kollagenen Fasern und wenig glatten Muskelzellen.<br />
Morphometrie des Gefäßsystems: Aus der Aorta (ca. 50 cm lang) entspringen die Arterien (wenige cm<br />
- 50 cm), daran schließen sich die Arteriolen (Länge wenige mm) und am Ende die Kapillaren<br />
(0,5 - 1,0 mm) an. Die Venen weisen annähernd gleiche Längen wie die entsprechenden Arterien<br />
auf.<br />
Druck im Arteriensystem: Maximum der Druckpulskurve während der Systole = systolischer<br />
Blutdruck (ca. 120 mmHg) und Minimum während der Diastole = diastolischer Blutdruck (ca. 80<br />
mmHg). In den terminalen Arterienästen sowie in den Arteriolen fällt der Druck wegen des<br />
hohen Strömungswiderstandes steil ab.<br />
Flüssigkeitsgleichgewicht zwischen intravasalem und interzellulärem Raum: Am arteriellen Ende der<br />
Kapillaren beträgt der nach außen gerichtete Druck 37 mmHg (hydrostatischer Druck in den<br />
Kapillaren = 32,5 mmHg + kolloidosmotischer Druck des Interstitiums = 4,5 mmHg) und der<br />
nach innen gerichtete Druck 28 mmHg (kolloidosmotischer Druck des Plasmas = 25 mmHg +<br />
hydrostatischer Druck des Interstitiums = 3 mmHg). Es entsteht somit ein effektiver<br />
Filtrationsdruck von 9 mmHg, wobei eine Filtration von Flüssigkeit in den interstitiellen Raum<br />
erfolgt. Am venösen Ende der Kapillaren beträgt der nach außen gerichtete Druck 22 mmHg<br />
(Abnahme des hydrostatischen Drucks in den Kapillaren auf 17,5 mmHg + kolloidosmotischer<br />
Druck des Interstitiums = 4,5 mmHg) und der nach innen gerichtete Druck bleibt konstant bei 28<br />
mmHg. Somit entsteht ein effektiver Reabsorptionsdruck von 6 mmHg, wodurch eine<br />
Reabsorption von Flüssigkeit aus dem interstitiellen Raum stattfindet. Da der<br />
Reabsorptionsdruck jedoch etwas kleiner als der Filtrationsdruck ist, werden nur 90 %<br />
reabsorbiert, die restlichen 10 % werden über die Lymphgefäße abtransportiert.<br />
Lymphsystem: Durch die Lymphgefäße, die in das Venensystem münden, wird interstitielle Flüssigkeit<br />
in das Blut zurückgeleitet. Die Wände der Lymphkapillaren bestehen aus einschichtigem<br />
Endothel, die Wände der größeren Lympfgefäße weisen glatte Muskelfasern und Klappen (zur<br />
Verhinderung des Rückstroms) ähnlich wie die Venen auf. In größeren Lymphgefäßen sind<br />
Lymphknoten (Filterfunktion) zwischengeschaltet.<br />
Periphere Durchblutungsregulation: Durchblutungsänderungen beruhen im wesentlichen auf<br />
Änderungen der Gefäßdurchmesser (Abhängigkeit des Strömungswiderstandes von der 4. Potenz<br />
des Gefäßradius). Der Gefäßdurchmesser wird vom augenblicklichen Kontraktionszustand der<br />
glatten Gefäßmuskulatur bestimmt, welcher der Gefäßwand den Gefäßtonus verleiht. Zunahmen
des Kontraktionszustandes = Vasokonstriktion, Abnahmen des Kontraktionszustandes =<br />
Vasodilatation. Durch Veränderungen des relativen Widerstandes vor allem in den Arteriolen (=<br />
Widerstandsgefäße) wird die Verteilung des Herzzeitvolumens auf die einzelnen parallel<br />
geschalteten Organkreisläufe gesteuert. In den Gefäßgebieten mit stark wechselnden<br />
funktionellen Anforderungen (Skelettmuskulatur, Gastrointestinaltrakt, Leber, Haut) können die<br />
relativ größten Durchblutungsänderungen auftreten. Demgegenüber wird die lebenswichtige<br />
Durchblutung des Gehirns und der Nieren weitgehend konstant gehalten. Die Gefäßreaktionen<br />
bei der Leistungsanpassung beruhen auf nervösen Einflüssen, humoralen Faktoren und lokalen<br />
Mechanismen.<br />
Gefäßinnervation: Die nervöse Beeinflussung der Blutgefäße (= vasomotorische Steuerung) erfolgt<br />
durch das autonome Nervensystem, überwiegend durch sympathische Anteile. Mit Ausnahme<br />
der Kapillaren werden alle Blutgefäße innerviert. Die Intensität der Reaktion der glatten<br />
Gefäßmuskulatur hängt direkt von der Frequenz der efferenten Impulse ab. Der Ruhetonus der<br />
Gefäße beruht auf einer ständigen Aktivität von 1 - 3 Impulsen/s. Zunahmen der Impulsfrequenz<br />
bewirken vasokonstriktorische und Abnahmen dilatatorische Reaktionen. Bei den eben<br />
genannten efferenten Nerven handelt es sich um sympathische, adrenerge, vasokonstriktorische<br />
Fasern. Parasympathische, cholinerge, vasodilatatorische Fasern innervieren lediglich die Gefäße<br />
der äußeren Genitalorgane.<br />
Humoral-hormonale Effekte: Die Gefäßwirkungen der vom Nebennierenmark sezernierten<br />
Katecholamine (Adrenalin und Noradrenalin) sind komplex. An der Membran der<br />
Gefäßmuskulatur befinden sich verschiedene adrenerge Rezeptoren, die α- und ß-Rezeptoren.<br />
Durch Erregung der α-Rezeptoren wird eine Kontraktion, durch Erregung der ß-Rezeptoren eine<br />
Entspannung der glatten Muskelfasern ausgelöst. Noradrenalin wirkt dabei nur auf die α-<br />
Rezeptoren, Adrenalin auf beide. Im Blut zirkulierendes Adrenalin bewirkt durch seine<br />
Wirkungen auf ß-Rezeptoren im allgemeinen Abnahmen des Gesamtwiderstandes, zugleich<br />
nimmt das Herzzeitvolumen aufgrund von Steigerungen des Schlagvolumens und der<br />
Herzfrequenz zu. Solche Effekte treten bei Muskelarbeit oder psychischer Belastung auf.<br />
Noradrenalin verursacht dagegen ausschließlich Erhöhungen des Strömungswiderstandes, der<br />
arterielle Druck steigt an.<br />
Lokale Durchblutungsregulation: Bei Abnahme des O 2 -Partialdrucks im Blut kommt es zu<br />
vasodilatatorischen Reaktionen. Lokale Erhöhungen des CO 2 -Partialdrucks oder pH-<br />
Erniedrigung lösen ebenfalls dilatatorische Reaktionen aus.<br />
Blutdruck: Indirekte Messung mit Oberarmmanschette nach Riva-Rocci-Korotkow an der A.<br />
brachialis. Höhe des individuellen Blutdrucks abhängig von Vererbung, Alter, Geschlecht u.a.<br />
Faktoren. Beim jugendlichen Erwachsenen normalerweise 120 mmHg systolisch, 80 mmHg<br />
diastolisch. Abnahme beider Werte im Schlaf um ca. 20 mmHg. Hypertonie = Blutdruckwerte<br />
oberhalb des Normbereichs, Hypotonie = Blutdruckwerte unterhalb der Norm. WHO-<br />
Deskription für Hypertonie: systolisch über 140 oder diastolisch über 90 mmHg.<br />
26
Atmung<br />
27<br />
Atmung: Gaswechsel zwischen den Zellen und der Umgebung. Am Transport des Sauerstoffs (O 2 ) von<br />
der Außenluft zur Zelle sind nacheinander beteiligt: (1) Transport zu den Lungenalveolen durch<br />
die Ventilation, (2) Diffusion von den Alveolen in das Lungenkapillarblut (beide Teilprozesse<br />
zusammen bezeichnet man als Lungenatmung = äußere Atmung), (3) Transport zu den<br />
Gewebekapillaren durch den Blutkreislauf (Atemgastransport des Blutes) und (4) Diffusion von<br />
den Gewebekapillaren in die umgebenden Zellen (Gewebsatmung = innere Atmung). Der<br />
Abtransport des Kohlendioxyds (CO 2 ), das als gasförmiges Endprodukt des oxydativen<br />
Stoffwechsels in den Zellen gebildet wird, setzt sich in analoger Weise aus vier Teilprozessen<br />
zusammen.<br />
Atmungsbewegungen: Die für den Gasaustausch notwendige Belüftung der Alveolen (=<br />
Lungenbläschen) wird durch den rhythmischen Wechsel von Inspiration (Einatmung) und<br />
Exspiration (Ausatmung) bewirkt. Die Luftbewegungen kommen durch den Wechsel von<br />
Brustraumerweiterung und Brustraumverengung zustande. Für die Erweiterung sind zwei<br />
Faktoren maßgebend: Hebung der Rippenbögen (durch Inspirationsmuskeln) und Abflachung<br />
des muskulösen Zwerchfells. Die Ausatmung erfolgt durch Erschlaffung der genannten<br />
Muskulatur und durch die elastischen Kräfte der Lunge.<br />
Intrapleuraler Druck: Die Lungenoberfläche, die der inneren Thoraxwand überall dicht anliegt, folgt<br />
den Atmungsbewegungen, obwohl zwischen beiden keine feste Verbindung besteht. Dies ist<br />
dadurch möglich, daß der kapilläre Spalt zwischen Pleura visceralis (Lungenfell) und Pleura<br />
parietalis (Rippenfell) mit Flüssigkeit gefüllt ist, die nicht ausgedehnt werden kann. Da die<br />
Lunge das Bestreben hat, ihre Oberfläche zu verkleinern, besteht eine Druckdifferenz zwischen<br />
Interpleuralspalt und Außenluft (= intrapleuraler Druck), -4 cm H 2 O bei Exspiration und -7 cm<br />
H 2 O bei Inspiration.<br />
Ventilation: Lungenbelüftung, abhängig von der Tiefe des einzelnen Atemzugs (Atemzugvolumen)<br />
und von der Zahl der Atemzüge in der Zeiteinheit (Atmungsfrequenz).<br />
Lungenvolumina: Zusammengesetzte Volumina = Kapazitäten.<br />
(1) Atemzugvolumen: Normales In- bzw. Exspirationsvolumen.<br />
(2) Inspiratorisches Reservevolumen: Volumen, das nach normaler Inspiration noch zusätzlich<br />
eingeatmet werden kann.<br />
(3) Exspiratorisches Reservevolumen: Volumen, das nach normaler Exspiration noch zusätzlich<br />
ausgeatmet werden kann.<br />
(4) Residualvolumen: Volumen, das nach maximaler Exspiration noch in der Lunge<br />
zurückbleibt.<br />
(5) Vitalkapazität: Volumen, das nach maximaler Inspiration maximal ausgeatmet werden kann,<br />
entspricht der Summe aus (1), (2) und (3) und stellt ein Maß für die Ausdehnungsfähigkeit von<br />
Lunge und Thorax dar. Abhängig von Alter, Geschlecht, Körpergröße und Trainingszustand.<br />
(6) Inspirationskapazität: Volumen, das nach normaler Exspiration maximal eingeatmet werden<br />
kann, entspricht Summe aus (1) und (2).<br />
(7) Funktionelle Residualkapazität: Volumen, das nach normaler Exspiration noch in der Lunge<br />
enthalten ist, entspricht der Summe aus (3) und (4). Hat Bedeutung als Ausgleich der in- und<br />
exspiratorischen O 2 - und CO 2 -Konzentrationen im Alveolarraum, wodurch die
Konzentrationsschwankungen der Alveolarluft verringert werden.<br />
(8) Totalkapazität: Volumen, das nach maximaler Inspiration in der Lunge enthalten ist,<br />
entspricht der Summe aus (4) und (5).<br />
Anatomischer Totraum: Volumina der zuleitenden Luftwege (Trachea, Bronchien, Bronchiolen).<br />
Aufgabe: Reinigung, Befeuchtung und Erwärmung der Luft.<br />
Funktioneller Totraum: Anatomischer Totraum + Alveolarräume, die zwar belüftet, aber nicht<br />
durchblutet sind (beim Gesunden quantitativ gering).<br />
Alveoläre Ventilation: Derjenige Teil des Atemzeitvolumens, der der Belüftung der Alveolen zugute<br />
kommt. Der restliche Anteil heißt Totraumventilation. Atemzeitvolumen = Atemzugvolumen (in<br />
Ruhe ca. 0,5 l) x Atemfrequenz (in Ruhe ca. 14 Züge/Min.). Von der Gesamtventilation in Höhe<br />
von 7 l/Min entfallen auf die alveoläre Ventilation 5 l/Min und auf die Totraumventilation 2<br />
l/Min. Totraumanteil bei jedem Atemzug konstant ca. 150 ml. Flache, rasche Atmung (z.B.<br />
Atemzugvolumen von 0,2 l und Atemfrequenz von 35 Zügen/Min) sehr ineffektiv, da fast nur<br />
Totraumventilation. Entscheidend ist die alveoläre Ventilation!<br />
Klinischer Tod: Zeitpunkt, zu dem Atmungs- und Kreislaufstillstand festgestellt werden. Nach 3 - 8<br />
Min infolge von O 2 -Mangel irreparable Schädigung der Gehirnzellen. In dieser Zeitspanne ist<br />
Wiederbelebung möglich.<br />
Wiederbelebungsmaßnahmen: Säuberung von Mund- und Rachenraum. Überstrecken des Kopfes und<br />
Anheben des Unterkiefers, um Verschluß der Atemwege durch zurückfallende Zunge zu<br />
beseitigen. Atemspende (Mund-zu-Nase): Beginn mit 5 - 10 schnellen Lufteinblasungen, später<br />
alle 5 Sekunden.<br />
Störungen der Atmungsmechanik:<br />
(1) Restriktive Funktionsstörungen: Ausdehnungsfähigkeit der Lunge eingeschränkt (z.B. durch<br />
Verwachsung der Pleurablätter nach Pleuritis).<br />
(2) Obstruktive Funktionsstörungen: Einengung der zuleitenden Atemwege (z.B. bei Asthma<br />
bronchiale). Da bei Einengung die Ausatmung ständig gegen einen erhöhten Widerstand erfolgen<br />
muß, tritt vielfach eine Überblähung der Lunge auf (Lungenemphysem).<br />
Austausch der Atemgase: Der Gasaustausch findet im Alveolarraum zwischen Alveolen und<br />
Erythrozyten statt. Atmosphärische Luft enthält 20,9 % Sauerstoff, 0,03 Vol% Kohlendioxyd<br />
und 79,1 Vol% Stickstoff; die entsprechenden Konzentrationen in der Alveolarluft sind 14 %,<br />
5,6 % und 80,4 %. Nach dem Dalton'schen Gesetz übt jedes Gas in einem Gasgemisch einen<br />
Partialdruck aus, der seinem Anteil am Gesamtvolumen entspricht. Für mittlere Luftdrücke liegt<br />
der O 2 -Partialdruck der atmosphärischen Luft bei 150 mmHg, der CO 2 -Partialdruck ist praktisch<br />
zu vernachlässigen. Die alveolären Werte betragen jedoch 100 mmHg für O 2 und 40 mmHg für<br />
CO 2 . Dabei sind die alveolären Partialdrücke vor allem von der alveolären Ventilation abhängig.<br />
Das venöse Blut in den Lungenkapillaren hat einen O 2 -Partialdruck von 40 mmHg und einen<br />
CO 2 -Partialdruck von 46 mmHg. Diese Partialdruckdifferenzen (Alveolen - Blut) stellen die<br />
treibenden Kräfte für die O 2 - und CO 2 -Diffusion dar. Das Blut, das mit einem O 2 -Partialdruck<br />
von 40 mmHg in die Kapillare eintritt, verläßt diese mit einem O 2 -Partialdruck von 100 mmHg.<br />
Ebenso erfolgt innerhalb der kurzen Diffusionskontaktzeit der Erythrozyten (ca. 0,3 sec) eine<br />
Angleichung des CO 2 -Partialdrucks an den alveolären Wert (40 mmHg).<br />
Kennzeichnung veränderter Ventilationszustände:<br />
28
(01) Normoventilation: Normale Ventilation (Partialdrücke 100 und 40 mmHg).<br />
(02) Hyperventilation: Steigerung der alveolären Ventilation über die Stoffwechselbedürfnisse<br />
(O 2 -Partialdruck > 100 mmHg, CO 2 < 40 mmHg).<br />
(03) Hypoventilation: Minderung der alveolären Ventilation unter den Wert, der den<br />
Stoffwechselbedürfnissen entspricht (O 2 < 100 mmHg, CO 2 > 40 mmHg).<br />
(04) Eupnoe: Normale Ruheatmung.<br />
(05) Hyperpnoe: Vertiefte Atmung mit oder ohne Zunahme der Atemfrequenz.<br />
(06) Tachypnoe: Zunahme der Atemfrequenz.<br />
(07) Bradypnoe: Abnahme der Atemfrequenz.<br />
(08) Apnoe: Atmungsstillstand, bedingt durch Störung der Atemzentren in der Medulla<br />
oblongata.<br />
(09) Dyspnoe: Erschwerte Atmung, verbunden mit subjektiver Atemnot.<br />
(10) Orthopnoe: Starke Dyspnoe bei Stauung des Blutes in den Lungenkapillaren bei<br />
Herzinsuffienz.<br />
(11) Asphyxie: Atmungsstillstand oder Minderatmung bei Lähmung der Atmungszentren (bei<br />
Neugeborenen).<br />
Atemgastransport im Blut: Das Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) der Erythrozyten besitzt die<br />
Fähigkeit, den Sauerstoff in den Lungenkapillaren anzulagern und in den Gewebekapillaren<br />
wieder abzugeben. Der umgekehrte Vorgang gilt für das CO 2 . Die mittlere<br />
Hämoglobinkonzentration beträgt ca. 15,5 g%, d.h. in 100 ml Blut sind 15,5 g Hämoglobin<br />
enthalten. Ein Absinken dieser Konzentration wird als Anämie bezeichnet. Die O 2 -Sättigung des<br />
Hämoglobins hängt von dem jeweils gegebenen O 2 -Partialdruck ab. Die O 2 -Bindungskurve des<br />
Hämoglobins hat einen charakteristischen S-förmigen Verlauf. Der flache Verlauf der Kurve im<br />
Endteil verhindert bei sinkendem arteriellen O 2 -Partialdruck einen stärkeren Abfall der O 2 -<br />
Sättigung. Für die Sauerstoffabgabe im Gewebe erweist sich dagegen der steile Verlauf im<br />
Mittelteil der O 2 -Bindungskurve als günstig.<br />
29<br />
Energiehaushalt<br />
Anabolismus: Aufbau spezifischer, körpereigener Substanzen aus den aufgenommenen Nährstoffen.<br />
Katabolismus: Abbau körpereigener Substanzen oder von aufgenommenen Nährstoffen im Rahmen<br />
des intermediären Stoffwechsels.<br />
Dimension des Energieumsatzes: Kilokalorien (kcal) pro Zeiteinheit (1 kcal = 4187 Joule).<br />
Wirkungsgrad: Verhältnis von äußerer Arbeit zu umgesetzter Energie. Beim Gesamtorganismus<br />
während Muskelarbeit ca. 25 %, der Rest ist Wärme.<br />
Umsatzgrößen der Zelle: Tätigkeitsumsatz (Energieumsatz der aktiven Zelle), Bereitschaftsumsatz<br />
(Energieumsatz, den eine Zelle zur Aufrechterhaltung ihrer sofortigen, uneingeschränkten<br />
Funktionsbereitschaft benötigt), Erhaltungsumsatz (minimaler Energieumsatz, der für die<br />
Erhaltung der Zellstruktur unbedingt notwendig ist). Bei Störungen der Energiezufuhr wird die
Zelle nicht sofort geschädigt, da sie über Energiereserven verfügt (Schädigung von Gehirnzellen<br />
nach 3 - 8 Min, von Muskelzellen nach 1 - 2 Std.).<br />
Grundumsatz: Energieumsatz, der unter folgenden Bedingungen gemessen wird: Morgens, in Ruhe<br />
(liegend), nüchtern, bei Indifferenztemperatur. Grundumsatz abhängig von Alter, Geschlecht,<br />
Körperlänge und Körpergewicht. In der Regel kann er beim Erwachsenen grob mit 1 kcal/kg x h<br />
= 1700 kcal/Tag (bei 70 kg) angesetzt werden.<br />
Arbeitsumsatz: Der Freizeitumsatz (Energiebedarf eines nicht körperlich arbeitenden Menschen)<br />
beträgt für Männer 2300 kcal/Tag (Schreibtischarbeiter). Bei körperlicher Arbeit kommen<br />
Leistungszuschläge hinzu: Leichte Arbeit 500, mäßige 1.000, mittelschwere 1.500, schwere<br />
Arbeit 2000 und Schwerstarbeit 2.500 kcal. Bei geistiger Arbeit beobachtet man eine leichte<br />
Zunahme des Energieumsatzes, woran aber nicht das Gehirn beteiligt ist (dies ist ständig aktiv,<br />
auch im Schlaf), sondern die reflektorisch bedingte Zunahme des Muskeltonus.<br />
Indirekte Calorimetrie zur Bestimmung des Energieumsatzes: Dabei wird die vom Organismus<br />
aufgenommene Sauerstoffmenge gemessen. Für die Glukose-Verbrennung gilt: C 6 H 12 O 6 + 6<br />
O 2 ---> 6 CO 2 + 6 H 2 O + 675 kcal. Pro Mol Glukose (Mol = Molekulargewicht in Gramm, bei<br />
der Glukose 180 g) werden also 675 kcal frei, umgerechnet auf 1 g Glukose also 3,75 kcal =<br />
Brennwert der Glukose. Zur Verbrennung von 1 Mol Glukose werden 6 Mol O 2 mit einem<br />
Volumen von 6 x 22,4 l = 134,4 l benötigt (Mol-Volumen aller Gase bei 0°C und 760 mmHg =<br />
22,4 l). Bezieht man die frei werdende Energie auf den verbrauchten Sauerstoff, entstehen 675 :<br />
134,4 l = 5,02 kcal/l Sauerstoff = kalorisches Äquivalent der Glukose.<br />
Respiratorischer Quotient (RQ): Definiert als CO 2 -Abgabe/O 2 -Aufnahme. Bei Glukoseverbrennung<br />
wird genauso viel CO 2 abgegeben wie an O 2 aufgenommen wird, daher RQ = 1,0 (gilt auch für<br />
andere Kohlenhydrate). Da bei der Fettverbrennung die Fettsäuren pro Atom Kohlenstoff<br />
weniger O 2 enthalten als die Kohlenhydrate, ergibt sich ein deutlich erniedrigter RQ von 0,7. Bei<br />
alleiniger Verbrennung von Nahrungseiweißen findet man einen RQ von 0,81. Da vom RQ das<br />
kalorische Äquivalent abhängt, ist seine Messung neben der Bestimmung des aufgenommenen<br />
O 2 zur Ermittlung des Energieumsatzes wichtig.<br />
30<br />
Wärmehaushalt<br />
Homoiotherme Lebewesen: Die Körpertemperatur wird infolge hoher Wärmebildung und zusätzlicher<br />
Regelungsmechanismen auf einem Wert konstant gehalten, der erheblich über der<br />
Umgebungstemperatur liegt (z.B. Säugetiere, Mensch).<br />
Poikilotherme Lebewesen: Körpertemperatur liegt nur wenig über der Umgebungstemperatur und folgt<br />
deren Schwankungen (z.B. Fische, Reptilien).<br />
RGT-Regel (Reaktions-Geschwindigkeits-Temperatur-Regel): Auch als van't Hoff'sche Regel<br />
bezeichnet. Kennzeichnet die Zunahme des Energieumsatzes pro Zeiteinheit mit zunehmender<br />
Temperatur.
Körpertemperatur homoiothermer Lebewesen: Zwischen 36°C und 39°C unabhängig von den<br />
Unterschieden der Körpergröße. Bezogen auf die Gewichtseinheit ist dabei jedoch der<br />
Energieumsatz z.B. bei der Maus erheblich größer als der des Elefanten. Bei gegebener<br />
Temperaturdifferenz zwischen Körperinnerem und Umgebung ist der Wärmeabstrom pro<br />
Gewichtseinheit um so größer, je größer das Oberflächen-Volumen-Verhältnis ist. Dieses nimmt<br />
mit zunehmender Körpergröße ab, so daß die Energieumsatzrate/Gewichtseinheit geringer<br />
werden kann.<br />
Körpertemperatur des Menschen: Die oberflächennahen Teile des Körpers haben eine niedrigere<br />
Temperatur als die zentralen. In den Extremitäten bildet sich ein Temperaturgefälle in<br />
Längsrichtung aus (z.B. relativ warmer Oberarm und kalte Hände), daneben besteht ein<br />
Temperaturgefälle senkrecht zur Oberfläche. Die durch äußere Temperaturänderungen<br />
hervorgerufenen Schwankungen der Körpertemperatur sind groß nahe der Körperoberfläche<br />
(Körperschale) und gering im Körperinneren (Körperkern). Repräsentative Meßstellen für die<br />
Körperkerntemperatur: Rektum (normal ca. 37°C), Mundhöhle unter der Zunge (ca. 0,2 - 0,5°C<br />
tiefer als Rektaltemperatur), Axillartemperatur (Größenordnung wie bei Oraltemperatur). Eine<br />
absolut feste Körperkerntemperatur gibt es nicht, da diese tagesrhythmischen Schwankungen (ca.<br />
1°C) unterliegt. Bei körperlicher Arbeit kann Kerntemperatur bis zu 2°C ansteigen.<br />
Wärmebildung: Thermoregulatorische Wärmebildung wird ausgelöst, sobald die<br />
Umgebungstemperatur die untere Grenze der thermischen Indifferenzzone (= 28°C - 32°C)<br />
unterschreitet. Mechanismen: (1) aktive Betätigung des Bewegungsapparates, (2) unwillkürliche<br />
tonische oder rhythmische Muskelaktivität (Kältezittern), (3) Steigerung von<br />
Stoffwechselvorgängen (zitterfreie Wärmebildung).<br />
Wärmeabstrom: Wärmetransport vom Körperinneren zur Körperoberfläche (= innerer Wärmestrom)<br />
wird durch Veränderung der peripheren Durchblutung geregelt. Der äußere Wärmestrom (=<br />
Wärmetransport von der Körperoberfläche zur Umgebung) läßt sich in folgende Teilströme<br />
aufgliedern: (1) Wärmeabstrom durch Leitung = Konduktion (z.B. Sitzen auf kalten Steinen), (2)<br />
Wärmeabstrom durch Konvektion (Wärmebewegung durch Luftmassentransport), (3)<br />
Wärmeabstrom durch Strahlung (abhängig vom Temperaturgefälle zwischen Haut und<br />
Umgebung), (4) Wärmeabstrom durch Evaporation = Verdunstung (Schwitzen ist wichtigster<br />
Mechanismus. Bei Verdunstung von 1 l Schweiß werden dem Körper 580 kcal entzogen).<br />
Steuerung der Wärmebildung und Wärmeabgabe: Im wesentlichen auf nervalem Wege: (1)<br />
motorisches Nervensystem (Kältezittern zur Wärmebildung), (2) sympathisches Nervensystem<br />
(Steuerung der Durchblutung und damit des inneren Wärmestroms über noradrenerge<br />
sympathische Nerven), (3) sympathische Innervation der Schweißdrüsen (Steuerung des äußeren<br />
Wärmestroms durch cholinerge (Ausnahme!) sympathische Nervenfasern).<br />
Fieber: Zentrale Sollwertverstellung der Körpertemperatur (Hypothalamus), wodurch die Temperatur<br />
auf ein erhöhtes Niveau eingeregelt wird. Fieberanstieg durch Steigerung der Wärmebildung<br />
(Schüttelfrost) und Drosselung der Wärmeabgabe (Vasokonstriktion der peripheren Gefäße).<br />
Fieberabfall durch Schweißsekretion und Vasodilatation (Erhöhung des äußeren und inneren<br />
Wärmeabstroms). Fieber wird durch Pyrogene (z.B. Stoffe von Bakterienmembranen)<br />
hervorgerufen, die ihrerseits die Leukozyten zur Produktion eines fiebererzeugenden Stoffes<br />
(Leukozyten-Pyrogen) anregen.<br />
31
Hyperthermie: Wärmestauung durch Überlastung der Kapazität der Wärmeabgabemechanismen.<br />
Temperaturen über 42°C werden nicht überlebt. Dabei kommt es zu Schädigungen des Gehirns<br />
mit Desorientiertheit und Krämpfen (umgangssprachlich mit Sonnenstich oder Hitzschlag<br />
bezeichnet, zu unterscheiden vom Hitzekollaps, der durch extreme Vasodilatation mit<br />
Blutdruckabfall gekennzeichnet ist und eine Kreislaufstörung darstellt).<br />
Hypothermie: Abnahme der Kerntemperatur durch Überlastung der Kälteabwehrvorgänge. Bei 26°C -<br />
28°C kann der Tod durch Herzflimmern eintreten.<br />
32<br />
Ernährung<br />
Bestandteile der Nahrungsmittel: Nährstoffe, Vitamine, Salze, Spurenelemente, Gewürzstoffe,<br />
Ballaststoffe und Wasser.<br />
Nährstoffe: Energiereiche Stoffgruppen der Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Sie werden im<br />
Stoffwechsel des Organismus zu energieärmeren Substanzen abgebaut und dienen somit als<br />
Energiespender.<br />
Brennwert der Nährstoffe: Eiweiße 4,1, Kohlenhydrate 4,1 und Fette 9,3 kcal/g. Brennwert von<br />
Alkohol 7,1 kcal/g.<br />
Spezifisch-dynamische Wirkung: Steigerung des Energieumsatzes nach Nahrungsaufnahme, besonders<br />
hoch nach Eiweißzufuhr.<br />
Eiweiße: Bestehen aus Aminosäuren und dienen dem Baustoffwechsel. Essentielle Aminosäuren (kann<br />
der Körper nicht synthetisieren) müssen aufgenommen werden. Tierisches Eiweiß: Fleisch,<br />
Fisch, Milch, Eier. Pflanzliches Eiweiß: Brot und Kartoffeln.<br />
Fette: Sind Ester des Glyzerins mit verschiedenen Fettsäuren. Sie dienen dem Betriebsstoffwechsel und<br />
als Energiespeicher (Depotfett im Gewebe). Bei den Fettsäuren werden gesättigte und<br />
ungesättigte unterschieden, wobei letztere z.T. essentiell sind. Tierische Fette: Fleisch, Fisch,<br />
Milch, Eier. Pflanzliche Fette: Pflanzensamen (Nüsse) mit hohen Anteilen an ungesättigten<br />
Fettsäuren.<br />
Kohlenhydrate: Monosaccharide (Glukose, Fruktose), Disaccharide (Malzzucker = Maltose,<br />
Milchzucker = Laktose, Rohrzucker = Saccharose) und Polysaccharide (pflanzliche Stärke). Sie<br />
dienen dem Betriebsstoffwechsel und werden im Organismus als Glykogen gespeichert<br />
(Muskulatur, Leber). Kohlenhydrate fast ausschließlich pflanzlicher Herkunft: Obst, Gemüse,<br />
Kartoffeln, Getreide, etc.<br />
Vitamine: Lebenswichtige organische Substanzen, die der Organismus nicht synthetisieren kann. Sie<br />
sind häufig Bestandteile von Fermentsystemen. Sie kommen sowohl in Nahrungsmitteln<br />
pflanzlicher als auch tierischer Herkunft vor. Vitamingehalt sehr variabel, abhängig von<br />
Produktionsbedingungen, Lagerung und Zubereitung.
Salze: Dienen zusammen mit Wasser zur Aufrechterhaltung des inneren Milieus. Von besonderer<br />
Bedeutung sind die Kationen Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium sowie die Anionen<br />
Chlorid und Phosphat.<br />
Spurenelemente: Elemente, die nur in äußerst geringen Mengen in der Nahrung und im Organismus<br />
vorkommen. Drei Gruppen werden unterschieden: (1) Elemente mit bekannter physiologischer<br />
Funktion (z.B. Eisen für Hämoglobin, Jod für Schilddrüsenhormone), (2) Elemente mit toxischer<br />
Wirkung (z.B. Blei, Cadmium, Quecksilber), (3) Elemente, deren Entbehrlichkeit bewiesen ist<br />
(z.B. Aluminium, Silber).<br />
Gewürzstoffe: Verschiedene Duft- und Aromasubstanzen, die für den Geruch und Geschmack<br />
maßgeblich sind.<br />
Ballaststoffe: Unverdauliche Bestandteile der Nahrung, z.B. Zellulose (aus Zellwänden der Pflanzen).<br />
Nährstoffbedarf: Zum einen abhängig vom Kalorienbedarf, zum anderen werden Mindestmengen an<br />
Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten benötigt. Das funktionelle Eiweißminimum liegt bei 1<br />
g/kg Körpergewicht täglich (Mangel führt zu Ödemen). Mindestbedarf an Fetten beruht auf dem<br />
Bedarf an essentiellen Fettsäuren, zudem können die fettlöslichen Vitamine nur bei Anwesenheit<br />
von Fett resorbiert werden. Mindestbedarf an Kohlenhydraten durch Gehirnstoffwechsel bedingt,<br />
der fast ausschließlich auf Glukose angewiesen ist.<br />
Wasserbedarf: Mindestmenge 1750 ml/Tag (bei 70 kg): Trinkmenge 650 ml, Wasseranteil in der festen<br />
Nahrung 750 ml und 350 ml Oxydationswasser (wird bei der biologischen Verbrennung erzeugt).<br />
Wasserverluste (Dehydration) von mehr als 20 % des Körpergewichts führen zum Tod. Bei<br />
Zufuhr großer Mengen hyotoner Lösungen oder größeren Salzverlusten entsteht<br />
Wasserintoxikation (Einstrom von Wasser in den intrazellulären Raum ---> Ödeme,<br />
Kopfschmerzen, Übelkeit und Krämpfe deuten auf Hirnödem). Siehe auch Niere und<br />
Wasserhaushalt.<br />
Ausgewogene Kost: Muß 4 Kriterien erfüllen: (1) Brennwert muß dem kalorischen Bedarf entsprechen,<br />
(2) Mindestmengen an Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten müssen enthalten sein, (3)<br />
Mindestmengen an Vitaminen, Salzen und Spurenelementen müssen vorhanden sein, (4) die<br />
toxischen Grenzen (Salze, Vitamine, Spurenelemente) dürfen nicht überschritten werden.<br />
Nährstoffrelation für Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate = 1 : 1 : 4 (in Gewichtsanteilen).<br />
33<br />
Funktionen des Magen-Darm-Kanals<br />
Aufgaben des Gastrointestinaltraktes: Verdauung und Resorption. Durch die Einwirkung von Enzymen<br />
und Verdauungssäften werden die Nährstoffe hydrolytisch gespalten und in resorbierbare<br />
Bruchstücke zerlegt (Verdauung). Die Endprodukte der Verdauung werden aus dem Darmlumen<br />
durch die Darmschleimhaut hindurch in das Blut und die Lymphe aufgenommen (Resorption).<br />
Aufbau des Magen-Darm-Kanals: Glatte Muskulatur: Äußere Längsmuskelschicht, mittlere<br />
Ringmuskelschicht und Längsmuskelfasern in der Submucosa. Das Innere des Kanals ist durch
Schleimhaut (Mucosa) ausgekleidet. Zwischen den Muskelschichten liegen Ganglienzellen, die<br />
vom Vagus versorgt werden (Umschaltung von prae- auf postganglionär). Transport der Nahrung<br />
geschieht durch Peristaltik (wellenförmige Kontraktion der Ringmuskulatur). Durchmischung<br />
des Speisebreis durch Segmentationsbewegungen (Kontraktion der Ringmuskulatur an<br />
benachbarten Stellen).<br />
Bildung der Verdauungssäfte: Speicheldrüsen, Magendrüsen, Darmdrüsen, Bauchspeicheldrüse,<br />
Leberzellen. Innervation hauptsächlich durch den Parasympathikus (Vagus). Weitere<br />
Beeinflussung durch gastrointestinale Hormone, deren Freisetzung überwiegend durch<br />
Verdauungsprodukte ausgelöst wird.<br />
Mundspeichel: Gebildet in den Ohr-, Unterkiefer- und Unterzungenspeicheldrüsen. Funktion: Enthält<br />
Amylase zur Kohlenhydratspaltung, Verdünnung der Speisen. Sekretionssteigerung unmittelbar<br />
reflektorisch (Erregung von Geruchs-, Geschmacks- und Berührungsrezeptoren) und durch<br />
bedingte Reflexe.<br />
Schluckreflex: Reflexzentrum in der Medulla oblongata. Auslösung durch Berührung der<br />
Gaumenbögen, des Zungengrundes oder der Rachenhinterwand. Die Speisen müssen den<br />
Atemweg kreuzen, bevor sie in den Oesophagus (Speiseröhre) gelangen. Dabei wird der Nasen-<br />
Rachen-Raum durch das Gaumensegel und die Luftröhre durch den Kehldeckel verschlossen.<br />
Magen: Funktion: Reservoir, Durchmischung des Speisebreis mit Magensaft. Die Durchmischung<br />
ergibt den Chymus. Regulation der Magenmotorik durch intramurale Ganglien (zwischen den<br />
Muskelschichten), Vagus und gastrointestinale Hormone (Gastrin = Steigerung der Motilität,<br />
Secretin = Hemmung der Motilität).<br />
Magensaft: Die Magendrüsen produzieren 2 - 3 l/Tag. Hauptzellen bilden Pepsinogen (wird durch HCl<br />
in Pepsin überführt, das Eiweiße spaltet) und Belegzellen bilden die Salzsäure (HCl). Außerdem<br />
enthält der Magensaft Mucin (Magenschleim) und den Intrinsic-Factor (Glykoproteid, das für die<br />
Resorption von Vitamin B 12 erforderlich ist; bei Fehlen des Faktors perniziöse Anämie).<br />
34<br />
Regulation der Magensaftsekretion:<br />
(1) Cephalische Sekretionsphase: Eingeleitet durch bedingte Reflexe (Versuche von Pawlow am<br />
Hund). Fortgesetzt durch reflektorische Sekretion (Erregung der Geschmacks- und<br />
Geruchsrezeptoren). Bedingte Reflexe und reflektorische Sekretion werden über den Vagus<br />
vermittelt, der Acetylcholin freisetzt, das Beleg- und Hauptzellen stimuliert. Außerdem<br />
bewirkt Acetylcholin eine Freisetzung von Gastrin aus den G-Zellen des unteren<br />
Magenabschnitts, was die Belegzellen über den Blutweg weiter stimuliert.<br />
(2) Gastrale Sekretionsphase: Durch Verdauungsprodukte werden Rezeptoren in der Schleimhaut<br />
erregt, die ihrerseits die G-Zellen zur Gastrinfreisetzung anregen.<br />
(3) Intestinale Sekretionsphase: Tritt noch nicht hinreichend saure Nahrung in das Duodenum<br />
(Zwölffingerdarm) über, so kommt es zur Freisetzung des Hormons Entero-Oxyntin im<br />
Duodenum, das die Magensaftsekretion anregt. Tritt später saurer Chymus über, so wird die<br />
Magensaftsekretion durch Secretin aus der Duodenalschleimhaut gehemmt. Emotionale<br />
Erregungen können die Magensaftsekretion beeinflussen: Hypersekretion bei Ärger und Zorn,<br />
Hyposekretion bei Angst oder Traurigkeit.
Ulkus: Geschwüre im Magen und Duodenum. Gefährlich wegen Blutungsgefahr. Bedingt durch ein<br />
Ungleichgewicht zwischen aggressiven Faktoren (HCl, Pepsin) und protektiven Faktoren<br />
(Erneuerung des Schleimhautepithels, gute Durchblutung, Schleim). Bei ca. 80 % der Patienten<br />
ist eine Infektion mit Helicobacter pylori nachweisbar, welche die protektiven Faktoren<br />
schwächt.<br />
Dünndarm: Funktion: Durchmischung des sauren Chymus mit den alkalischen Sekreten des Pankreas,<br />
der Leber und der Darmdrüsen. Hier wird der Hauptteil der Verdauung bewältigt und die<br />
Resorption durchgeführt.<br />
Pankreassaft (Bauchspeichel): Vom exokrinen Anteil des Pankreas gebildet, ca. 1,5 - 2,0 l/Tag. Der<br />
Bauchspeichel ist durch die hohe Bicarbonatkonzentration alkalisch und enthält folgende<br />
Enzyme: Trypsin und Chymotrypsin (Eiweißspaltung), Pankreaslipase (Abbau von Fetten),<br />
Pankreasamylase (Abbau von Kohlenhydraten) und Nucleasen (Abbau von Nucleinsäuren).<br />
Regulation der Pankreassekretion: Die Sekretion wird während der cephalischen Phase über den Vagus<br />
reflektorisch eingeleitet. Der Hauptteil der Sekretion erfolgt nach dem Übertritt von Chymus in<br />
das Duodenum durch die Freisetzung der gastrointestinalen Hormone Secretin und<br />
Cholecystokinin die in der Schleimhaut des Duodenums gebildet werden und auf dem Blutwege<br />
das Pankreas erreichen. Secretin bewirkt ein großes Saftvolumen mit viel Bicarbonat und wenig<br />
Enzymen. Cholecystokinin löst Sekretion eines stark enzymhaltigen Saftes aus und bewirkt<br />
außerdem eine Entleerung der Gallenblase.<br />
Leber: Wichtigstes Stoffwechselorgan des Organismus. Bildet außerdem in den Leberzellen die Galle,<br />
die in die Gallenkapillaren sezerniert wird. Die Gallenkapillaren vereinigen sich über immer<br />
größer werdende Gänge zum Ductus hepaticus. Von diesem fließt die Galle entweder über den<br />
Ductus cysticus in die Gallenblase (Konzentration und Speicherung der Galle) oder unmittelbar<br />
in den Ductus choledochus, der in das Duodenum mündet. Die Galle wird kontinuierlich erzeugt<br />
(0,5 - 1,0 l/Tag) und enthält Gallensäuren (Verdauung von Fetten) und Gallenfarbstoffe<br />
(Abbauprodukte des Hämoglobin).<br />
Dickdarm (Colon): Der vom Dünndarm in das Colon weitergegebene Inhalt wird hier durch die<br />
Resorption von Wasser eingeengt. Im Colon befinden sich Bakterien (Darmflora). Weiterhin<br />
werden hier Elektrolyte und Vitamine resorbiert. Die Farbe des Stuhles wird durch abgebaute<br />
Gallenfarbstoffe bestimmt.<br />
Mastdarm (Rectum): Füllung des Rectums führt zur Stuhlentleerung. Stuhldrang wird durch die<br />
Erregung von Dehnungsrezeptoren vermittelt, deren Impulse in das Reflexzentrum im<br />
Sacralmark weitergeleitet werden. Das Reflexzentrum steht etwa ab dem 2. Lebensjahr unter der<br />
Kontrolle des Großhirns. Die efferenten Impulse gelangen über den Parasympathikus zum<br />
inneren glatten Schließmuskel und vermindern dessen Tonus. Bei der Darmentleerung wird dann<br />
auch der äußere quergestreifte Schließmuskel willkürlich entspannt und die Bauchmuskulatur zur<br />
Unterstützung des Stuhlgangs kontrahiert (Bauchpresse).<br />
Verdauung: Spaltung der Nahrungsbestandteile durch Enzyme der Verdauungssäfte. Dabei entstehen<br />
aus den Eiweißen Aminosäuren, aus den Kohlenhydraten Monosaccharide und aus den Fetten<br />
Glyzerin und Fettsäuren.<br />
Resorption: Bei der Resorption werden Substanzen aus dem Darmlumen in das Körperinnere<br />
(Darmepithelzelle, Interstitium, Lymphe und Blut) aufgenommen. Dabei spielen neben passiven<br />
35
Prozessen (Diffusion, Osmose) vor allem auch aktive, energieverbrauchende Transportvorgänge<br />
eine Rolle. Dabei scheinen in der äußeren Zellmembran der Enterozyten lokalisierte<br />
Trägersysteme (Carrier) eine Rolle zu spielen, indem Carrier-Substratkomplexe gebildet werden<br />
und auf der Gegenseite der Membran die Komplexe wieder gelöst werden. Eine andere Form des<br />
aktiven Transports ist die Pinozytose (Bläschentransport). Neben diesem aktiven transzellulären<br />
Transport spielt der passive, parazelluläre Transport eine noch größere Rolle. Dieser verläuft<br />
durch die Tight junctions (Kittleisten) benachbarter Enterozyten. Der Abtransport der<br />
resorbierten Substanzen erfolgt über Blut- und Lymphgefäße.<br />
36<br />
Nierenfunktion<br />
Aufgabe der Nieren: Ausscheidungsorgan für die Endprodukte des Zellstoffwechsels (Harnstoff,<br />
Harnsäure, Kreatinin = alles harnpflichtige Substanzen), aufgenommene Fremdstoffe (z.B.<br />
Medikamente) und physiologische Bedarfsstoffe, sofern diese im Überschuß vorhanden sind. Die<br />
Nieren bewirken eine Konstanz der ionalen Zusammensetzung, der osmotischen Konzentration<br />
und des pH-Wertes der extrazellulären Flüssigkeit. Durch die Bildung von Renin sind die Nieren<br />
an der Kontrolle des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens und des arteriellen Blutdrucks<br />
beteiligt.<br />
Nierenanatomie: Morphologische und funktionelle Einheit der Nieren ist das Nephron (ca. 1,2<br />
Million/Niere). Es besteht aus dem Glomerulus (Nierenkörperchen) und dem Tubulus<br />
(Nierenkanälchen). Mehrere Tubuli münden in ein Sammelrohr ein. Der Glomerulus wird aus<br />
Kapillarschlingen sowie aus der Bowman'schen Kapsel des Tubulusepithels gebildet. Den<br />
Tubulus unterteilt man in den proximalen Tubulus, die Henle'sche Schleife und den distalen<br />
Tubulus. Letzterer berührt die zuführende Arteriole seines zugehörigen Glomerulus und bildet<br />
mit ihr den juxtaglomerulären Apparat (Ort der Reninbildung).<br />
Elementarprozesse der Harnbildung: Sie beginnt im Glomerulus, wo der Primärharn durch den<br />
glomerulären Filtrationsprozeß aus dem durchfließenden Blutplasma abgetrennt und in den<br />
Tubulus geleitet wird. Während der Passage durch den Tubulus und das Sammelrohr wird die<br />
Zusammensetzung durch transtubuläre Stofftransporte (Resorption und Sekretion) erheblich<br />
verändert. Zur Ausscheidung im Endharn (= Urin) gelangen Stoffe, die glomerulär filtriert und<br />
die tubulär sezerniert werden, vermindert um die Mengen, die tubulär resorbiert werden.<br />
Mechanismen der Harnbildung: Die glomeruläre Filtration beruht auf physikalischen Kräften<br />
(Filtrationsdruck) und den physikalischen Eigenschaften der Moleküle (vor allem<br />
Molekülgröße). Tubuläre Stofftransporte umfassen neben passiven Transportvorgängen<br />
(Diffusion) vor allem aktive Transportvorgänge, die Energie aus dem Stoffwechsel erfordern<br />
(aktive Resorptionsmechanismen für physiologische Bedarfsstoffe wie Natriumionen, Glukose,<br />
Aminosäuren etc.; aktiv sezernierte Stoffe, z.B. PAH).<br />
Renale Clearance eines Stoffes: Der Clearance-Wert gibt den Teil des renalen Plasmaflusses an, der<br />
pro Minute von dem betreffenden Stoff völlig befreit wird. Die Clearance stellt somit eine
Volumen-Klärrate (ml/min) dar. Zu ihrer Bestimmung benötigt man die Ausscheidungsrate des<br />
Stoffes in den Harn (Produkt aus Stoffkonzentration im Urin und dem Harnzeitvolumen) und<br />
seine Konzentration im arteriellen Plasma. Somit ist die Clearance der Ausscheidungsrate<br />
proportional und der Plasmakonzentration umgekehrt proportional.<br />
Der Nierenplasmafluß stimmt mit der PAH-Clearance (PAH = p-Aminohippursäure) weitgehend<br />
überein. Dieser Stoff wird also während einer einzigen Nierenpassage fast vollständig aus dem<br />
Plasma eliminiert. Der glomerulären Filtrationsrate entspricht die Inulin-Clearance (ein<br />
Polysaccharid). Inulin wird nur durch Filtration ausgeschieden und tubulär weder resorbiert noch<br />
sezerniert. Diese Clearance-Werte dienen zur Beurteilung der Nierenfunktion.<br />
Nierenkreislauf: Die Durchblutung beider Nieren beträgt etwa 25 % des Herzzeitvolumens in Ruhe.<br />
Die Nierendurchblutung kann mit Hilfe der PAH-Clearance (Nierenplasmafluß) und dem<br />
Hämatokritwert errechnet werden. An den allgemeinen Kreislaufregulationen nimmt der<br />
Nierenkreislauf kaum Teil. Der mittlere arterielle Blutdruck kann zwischen 80 und 180 mmHg<br />
schwanken, ohne daß sich die Nierendurchblutung ändert (Autoregulation durch abgestufte<br />
Einstellung des Strömungswiderstandes, dadurch konstante glomeruläre Filtrationsrate).<br />
Glomerulärer Filtrationsprozeß: Das glomeruläre Filter wird von 20 - 40 Kapillarschlingen und dem sie<br />
umkleidenden inneren Blatt der Bowman'schen Kapsel gebildet. Diese Glomerulusmembran<br />
besteht aus dem Endothel der Kapillaren, der Basalmembran und dem inneren Blatt. Die<br />
Moleküldurchlässigkeit wird im wesentlichen von dem inneren Blatt der Bowman'schen Kapsel,<br />
die sog. Filtrationsschlitze aufweist, bestimmt. Unter der glomerulären Filtrationsrate versteht<br />
man das pro Zeiteinheit von den Nieren gebildete Filtratvolumen (Primärharn). Sie beträgt ca.<br />
120 ml/min und kann mit der Inulin-Clearance bestimmt werden. Das Filtrat enthält die im<br />
Blutplasma gelösten Bestandteile nach Maßgabe ihrer Filtrierbarkeit.<br />
Tubuläre Transportprozesse: Die Transporte einzelner Stoffe im Tubulus sind auf bestimmte<br />
Abschnitte begrenzt. Im proximalen Tubulus werden Glukose, Aminosäuren, filtriertes Protein,<br />
Sulfat- und Phosphationen, Elektrolyte und Wasser resorbiert, sowie organische Säuren (z.B.<br />
PAH) sezerniert. Alle Stofftransporte zeichnen sich durch ein tubuläres Transportmaximum aus,<br />
d.h., daß von diesen Stoffen in der Zeiteinheit jeweils nur eine definierte Maximalmenge von den<br />
Nieren resorbiert oder sezerniert werden kann. Im distalen Tubulus werden lediglich Elektrolyte<br />
und Wasser resorbiert sowie Ammoniak und Wasserstoffionen sezerniert.<br />
Aldosteron (Mineralocorticoid der Nebennierenrinde) erhöht die tubuläre Natrium-Resorption<br />
sowie die Kalium- und Wasserstoffionen-Sekretion. Das ADH (antidiuretisches Hormon syn.<br />
Adiuretin, im Hypothalamus gebildet und im Hypophysenhinterlappen freigesetzt) erhöht die<br />
Wasserdurchlässigkeit im distalen Tubulus und im Sammelrohr. Dadurch wird der Urinfluß<br />
vermindert (Antidiurese) und der Urin hypertonisch. Fehlt ADH (z.B. beim Diabetes insipidus),<br />
so ist die Diurese gesteigert, wobei ca. 25 l/Tag hypotonischen Urins ausgeschieden werden<br />
können.<br />
Resorption der Glukose: Das tubuläre Transportmaximum läßt sich anhand des Glukosetransportes<br />
erläutern. Obwohl Glukose glomerulär uneingeschränkt filtriert wird, ist normalerweise der Urin<br />
glukosefrei. Demnach wird Glukose tubulär vollständig resorbiert. Glukose erscheint erst im<br />
Harn (Glukosurie), wenn im Plasma die Schwellenkonzentration von etwa 180 mg/100 ml<br />
überschritten wird (bei Zuckerkrankheit = Diabetes mellitus).<br />
37
Regulation der extrazellulären Flüssigkeit durch die Nieren:<br />
(1) Osmotische Konzentration: Wasserverlust = Anstieg der osmotischen Konzentration ---><br />
Registrierung durch Osmorezeptoren im Hypothalamus ---> ADH-Freisetzung und Durstgefühl -<br />
--> Antidiurese und Trinken. Wasserüberschuß = Abfall der osmotischen Konzentration z.B.<br />
durch starkes Trinken ---> Osmorezeptoren ---> Hemmung der ADH-Freisetzung ---><br />
Wasserdiurese.<br />
(2) Volumenregulation: Extrazelluläre Flüssigkeit besteht aus interstitieller Flüssigkeit und<br />
Blutplasma. Änderungen ihres Volumen führen deshalb auch zu Veränderungen des<br />
Blutvolumens und damit zur Umstellung der Kreislaufregulation. Bei vermehrtem Blutvolumen<br />
(Hypervolämie) gibt es zwei Mechanismen zur Volumenregulation:<br />
(a) Vermehrtes Blutangebot ---> Erhöhung des Herzzeitvolumens ---> Anstieg des arteriellen<br />
Blutdrucks ---> Druckdiurese (vermehrte Urinausscheidung durch blutdruckbedingte Zunahme<br />
der Nierenmarkdurchblutung mit Beeinträchtigung des Urinkonzentrierungsmechanismus).<br />
(b) Vermehrtes Blutangebot ---> Volumenrezeptoren im venösen System<br />
---> Meldung auf nervalem Wege zum Hypothalamus ---> Hemmung der ADH-Freisetzung ---><br />
Wasserdiurese.<br />
Bei vermindertem Blutvolumen (Hypovolämie) gibt es - abgesehen von den<br />
kreislaufregulatorischen Effekten auf Herz, Gefäße und Nebennierenmark - ebenfalls zwei<br />
Mechanismen der Volumenregulation:<br />
(a) Vermindertes Blutangebot ---> Erniedrigung des Herzzeitvolumens<br />
---> Abfall des arteriellen Blutdrucks ---> Aktivierung des juxtaglomerulären Apparates<br />
(druckempfindlicher Mechanismus) ---> Reninfreisetzung (eiweißspaltendes Enzym) --><br />
Umwandlung von Angiotensinogen in Angiotensin (starke vasokonstriktorische Substanz) ---><br />
Anstieg des arteriellen Blutdrucks. Gleichzeitig durch Angiotensin bedingt ---> Freisetzung von<br />
Aldosteron ---> erhöhte Natrium- und damit Wasserresorption ---> positive Flüssigkeitsbilanz (=<br />
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus).<br />
(b) Vermindertes Blutangebot ---> Volumenrezeptoren im venösen System ---> Meldung auf<br />
nervalem Wege zum Hypothalamus ---> ADH-Freisetzung und Durst ---> Antidiurese und<br />
Trinken (sog. Gauer-Henry-Reflex).<br />
Niereninsuffizienz: Entsteht durch Schädigung von mehr als 60 % der Nephrone. Dabei können die<br />
harnpflichtigen Substanzen nicht mehr ausgeschieden werden (Urämie). Harnkonzentrierung und<br />
-verdünnung ist nicht mehr möglich. Ursachen der Niereninsuffizienz: Akutes Nierenversagen<br />
durch Schockzustände (Minderung der Nierendurchblutung), Vergiftungen,<br />
Transfusionszwischenfälle, etc.; chronisches Nierenversagen durch Nierenentzündungen.<br />
Wasserhaushalt: Unter normalen Bedingungen besteht ein Gleichgewicht zwischen Aufnahme und<br />
Abgabe. Wasseraufnahme: 1,2 l Trinkmenge + 0,85 l Wasser aus fester Nahrung + 0,35 l<br />
Oxydationswasser = 2,4 l/Tag. Wasserabgabe: 1,4 l Urin + 0,1 l Ausscheidung mit dem Stuhl +<br />
0,9 l durch Verdunstung über Atemluft und Haut (Perspiratio insensibilis) = 2,4 l/Tag.<br />
38
Allgemeine Endokrinologie<br />
39<br />
Endokrines System: Eng mit dem Nervensystem verknüpft. Erfüllt seine Funktion mittels Hormonen,<br />
die in den endokrinen Drüsen (= Drüsen ohne Ausführungsgang) gebildet und auf dem Blutweg<br />
zu den Organen transportiert werden. Hier entfalten die Hormone spezifische Wirkungen<br />
(Wirkungen, die von keinem anderen Stoff hervorgerufen werden können) an den<br />
Erfolgsorganen.<br />
Funktionelle Bedeutung der Hormone:<br />
(1) Förderung der körperlichen und geistigen Entwicklung.<br />
(2) Leistungsanpassung des Organismus (physiologische Adaptation bei erhöhter Belastung).<br />
(3) Homöostatische Funktion (Konstanthaltung bestimmter physiologischer Größen, z.B.<br />
osmotischer Druck).<br />
Hormone steuern biochemische Prozesse und wirken in sehr kleinen Konzentrationen. Als<br />
Glieder von Regelkreisen nehmen sie entweder die Position eines Stellgliedes oder die Position<br />
der Regelgröße ein:<br />
(1) Hormone als Stellglieder (z.B. osmotischer Druck des Blutes): Regelgröße ist der osmotische<br />
Druck, der konstant gehalten werden muß. Kommt es durch Störgrößen (z.B. Wasseraufnahme)<br />
zu Abweichungen, so werden diese durch Osmorezeptoren des Hypothalamus (Meßwerk) an den<br />
zentralen Regler, der den Sollwert überwacht (ebenfalls Hypothalamus) weitergeleitet. Der<br />
Regler setzt nun proportional zur Abweichung vom Sollwert das Hormon Adiuretin frei, das<br />
seinerseits als Stellgröße auf das Stellglied (Niere) einwirkt.<br />
(2) Hormone als Regelgrößen (z.B. Thyroxin): Regelgröße ist der Thyroxinspiegel, der konstant<br />
gehalten werden muß. Vermehrter Thyroxinverbrauch unter Belastung (Störgröße) ---><br />
Thyroxinrezeptoren in der Adenohypophyse (Meßwerk) ---> Regler in Hypophyse bzw.<br />
Hypothalamus ---> Ausschüttung von TSH (Stellgröße) ---> vermehrte Thyroxinproduktion in<br />
der Schilddrüse (Stellglied).<br />
Gruppierung der Hormone nach der Funktionsweise:<br />
(1) Effectorische Hormone: Wirken unmittelbar auf Erfolgsorgane ein, z.B. Sexualhormone.<br />
(2) Trope oder glandotrope Hormone: Bewirken Bildung und Freisetzung der unter (1)<br />
zusammengefaßten Hormone, z.B. TSH (Thyreotropes Hormon).<br />
(3) Releasing- und Release-inhibiting Hormone: Werden von den Nervenzellen des<br />
Hypothalamus gebildet und steuern die Bildung und Freisetzung der Hormone der<br />
Adenohypophyse. Über diese Hormone erfolgt die Ankopplung des endokrinen Systems an das<br />
ZNS.<br />
Gruppierung der Hormone nach Rezeptortypen: Die Zellen der Erfolgsorgane besitzen spezifische<br />
Rezeptoren, die mit dem entsprechenden Hormon einen Hormonrezeptorkomplex bilden.<br />
(1) Zytoplasmatische Rezeptoren im Zellinnern für Hormone aus der Lipidgruppe.<br />
(2) Rezeptoren an der Zellmembran für Hormone aus der Protein- und Peptidgruppe.<br />
(3) Rezeptoren im Zellkern für die Schilddrüsenhormone.<br />
Wirkungsmechanismen der Hormone: Da die Hormonrezeptorkomplexe entweder an der Zellmembran<br />
oder in der Zelle entstehen, lassen sich zwei Wirkmechanismen unterscheiden. Der intrazelluläre<br />
Komplex kann direkt die Expression genetischer Information beeinflussen und somit auf die<br />
Syntheseleistung der Zelle (z.B. Proteinsynthese) direkten Einfluß nehmen. Bei einem
zellmembranständigen Komplex ist dagegen ein zweiter intrazellulärer Botenstoff (second<br />
messenger, z.B. cAMP = cyclisches Adenosinmonophosphat) notwendig, um die Aktivität der<br />
Zelle zu beeinflussen.<br />
Untersuchungsmethoden:<br />
(1) Studium der Ausfallserscheinungen nach Zerstörung eines Organs, in dem man eine<br />
Hormonbildung vermutet.<br />
(2) Substitutionsexperiment: Zufuhr von Extrakten, die aus dem zerstörten Organ gewonnen<br />
wurden. Ausfallserscheinungen müssen - sofern es sich wirklich um ein Hormon handelt -<br />
danach verschwinden.<br />
(3) Überdosierungsexperiment: Zufuhr von Hormonen beim intakten Tier. Wichtig für die<br />
Analyse von Funktionsstörungen bei krankhafter Überfunktion einzelner Hormondrüsen.<br />
Substitutionstherapie: Im Falle einer unzureichenden Funktion einer endokrinen Drüse müssen die<br />
Hormone von außen zugeführt werden. Bei Proteohormonen (Eiweißhormonen) muß die Zufuhr<br />
parenteral (also nicht über den Magen-Darm-Trakt) erfolgen, da diese bei peroraler Zufuhr (über<br />
den Magen-Darm-Trakt) abgebaut würden (z.B. intravenös, intramuskulär). Da zahlreiche<br />
Hormone nicht artspezifisch sind, können Extrakte aus den Drüsen von Tieren verwendet<br />
werden.<br />
40<br />
Hypothalamisch-hypophysäres System<br />
Gliederung des Systems:<br />
(1) Nuclei supraopticus und paraventricularis des Hypothalamus und Neurohypophyse<br />
(Hypophysenhinterlappen = HHL).<br />
(2) Hypophysiotrope Zone des Hypothalamus und Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen =<br />
HVL).<br />
Neurohypophyse und zugeordnete Hypothalamuskerne: Die Hormone Adiuretin (syn. Vasopressin)<br />
und Oxytocin werden in den Nervenzellen des Nucleus supraopticus und des Nucleus<br />
paraventricularis gebildet. Diese Hormone werden in Form von Granula innerhalb der<br />
zugehörigen Neuriten der Nervenzellen zu den Kapillaren des HHL geleitet und in die Kapillaren<br />
abgegeben. Die Neuriten der neurosekretorischen Zellen bilden den Tractus hypothalamohypophyseus,<br />
der einen Teil des Hypophysenstiels darstellt. Zur Freisetzung der Hormone<br />
kommt es durch Erregung der neurosekretorischen Zellen.<br />
Adiuretin (syn. Vasopressin): Hemmt die Diurese (siehe Niere). Bei Ausfall des Hormons Diabetes<br />
insipidus. Dabei können Urinmengen zwischen 5 und 15 l/24 Std. ausgeschieden werden<br />
(insipidus = nicht süß schmeckend, im Gegensatz zu mellitus = süß schmeckend). In höheren<br />
Konzentrationen hat Adiuretin einen butdrucksteigernden Effekt, der ursprünglich einem eigenen<br />
Hormon (Vasopressin)<br />
zugeschrieben wurde. Natürlicher Reiz für die Adiuretinsekretion ist die Erregung von<br />
Osmorezeptoren im Hypothalamus bei Ansteigen des osmotischen Drucks.
Oxytocin: Bewirkt bei Tier und Mensch rhythmische Kontraktionen des Uterus. Gegen Ende der<br />
Schwangerschaft wird die Muskulatur des Uterus durch die Wirkung von Östrogen besonders<br />
sensibel für Oxytocin. Da der HHL nun vermehrt Oxytocin ausschüttet, kommt es zu<br />
Kontraktionen, die den Fetus in Richtung Scheide drücken. Die zunehmende Dehnung der<br />
Gewebe führt zur nervalen Rückmeldung an den Hypothalamus und damit zur weiteren<br />
Oxytocin-Produktion, wobei sich der Prozeß zur Wehentätigkeit aufschaukelt. Ferner bewirkt<br />
das Hormon eine Kontraktion der Milchgänge der Brustdrüse (Milchejektionsreflex). Natürlicher<br />
Reiz für die Sekretion ist der Saugreiz an der Brustwarze. Von dieser gehen mechanosensible<br />
afferente Bahnen zum Hypothalamus, wo die Verbindung zu den neurosekretorischen Zellen, die<br />
das Oxytocin bilden, hergestellt wird (nerval-hormonaler Reflexbogen).<br />
Adenohypophyse und hypophysiotrope Zone des Hypothalamus: Von Nervenzellen im Bereich der<br />
hypophysiotropen Zone werden die Releasing-Hormone gebildet, die ihrerseits die Sekretion der<br />
Adenohypophysen-Hormone steuern. Die Releasing-Hormone gelangen über das<br />
Pfortadersystem der Hypophyse (auf dem Blutweg) zu den Hormonbildungszellen der<br />
Adenohypophyse.<br />
Einteilung der Releasing-Hormone:<br />
Stimulierende Releasing-Hormone (RH):<br />
(1) TRH = Thyreotropin-RH ---> TSH<br />
(2) LHRH = Luteinisierendes Hormon-RH ---> LH und FSH<br />
(3) CRH = Corticotropin-RH ---> ACTH<br />
(4) GHRH = Growth Hormone-RH ---> GH (syn. STH)<br />
(5) PRH = Prolactin-RH ---> PRL<br />
(6) MSHRH = Melanocytes Stimulating Hormone-RH ---> MSH<br />
Inhibitorische Releasing-Hormone (IH):<br />
(1) GHIH = Growth Hormone-IH (Somatostatin) ---> GH (syn. STH)<br />
(2) MSHIH = Melanocytes Stimulating Hormone-IH ---> MSH<br />
(3) PIH = Prolactin-IH ---> PRL<br />
Alle Releasing-Hormone stellen Peptide mit oft geringer Anzahl von Aminosäuren dar, deren<br />
Struktur z.T. bereits aufgeklärt ist.<br />
Endorphine und Enkephaline: Kürzlich entdeckte Gruppe von Polypeptiden aus dem Hypothalamus<br />
bzw. der Hypophyse. Haben eine dem Morphin ähnliche Wirkung. Besetzen Membranrezeptoren<br />
von Nervenzellen, über die auch die exogen zugeführten Morphine zur Wirkung kommen<br />
(„endogene Opiate“).<br />
Hormone der Adenohypophyse (Übersicht):<br />
Glandotrope Hormone:<br />
(1) FSH = Follikelstimulierendes Hormon<br />
(2) LH bzw. ICSH = Luteinisierendes Hormon, identisch mit Interstitial Cells Stimulating<br />
Hormone<br />
(3) TSH = Thyreotropin Stimulating Hormone, syn. Thyreotropes Hormon<br />
(4) ACTH = Adrenocorticotropes Hormon<br />
Effektorische Hormone:<br />
(1) GH (syn. STH) = Growth Hormone (Wachstumshormon), syn. Somatotropes Hormon<br />
(2) PRL (syn. LTH) = Prolactin, syn. luteotropes Hormon<br />
(3) MSH = Melanocytenstimulierendes Hormon<br />
41
Die glandotropen Hormone entfalten ihre Wirkung durch Beeinflussung der peripheren<br />
endokrinen Drüsen. Die Hormone (1) und (2) werden als gonadotrope Hormone bezeichnet und<br />
steuern die Entwicklung der Keimdrüsen und der sekundären Geschlechtsmerkmale. FSH und<br />
LH (bzw. ICSH) sind bei weiblichen und männlichen Individuen identisch, sie stellen also<br />
geschlechtsunspezifische Hormone dar. TSH stimuliert das Wachstum der Schilddrüse und<br />
steuert die Bildung und Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. ACTH beeinflußt das<br />
Wachstum und die Funktionsfähigkeit zweier der drei Schichten der Nebennierenrinde, der Zona<br />
fasciculata (Bildung des Cortisols) und der Zona reticularis (Bildung von androgenen<br />
Rindenhormonen = männliche Geschlechtshormone). Das Wachstum der dritten Schicht, der<br />
Zona glomerulosa (Bildung des Mineralocorticoids Aldosteron), bedarf kaum der Stimulierung<br />
durch ACTH (Aldosteron wird durch Angiotensin freigesetzt, siehe Niere). ACTH wird aus<br />
einem höhermolekularen sog. Präkursor enzymatisch abgespalten. Als weitere Spaltprodukte<br />
ergeben sich dabei ß-Endorphin (ein endogenes Opiat) und MSH (Melanocytenstimulierendes<br />
Hormon). Die Zellen, in denen der Präkursor im HVL gebildet wird, bezeichnet man als<br />
Proopiomelanocortinzellen (POMC-Zellen).<br />
Wachstumshormon (Growth Hormone = GH): Im Gegensatz zu den meisten Hormonen ist es<br />
artspezifisch. Zum therapeutischen Einsatz beim Menschen muß daher menschliches GH (aus<br />
Leichenhypophysen oder gentechnisch hergestellt) verwendet werden. Die Wachstumswirkung<br />
läßt sich auf eine Förderung der Verknöcherung, die die Grundlage des Längenwachstums der<br />
Knochen ist, zurückführen. Die Epiphysenfugen werden durch GH verbreitert. Wenn nach<br />
Abschluß der Pubertät unter Einwirkung der Androgene eine Verknöcherung der knorpeligen<br />
Epiphysenfuge eingetreten ist, hat GH keinen Einfluß mehr auf das Längenwachstum. Die<br />
Wirkung des GH auf das Knochenwachstum erfolgt nicht direkt, sondern über die Stimulation<br />
von Leberfaktoren, den Somatomedinen.<br />
Hypophysärer Riesenwuchs: Überschüssige Produktion von GH im jugendlichen Alter, meist durch<br />
Adenom (Geschwulst) der acidophilen Zellen des HVL, in denen GH gebildet wird. Das<br />
Wachstum ist proportioniert.<br />
Hypophysärer Zwergwuchs: Fehlen des GH im Kindesalter. Körpergröße oft nur 100 cm.<br />
Körperproportionen normal, im Gegensatz zum hypothyreotischen Zwergwuchs.<br />
Akromegalie: Überproduktion von GH im Erwachsenenalter meist durch Adenom der acidophilen<br />
Zellen des HVL. Plumpe Deformierungen und Verdickungen der Knochen, insbesondere<br />
Vergrößerung der Nase, des Kinns, der Hände und Füße. Oft auch Schädigung des Sehnerven<br />
durch Tumorwachstum.<br />
Stoffwechselwirkungen des GH:<br />
(1) Mobilisierung von Fettsäuren aus den Fettgeweben zur Energiegewinnung.<br />
(2) Insulinähnlicher Effekt als kurzfristige Wirkung: Injektion von GH führt zu einer<br />
vorübergehenden Senkung des Glukosespiegels über Somatomedin C (Dauer ca. 1 Stunde).<br />
(3) Insulinantagonistischer Effekt als längerfristige Wirkung: Mehrere Stunden nach GH-<br />
Injektion Steigerung der Glukosekonzentration im Plasma durch Einschmelzen der<br />
Glykogendepots und Erschwerung der durch Insulin geförderten Einschleusung von Glukose in<br />
die Zelle. Daher bei Zwergwuchs Neigung zu Hypoglykämie, bei Riesenwuchs zu<br />
Hyperglykämie (erhöhter Blutzuckerspiegel).<br />
42
Steuerung der GH-Sekretion: Durch GHRH und GHIH (= Somatostatin), deren selektive Freisetzung<br />
vom limbischen System gesteuert wird. Die Plasmaspiegel von GH zeigen erhebliche<br />
Schwankungen, wobei auch eine endogene (circadiane) Rhythmik besteht. Ein Sekretionsgipfel<br />
tritt nachts auf und ist an die Tiefschlafphase (slow wave sleep) gebunden. Durch Senkung der<br />
Blutglukosekonzentration kommt es zu einem Anstieg der GH-Sekretion über hypothalamische<br />
Glukoserezeptoren.<br />
Prolactin: Bewirkt die Ingangsetzung und Aufrechterhaltung der Milchsynthese in der Brustdrüse der<br />
Frau.<br />
Steuerung der Prolactinsekretion: PIH (= Dopamin) bewirkt eine Inhibition der Synthese, PRH sowie<br />
Östrogen eine Förderung der Synthese von Prolactin. Reizung der Mechanorezeptoren in den<br />
Mamillen durch den Saugreiz führt nerval zur Ausschüttung von PRH im Hypothalamus. Erhöht<br />
sich der Prolactinspiegel im Blut wird vermehrt Dopamin im Hypothalamus produziert, wodurch<br />
wiederum die Prolactinsynthese vermindert wird. Dopamin wirkt gleichzeitig auch inhibitorisch<br />
an den LHRH-Zellen des Hypothalamus. Hierdurch wird die LH- und FSH-Produktion<br />
subnormal, und der Menstruationszyklus kann nicht mehr ablaufen (Lactationsamenorrhoe).<br />
Während der Stillzeit kommt es daher in der Regel nicht zu einer Konzeption.<br />
Melanocytenstimulierendes Hormon (MSH): Bewirkt Zunahme der Pigmentierung der Haut, die durch<br />
Ausbreitung des Melanins innerhalb der Pigmentzellen (Melanocyten) zustande kommt. Hat<br />
beim Menschen nur im Rahmen des Morbus Addison (Bronzehautkrankheit) Bedeutung. Dabei<br />
ist die Nebennierenrinden-Hormonproduktion durch Zerstörung der Rinde verringert und die<br />
ACTH-Produktion entsprechend erhöht. Da bei der ACTH-Produktion MSH äquimolar mit<br />
ausgeschüttet wird, erfolgt eine stärkere Pigmentierung.<br />
43<br />
Nebennierenrinde und Glucocorticoide<br />
Hormone der Nebennierenrinde (NNR): In der NNR finden sich zahlreiche Steroidderivate<br />
(Abkömmlinge des Sterans, einem Molekül aus 4 Ringen; Lipidhormone), die als<br />
Corticosteroide bzw. Corticoide bezeichnet werden. Drei Gruppen lassen sich unterscheiden:<br />
(1) Glucocorticoide (Cortisol und Corticosteron): Beeinflussen den Stoffwechsel der Proteine,<br />
Kohlenhydrate und Lipide (Fette). Werden in der Zona fasciculata gebildet.<br />
(2) Mineralocorticoide (Aldosteron): Beeinflussen den Transport von Elektrolyten und damit die<br />
Verteilung des Wassers in den Geweben. Bildungsort: Zona glomerulosa.<br />
(3) Androgene und Östrogene: Ausprägung sekundärer Geschlechtsmerkmale und Entwicklung<br />
der Keimdrüsen. Bildungsort: Zona reticularis.<br />
Wirkung der Glucocorticoide (Cortisol):<br />
(1) Gluconeogenese (= Bildung von Glukose aus Aminosäuren): Cortisol steigert die Aktivitäten<br />
einiger für die Gluconeogenese erforderlichen Enzyme. Der Blutglukosespiegel wird dadurch<br />
angehoben.
(2) Katabole Wirkung: Die Gluconeogenese bedingt einen verminderten Einbau von<br />
Aminosäuren in das Körpereiweiß.<br />
(3) Lipolyse. Bei Ausfall von Glucocorticoiden ist die Freisetzung von Fettsäuren aus dem<br />
Fettgewebe (Lipolyse) gestört.<br />
(4) Kreislauf: Glucocorticoide sensibilisieren die glatte Gefäßmuskulatur gegenüber<br />
Noradrenalin, sog. permissive Wirkung (Blutdrucksteigerung). Bei Ausfall der NNR<br />
Kreislaufkollaps.<br />
(5) Wasserhaushalt: Kennzeichnend für den Ausfall der NNR ist die gestörte<br />
Wasserausscheidung. Cortisol bewirkt Steigerung der Glomerulusdurchblutung und der<br />
Filtrationsrate als Folge der kreislaufstabilisierenden Wirkung. Weiterhin vermindert Cortisol die<br />
Wasserdurchlässigkeit im distalen Tubulus, was zur Wasserausscheidung führt.<br />
(6) Skelettmuskulatur: Schwäche der Skelettmuskulatur (Adynamie) bei Cortisolmangel;<br />
Wirkungsmechanismus noch unklar.<br />
(7) ZNS und Sinnesorgane: Mangel an Cortisol bewirkt erhöhte Krampfanfälligkeit des Gehirns<br />
(Glucocorticoidrezeptoren im Gehirn sind nachgewiesen) und Funktionsminderung von<br />
Sinnesorganen (Geschmack: Schlechte Unterscheidung von süß und salzig; Gehör:<br />
Beeinträchtigung des Verständnisses akustisch dargebotener Worte).<br />
(8) Zelluläre und humorale Abwehrvorgänge: Cortisol bewirkt Involution von Thymus und<br />
Lymphknoten mit Zerstörung der eingelagerten Lymphocyten. Dadurch Hemmung der<br />
Antikörperproduktion (immunsuppressive Wirkung). Bewirkt auch Hemmung von lokalen<br />
Entzündungen, was für die Therapie von rheumatischen Erkrankungen ausgenutzt wird.<br />
Regelung der Glucocorticoidkonzentration: Konzentration der Glucocorticoide wird im Plasma<br />
konstant gehalten. Regelgröße = Cortisolkonzentration. Abnahme der Cortisolkonzentration<br />
(Störgröße) ---> Glucocorticoidrezeptoren in der hypophysiotropen Zone des Hypothalamus<br />
(Meßwerk) ---> Regler mit Sollwert im limbischen System ---> Ausschüttung von CRH ---><br />
Freisetzung von ACTH in der Adenohypophyse (Stellgröße) ---> Freisetzung von Cortisol in der<br />
NNR (Stellglied). Die Cortisolkonzentration steigt bei zahlreichen Belastungen („Stress“) an,<br />
was als Sollwertverstellung aufzufassen ist. Diese Sollwertverstellung bewirkt die<br />
Leistungsanpassung des Organismus.<br />
Stress und Adaptation: Bei Einwirkung verschiedenster Stressoren (z.B. Kältebelastung,<br />
Hitzebelastung, Traumen) wird die Glucocorticoidsekretion gesteigert („Alarmreaktion“). Der<br />
Reizzustand des Organismus wird nach Selye als Stress bezeichnet, die auslösenden Reize als<br />
Stressoren. Bei anhaltender Einwirkung der Stressoren nimmt die Stärke der Stressreaktion mehr<br />
und mehr ab. Dies steht in Zusammenhang mit der Ausbildung morphologischer und<br />
funktioneller Modifikationen, die eine erhöhte Resistenz gegenüber dem Stressor zur Folge<br />
haben (physiologische Adaptation, Leistungsanpassung. „Stadium des Widerstandes“ nach<br />
Selye). Die Adaptation ist stressorspezifisch, d.h. die sich einstellenden Modifikationen sind<br />
verschieden, je nachdem ob das Individuum Kälte, Hitze etc. ausgesetzt worden ist. Die<br />
Alarmreaktion ist dagegen unspezifisch. Die erhöhte Glucocorticoidsekretion scheint für die<br />
Ausbildung der spezifischen Modifikationen von Bedeutung zu sein, etwa in dem Sinne, daß<br />
durch Enzyminduktion die Ausbildung bestimmter morphologischer Änderungen ermöglicht<br />
wird. Sind die Modifikationen einmal ausgebildet, so ist der ursprüngliche Stressor nicht mehr<br />
nennenswert belastend für den Organismus. Wirken die Stressoren aber sehr lange ein, geht die<br />
erworbene Anpassung wieder verloren („Stadium der Erschöpfung“).<br />
44
Morbus Cushing: Krankheitsbild, das durch eine Überproduktion von Cortisol gekennzeichnet ist.<br />
Ursachen:<br />
(1) Geschwulst der NNR (Carcinom) mit Überproduktion von Cortisol. ACTH-Konzentration<br />
durch negative Rückkoppelung reduziert, daher kontralaterale NNR atrophiert.<br />
(2) Überproduktion von ACTH durch Störung der Funktion des HVL oder Hypothalamus.<br />
Bedingt Hyperplasie beider NNR mit Steigerung der Cortisolbildung.<br />
Klinische Zeichen: Fettsucht (Mondgesicht), erhöhter Blutzuckerspiegel mit Zuckerausscheidung<br />
im Harn, vermehrter Eiweißabbau (katabole Wirkung), Hypertonie, Osteoporose (Entkalkung der<br />
Knochen).<br />
Adrenogenitales Syndrom (AGS-Syndrom): Enzymdefekt, der bewirkt, daß kaum Cortisol gebildet<br />
wird, womit die negative Rückkoppelung fehlt und im Hypothalamus vermehrt CRH gebildet<br />
wird, was eine entsprechende Stimulation der ACTH-Synthese in der Adenohypophyse<br />
hervorruft. Da ACTH auch auf die Zona reticularis wirkt, werden übermäßig Androgene<br />
produziert. Das Androgen wirkt bei Mädchen virilisierend (vermännlichend) und ruft bei Knaben<br />
vorzeitige Pubertät hervor. Therapie: Cortisolgabe.<br />
Morbus Addison: Verminderung aller Hormone der NNR infolge Tumormetastasen der NNR,<br />
Tuberkulose, Traumen. Ausfall der Mineralocorticoide beherrscht das Krankheitsbild<br />
(Elektrolytstörungen). Klinische Zeichen: Verstärkte Hautpigmentierung<br />
(„Bronzehautkrankheit“, Folge der erhöhten MSH-Sekretion im Zusammenhang mit der<br />
gesteigerten ACTH-Produktion), vorzeitige Ermüdbarkeit, Muskelschwäche, Gewichtsabnahme,<br />
Hypotonie, Hypoglykämie, Anämie.<br />
45<br />
Hormone der Schilddrüse<br />
Bildung der Hormone: Die Synthese von Thyroxin (= Tetrajodthyronin = T 4 ) und Trijodthyronin (=<br />
T 3 ) vollzieht sich in den Follikelzellen der Schilddrüse unter dem Einfluß von TSH in Bindung<br />
an ein Glykoprotein, dem Thyreoglobulin. Gebunden an Thyreoglobulin werden T 3 und T 4 in<br />
das Kolloid geleitet und dort gespeichert. Zur Abgabe der Hormone an das Blut muß die<br />
Bindung an Thyreoglobulin gelöst werden, was eine erneute Aufnahme in die Follikelzelle<br />
erforderlich macht. Im Plasma erfolgt erneut eine Bindung an Plasmaproteine. Nur ein kleiner<br />
Teil der Hormone ist ungebunden. Charakteristisch ist der Jodgehalt der Schilddrüsenhormone.<br />
Wirkung der Hormone: Beide Hormone haben im wesentlichen die gleiche Wirkung, wobei T 3 jedoch<br />
viel stärker wirkt und die eigentliche biologisch wirksame Form darstellt, wobei ein Großteil von<br />
T 3 im Blut durch Dejodierung von Thyroxin entsteht.<br />
(1) Stoffwechselwirkungen: Bei Ausfall der Hormone sinkt der Energieumsatz, bei<br />
Überproduktion können Steigerungen des Grundumsatzes auf das Doppelte erfolgen. Die<br />
Hormone steigern die Eiweißsynthese und fördern den oxydativen Abbau der Fette und<br />
Kohlenhydrate. Die Ansprechbarkeit des Organismus auf Catecholamine wird durch die<br />
Hormone erhöht. Infolge dieser Grundwirkungen findet man klinisch bei Hormonüberschuß:<br />
Tachycardie (Herzfrequenzerhöhung), Erhöhung der Körpertemperatur, Neigung zu
Schweißsekretion, zitternde Hände (Tremor), Unruhegefühl, gesteigerte körperliche und geistige<br />
Aktivität. Bei Hormonmangel sind die entgegengesetzten Wirkungen zu erwarten.<br />
(2) Wachstum und Entwicklung: T 3 und T 4 sind wichtig für die normale Verknöcherung. Bei<br />
Ausfall im jugendlichen Alter bleibt das Wachstum zurück. Da das Dickenwachstum der<br />
Knochen im Gegensatz zum Längenwachstum ungestört ist, findet man beim hypothyreotischen<br />
Zwergwuchs im Gegensatz zum hypophysären Zwergwuchs einen plumpen und gedrungenen<br />
Knochenbau. Auch die geistige Entwicklung ist bei Hormonmangel im jugendlichen Alter<br />
gestört, bei Ausfall bereits während der Embryonalentwicklung ist Schwachsinn die Folge.<br />
(3) Leistungsanpassung: T 3 und T 4 sind neben den Glucocorticoiden für die Ausbildung<br />
adaptativer Modifikationen (insbesondere Kälteadaptation) von Bedeutung.<br />
Regelung der Hormonkonzentration: Wurde bereits im Rahmen der allgemeinen Endokrinologie<br />
behandelt. Die Sekretionsrate wird von inneren und äußeren Thermorezeptoren beeinflußt. Es<br />
kommt zu einer kälteinduzierten Steigerung des T 3 - und T 4 -Umsatzes. Auch andere Stressoren<br />
können eine Steigerung der Umsatzrate der Hormone hervorrufen. Allerdings handelt es sich<br />
hierbei nicht um eine Sollwertverstellung wie bei den Glucocorticoiden, sondern lediglich um<br />
eine Steigerung der Umsatzrate, wobei der Hormonspiegel immer konstant gehalten wird.<br />
Hyperthyreose (Morbus Basedow): Produktion eines TSH-ähnlichen Stoffes, der die Bildung der<br />
Hormone ungehemmt anregt, da er nicht einer Kontrolle durch negative Rückkopplung<br />
unterliegt. Klinische Zeichen: Vergrößerung der Schilddrüse (hyperthyreotischer Kropf),<br />
hervortretende Augäpfel („Glotzaugenkrankheit“ durch Fetteinlagerung in die Augenhöhlen),<br />
Tachycardie, Tremor, motorische Unruhe, leicht erhöhte Körpertemperatur, Schweißausbrüche,<br />
Glanzauge, Abmagerung trotz Heißhunger, erhöhter Grundumsatz, Haarausfall,<br />
Muskelschwäche, Herzmuskelschädigung.<br />
Hypothyreose: Mangelhafte Sekretionsrate, häufig durch Jodmangel in der Nahrung. Bevorzugt in den<br />
Alpenländern (Jodmangel im Gebirgswasser; epidemischer Kropf). Klinisch starke Vergrößerung<br />
der Schilddrüse (hypothyreotischer Kropf), der durch Zufuhr von Jodsalzen oder<br />
Schilddrüsenhormonen zur Rückbildung gebracht werden kann.<br />
Ausfall der Schilddrüsenhormone in der Embryonalperiode: Zurückbleiben der geistigen<br />
Entwicklung (Kretinismus), Minderwuchs mit gedrungenem Körper, Hypothermie,<br />
Hypoglykämie, Hypotonie, Gewichtszunahme, trockene Haut, große Zunge.<br />
Ausfall der Schilddrüsenhormone im Erwachsenenalter: Teigige Verdickung der Haut<br />
(Myxödem), Verminderung der körperlichen und geistigen Aktivität, Müdigkeit,<br />
Kälteempfindlichkeit, Antriebsarmut.<br />
46<br />
Keimdrüsen und Sexualhormone<br />
Bildungsorte der Sexualhormone:<br />
Die Sexualhormone sind Steroidhormone (wie Cortisol) und gehören zu den Lipidhormonen.<br />
(1) Weibliche Sexualhormone: Östrogene (wichtigster Vertreter Östradiol) und Gestagene<br />
(Progesteron) werden im Ovar (Östrogene in den Zellen der Theca interna des Follikels,
Progesteron in den Follikelzellen) und in der Plazenta (ab Ende des 4. Schwangerschaftsmonats)<br />
gebildet. Geringe Mengen von Androgenen werden in der NNR und auch im Ovar gebildet.<br />
(2) Männliche Sexualhormone: Androgenbildung in den Leydig-Zwischenzellen (Testosteron)<br />
der Hoden (Testes) und in der NNR. Im Hoden auch geringe Mengen von Östrogenen und<br />
Gestagenen.<br />
Wirkungen der Sexualhormone:<br />
(1) Embryonale Geschlechtsdifferenzierung: Am Ende des 3. Monats wird die männliche<br />
Keimdrüse des Fetus aktiv und bildet Testosteron, unter dessen Einfluß die Geschlechtsorgane<br />
ihre typisch männliche Ausbildung erfahren. Bleibt die Testosteronproduktion aus, bildet sich bei<br />
männlichen Feten ein weibliches Genitale (Pseudohermaphroditismus masculinus). Führt man<br />
im Experiment weiblichen Feten Testosteron zu, so bildet sich ein mehr oder weniger<br />
vollkommenes männliches Genitale aus (Pseudohermaphroditismus femininus). Ein<br />
Hermaphroditismus verus liegt vor, wenn gleichzeitig Ovar- und Testesgewebe unabhängig vom<br />
genetischen Geschlecht vorhanden ist.<br />
(2) Pubertät: Beim Knaben wird nach der embryonalen Entwicklungsphase die Produktion von<br />
Testosteron eingestellt, lebt aber zum Zeitpunkt der Pubertät wieder auf. Beim Mädchen beginnt<br />
die Tätigkeit der Keimdrüsen ebenfalls zum Zeitpunkt der Pubertät. Wachstum und Reifung der<br />
inneren und äußeren Geschlechtsorgane erfolgt beim Mädchen unter dem Einfluß von<br />
Östrogenen und Gestagenen, beim Knaben unter dem Einfluß von Testosteron.<br />
Unter dem Einfluß der Sexualhormone kommen zudem die extragenitalen Geschlechtsmerkmale<br />
zur Ausbildung: Entwicklung der Brustdrüse, typischer Körperbau, Schambehaarung.<br />
(3) Wirkung auf den Uterus: Die Östrogene bewirken die Proliferationsphase; unter dem<br />
zusätzlichen Einfluß des Progesterons sondern die Endometriumdrüsen ein Sekret ab<br />
(Sekretionsphase). Dadurch werden die Voraussetzungen für die Implantation eines befruchteten<br />
Eies geschaffen (vgl. Ontogenese).<br />
(4) Extragenitale Wirkungen: Progesteron steigert die Ruhe-Körpertemperatur durch Erhöhung<br />
des Grundumsatzes bei gleichzeitiger Sollwertverschiebung (Temperaturerhöhung zum<br />
Zeitpunkt der Ovulation um ca. 0,5°C; Methode der Messung der Basaltemperatur nach Knaus-<br />
Ogino zur Ermittlung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau). Progesteron hat zudem<br />
einen katabolen, Testosteron einen anabolen Effekt. Unter dem Einfluß der Sexualhormone<br />
(Östrogene, Testosteron) kommt es zur Verknöcherung der Epiphysenfugen und damit zum<br />
Wachstumsstillstand. Bei Androgenmangel wirkt GH unbehindert weiter ---> eunuchoider oder<br />
hypogonadaler Riesenwuchs.<br />
(5) Sexualverhalten: Bei weiblichen Säugetieren (ausgenommen Mensch und Primaten) ist die<br />
Kopulationsbereitschaft auf bestimmte Zeitabschnitte von wenigen Tagen beschränkt und fällt<br />
mit den zyklischen Steigerungen des Sexualhormonspiegels zusammen (Brunst oder Östrus). Bei<br />
kastrierten weiblichen Tieren läßt sich die Paarungsbereitschaft durch exogene Zufuhr von<br />
Östrogenen fördern, durch Progesteron hemmen. Bei Primaten und beim Menschen, die einen<br />
Menstruationszyklus haben, ist die sexuelle Aktivität gegen die Zyklusmitte hin (Ovulation)<br />
gesteigert.<br />
Menstruationszyklus: Im 2. Drittel des Zyklus steigt der Östrogenspiegel stark an und fällt gegen Ende<br />
des Zyklus wieder ab. Mit Verzögerung von einigen Tagen steigt der Progesteronspiegel an, um<br />
gegen Ende scharf abzufallen. Die Sekretionsrate beider Ovarialhormone wird durch FSH und<br />
LH gesteuert. In den ersten Tagen des Zyklus steigt der FSH-Spiegel an ---> Heranreifung des<br />
Primärfollikels und Anstieg des Östrogenspiegels. In der Mitte des Zyklus erfolgt ein steiler<br />
47
Anstieg des LH ---> Ursache der Ovulation und Umwandlung des Follikels zum Corpus luteum<br />
(erzeugt Progesteron).<br />
Die Steuerung der FSH- und LH-Sekretion aus der Adenohypophyse erfolgt über das Releasing-<br />
Hormon LHRH aus der hypophysiotropen Zone des Hypothalamus. Bei niedrigen<br />
Östradiolkonzentrationen, wie sie zu Beginn des Zyklus bestehen, werden die LH- und FSHproduzierenden<br />
Zellen auf einem niedrigen Sensibilitätsniveau für die Wirkung von LHRH<br />
gehalten, wodurch die LH- und FSH-Spiegel im Blut niedrig bleiben. Mit zunehmender Reifung<br />
des Follikels steigt der Östradiolspiegel im Blut an. Unmittelbar vor der Ovulation wird der<br />
Östradiolspiegel so hoch, daß Die LH- und FSH-produzierenden Zellen der Hypophyse plötzlich<br />
von ihrer niedrigen auf eine hohe Sensibilität auf LHRH umschalten. Dadurch verstärkt sich die<br />
LH- und FSH-Sekretion (positive Rückkoppelung von Östradiol) und es entsteht der LH-Gipfel,<br />
der die Ovulation auslöst. Die hohen Östradiol- und Progesteron-Spiegel koppeln nunmehr<br />
negativ zur Hypophyse und zum Hypothalamus zurück, so daß die LH- und FSH-Sekretion<br />
wieder auf basale Werte absinkt. Bei der Frau, ähnlich wie beim Mann, konnte zudem gezeigt<br />
werden, daß die Ausschüttung von LHRH aus den hypothalamischen Neuronen nicht in<br />
gleichmäßiger, sondern in pulsatiler Form erfolgt (phasische synchronisierte Aktivität der<br />
LHRH-Neurone).<br />
Ovulationshemmer: Durch exogene Zufuhr von Östrogen und Gestagen zu Beginn des Zyklus wird<br />
infolge der negativen Rückkopplung die LHRH-Sekretion gehemmt. Dabei wird sowohl die<br />
Pulsfrequenz der pulsatilen LHRH-Sekretion verlangsamt, als auch vermutlich die Menge des<br />
pro Puls sezernierten LHRH reduziert. Die Ovulation bleibt aus, da sich der LH-Gipfel nicht<br />
aufbauen kann.<br />
(1) Konventionelle Methode (Ein-Phasen-Präparate): Tabletten enthalten eine Östrogen-<br />
Gestagen-Kombination. Beginnend mit dem 5. Zyklustag werden 21 Tage lang die Tabletten<br />
genommen und 7 Tage lang keine Tabletten eingenommen etc.<br />
(2) Sequentialverfahren (Zwei-Phasen-Präparate): Beginnend mit dem 5. Zyklustag 15 Tage lang<br />
reine Östrogentabletten, daran anschließend 5 Tage lang Tabletten, die Östrogene und Gestagene<br />
enthalten, dann 8 Tage Pause etc.<br />
Nebenwirkungen der Ovulationshemmer: Übelkeit, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme,<br />
Zwischenblutungen. Nach 1 - 1 1/2 Jahren sollte eine Einnahmepause für 2 - 3 Zyklen erfolgen.<br />
Gynäkologische Untersuchung im Abstand von 6 Monaten ist anzuraten.<br />
Sexuelle Reaktion (Masters & Johnson 1966):<br />
(1) Erregungsphase: Erektion von Penis bzw. Klitoris. Beginn des Herzfrequenz- und<br />
Blutdruckanstiegs.<br />
(2) Plateauphase: Verlängerung und Erweiterung der Vagina, vor allem im hinteren Teil,<br />
Verengerung durch Blutanfüllung im vorderen Teil (orgastische Manschette); Verlagerung der<br />
Klitoris, Aufrichtung des Uterus. Beim Mann Vergrößerung und Anheben der Hoden.<br />
(3) Orgasmusphase: Vagina zeigt unter Beteiligung des Uterus 5 - 12 Kontraktionen. Analog<br />
zeigt der Penis 3 - 4 austreibende Kontraktionen. Höhepunkt der Steigerung von Herzfrequenz,<br />
Atemfrequenz und Blutdruck.<br />
(4) Rückbildungsphase: Beim Mann Abbruch der Plateauphase nach dem Orgasmus, Beginn<br />
einer Refraktärzeit; erst nach Ende der Refraktärzeit neuer Orgasmus möglich. Bei der Frau<br />
Rückkehr auf die Plateauphase, von hier aus weitere Orgasmen möglich.<br />
48
Schwangerschaft, Geburt und Lactation: Der Untergang des Corpus luteum wird verhindert, sobald<br />
sich ein befruchtetes Ei in der Uterusschleimhaut implantiert hat. Vom Trophoblast der<br />
Blastozyste (s. Ontogenese) werden folgende Hormone gebildet:<br />
(1) Choriongonadotropin (HCG): Ähnliche Wirkungen wie das LH.<br />
(2) Human Placental Lactogen (HPL): Entspricht dem Prolactin.<br />
Unter dem Einfluß dieser beiden Plazentahormone (gonadotrope Wirkung) steigert das Corpus<br />
luteum seine Progesteronproduktion. Dadurch wird die Abstoßung der Uterusschleimhaut<br />
verhindert und die Schwangerschaft aufrecht erhalten. Gegen Ende des 4.<br />
Schwangerschaftsmonats bildet sich das Corpus luteum zurück. Die Plazenta übernimmt nun<br />
selbst die Produktion von Progesteron. Theoretisch könnte nun das Ovar ohne Unterbrechung der<br />
Schwangerschaft entfernt werden.<br />
Mit zunehmender Schwangerschaftsdauer steigen die Östrogen- und Progesteron-Spiegel im Blut<br />
an. Östrogene sensibilisieren den Uterus für die Wirkung von Oxytocin, dem wehenauslösenden<br />
Hormon. Hohe Spiegel von Progesteron antagonisieren diese Wirkung. Die Wehentätigkeit und<br />
damit die Geburt wird möglicherweise durch einen kurzfristigen Abfall des Progesteron-Spiegels<br />
im Blut ausgelöst.<br />
Die Brustdrüse entwickelt sich in der Pubertät unter dem Einfluß der Östrogene, erlangt ihre<br />
Funktionsfähigkeit aber erst während der Schwangerschaft. Hieran sind beteiligt: Östrogene,<br />
Gestagene, Prolactin und HPL. Die Milchfreisetzung erfolgt durch den Saugreiz (weitergeleitet<br />
über afferente Nervenfasern zum Hypothalamus), der Oxytocin freisetzt, was eine Kontraktion<br />
der Myoepithelien der Brustdrüse bewirkt (Milchejektionsreflex). Zusätzlich wird durch den<br />
Saugreiz nerval PRH im Hypothalamus sezerniert und gleichzeitig die Ausschüttung von<br />
Dopamin vermindert, womit Prolactin freigesetzt wird, das die Milchsekretion anregt. Die hohen<br />
Prolactin-Spiegel bewirken aber andererseits durch Rückkoppelung eine Erhöhung der<br />
Dopaminsekretion. Da Dopamin auch hemmend auf die LHRH-Produktion wirkt, kommt es zum<br />
Ausbleiben weiterer Ovulationen.<br />
Schwangerschaftsnachweis: Durch immunologische Tests, die auf dem Nachweis von HCG im Harn<br />
beruhen (Antigen-Antikörper-Reaktion). Positive Ergebnisse sind 35 - 40 Tage nach der letzten<br />
Menstruation zu erwarten.<br />
Sexualhormonspiegel beim Mann: Das LH (ICSH) stimuliert die Leydig-Zwischenzellen zu vermehrter<br />
Testosteronproduktion, die für die Spermatogenese notwendig ist. Ein Anstieg des Testosteron-<br />
Spiegels hemmt die LH- und LHRH-Sekretion (wird pulsatil ausgeschüttet) durch negative<br />
Rückkoppelung. In den Samenkanälchen des Hodens wird durch FSH die Spermatogenese<br />
angeregt. Gleichzeitig bilden die dort befindlichen Sertoli-Zellen das Inhibin, welches selektiv<br />
die FSH-Sekretion in der Hypophyse inhibiert. Von den Sertoli-Zellen wird weiterhin das<br />
Androgenbindende Protein (ABP) produziert, welches Testosteron von den Leydig- zu den<br />
Sertoli-Zellen transportiert, wo es zu Östrogen umgewandelt wird. Somit sind Östrogene und<br />
Androgene für die Reifung der Spermatocyten notwendig. Danach gelangen die Spermatocyten<br />
vom Hoden in den Nebenhoden, wo die weitere Reifung erfolgt. Die Speicherung erfolgt im<br />
wesentlichen im Samenleiter und dessen Ampullen.<br />
49
Sympathico-adrenales System<br />
50<br />
Hormone und Hormonbildung: Adrenalin und Noradrenalin, die zur Gruppe der Catecholamine<br />
gehören. Bildungsorte:<br />
(1) Nebennierenmark (NNM): Bildung in den chromaffinen Zellen (lassen sich mit<br />
Dichromsäure anfärben), Anteil des Adrenalin an der NNM-Sekretion 70 - 90 %, Rest<br />
Noradrenalin. Beim NNM handelt es sich um ein umgewandeltes sympathisches Ganglion, das<br />
aus modifizierten postganglionären Neuronen besteht und durch präganglionäre Axone erregt<br />
wird.<br />
(2) Sympathische postganglionäre Nervenendigungen: Setzen überwiegend Noradrenalin frei.<br />
(3) Gehirn: Noradrenalin wird in verschiedenen Hirngebieten gebildet und wirkt als Transmitter<br />
(REM-Schlaf, Belohnungszentren). Die unter (1) und (2) gebildeten Catecholamine können<br />
jedoch wegen der Bluthirnschranke nicht in das Gehirn eindringen.<br />
Wirkungen von Adrenalin und Noradrenalin: Grundwirkungen:<br />
(1) Beeinflussung des Tonus und der Kontraktion der glatten Muskulatur (Gefäße, Bronchien,<br />
Magen-Darm-Trakt) und des Herzens. Konstriktorische Effekte auf die glatte Muskulatur werden<br />
über α-Rezeptoren vermittelt, Relaxationseffekte über ß-Rezeptoren. Noradrenalin wirkt<br />
überwiegend auf die α-Rezeptoren, Adrenalin auf α- und ß-Rezeptoren. Die erregenden Effekte<br />
auf den Herzmuskel werden über ß-Rezeptoren vermittelt.<br />
(2) Beeinflussung des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels über ß-Rezeptoren.<br />
Wirkungen im einzelnen:<br />
(01) Kreislauf: Noradrenalin bewirkt in allen Gefäßgebieten (Ausnahme Koronargefäße und<br />
Gehirn) Vasokonstriktion. Adrenalin bewirkt an den Hautgefäßen Vasokonstriktion, an den<br />
Skelettmuskelgefäßen Vasodilatation.<br />
(02) Herz: Adrenalin hat eine positiv chronotrope, inotrope und dromotrope Wirkung (s.<br />
Funktion des Herzens), Noradrenalin bewirkt über eine reflektorische Vaguserregung<br />
Bradycardie.<br />
(03) Blutdruck: Noradrenalin bewirkt eine Steigerung des systolischen und diastolischen<br />
Blutdrucks, Adrenalin bewirkt ebenfalls eine Steigerung des systolischen Druckes bei Konstanz<br />
oder Senkung des diastolischen Druckes.<br />
(04) Atmung: Noradrenalin und Adrenalin bewirken eine Erschlaffung der Bronchialmuskulatur<br />
und Steigerung der Atemtiefe.<br />
(05) Magen-Darm-Trakt: Noradrenalin und Adrenalin erregen die Sphincteren (Schließmuskel)<br />
und hemmen die übrige glatte Muskulatur.<br />
(06) Haut: Erregung der Erectores pilorum mit Aufrichten der Körperbehaarung (Adrenalin und<br />
Noradrenalin).<br />
(07) Auge: Erweiterung der Pupillen durch Erregung des Dilatator pupillae (Adrenalin und<br />
Noradrenalin).<br />
(08) Kohlenhydratstoffwechsel: Adrenalin bewirkt Steigerung des Blutglukosespiegels durch<br />
Abbau des Leberglykogens (Antagonist des Insulins) und Steigerung der Gluconeogenese. Nur<br />
geringe Wirkung des Noradrenalins. Beide Hormone inhibieren die Insulinsekretion.<br />
(09) Fettstoffwechsel: Adrenalin und Noradrenalin wirken lipolytisch (Abbau der Fette mit<br />
Anstieg der Fettsäuren im Plasma).<br />
(10) Energieumsatz: Steigerung durch beide Hormone.
(11) ZNS: Adrenalin (Noradrenalin nur in geringem Maße) bewirkt Stimulierung des ARAS<br />
(arousal reaction) mit Desynchronisierung des EEG ---> psychische Erregung und<br />
Angstzustände. Wegen der Bluthirnschranke handelt es sich wohl nur um indirekte Wirkungen.<br />
Steuerung der Sekretion: Sekretion von Adrenalin und Noradrenalin im NNM und von Noradrenalin an<br />
den Nervenendigungen in Ruhe gering. Steigerung der Sekretionsrate bei Erregung des<br />
sympathischen Nervensystems durch Belastungszustände (Stress) zusammen mit einer<br />
gesteigerten Glucocorticoidsekretion (bewirkt ergotrope Einstellung des Organismus).<br />
51<br />
Pankreashormone und Blutzuckerregelung<br />
Hormonbildung: In den inselförmig in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) liegenden Langerhans-Inseln<br />
werden die Hormone Insulin (B-Zellen), Glucagon (A-Zellen) und Somatostatin (D-Zellen)<br />
gebildet. Hinsichtlich der Beeinflussung des Blutglukosespiegels verhalten sich Insulin und<br />
Glucagon antagonistisch. Somatostatin inhibiert die Sekretion beider Hormone.<br />
Wirkung des Insulins (Senkung des Blutzuckers):<br />
(1) Leber: Unter dem Einfluß der kohlenhydratinduzierten Insulinausschüttung wird von den<br />
Leberzellen Glukose zu Glykogen umgebaut. Weiterhin inhibiert Insulin die<br />
glykogenabbauenden Enzyme.<br />
(2) Muskel: Steigerung der Glukosepermeabilität der Zellen. Bei niedrigen Insulinspiegeln ist die<br />
Muskelzelle impermeabel für Glukose und deckt ihren Energiebedarf über den<br />
Fettsäuremetabolismus. Durch hohe Insulinspiegel wird die Muskelzelle jedoch permeabel für<br />
Glukose und kann sie dann verbrauchen. Die Zellmembran von stark beanspruchten<br />
Muskelzellen kann jedoch auch insulinunabhängig permeabel für Glukose werden.<br />
(3) Nervenzellen: Die Zellen des ZNS decken ihren Energiebedarf ausschließlich durch Glukose,<br />
dieser Prozeß ist aber insulinunabhängig.<br />
(4) Fettstoffwechsel: Insulin stimuliert die Fettsäurebildung in der Leber und die<br />
Aufnahmefähigkeit des Fettgewebes für freie Fettsäuren und deren Speicherung in Form von<br />
Triglyceriden (Depotfett). Bei geringer Insulinsekretion werden die Triglyceride wieder<br />
gespalten, indem die hemmende Wirkung des Insulins auf eine Lipase wegfällt.<br />
(5) Proteinstoffwechsel: Insulin ermöglicht den aktiven Transport von vielen Aminosäuren in die<br />
Zellen und so den Proteinaufbau.<br />
Wirkung des Glucagons (Erhöhung des Blutzuckers):<br />
(1) Abbau des Leberglykogens (Glykogenolyse), damit ein Synergist des Adrenalins.<br />
(2) Steigerung der Gluconeogenese.<br />
Wirkung des Somatostatins: Die Sekretion wird durch hohe Glukosespiegel, erhöhte Aminosäuren und<br />
erhöhte Fettsäuren im Blut stimuliert. Da Somatostatin auf beide Hormone inhibitorisch wirkt,<br />
werden überschießende Reaktionen durch Insulin oder Glucagon verhindert.
Regelung der Blutzuckerkonzentration: Insulin und Glucagon sind als Stellglieder innerhalb eines<br />
Regelkreises zur Konstanthaltung des Blutglukosespiegels aufzufassen. An Störgrößen für den<br />
Blutglukosespiegel sind zu nennen: Wechselnde Kohlenhydrataufnahme und körperliche Arbeit<br />
(vermehrter Glukoseverbrauch). Glukoserezeptoren im Pankreas messen den Blutzuckerspiegel<br />
(normal 80 - 100 mg/dl Blut) und steuern die Sekretionsrate der B-Zellen (Insulin). Darüber<br />
hinaus können die B-Zellen noch durch parasympathische Innervation aktiviert und durch<br />
sympathische Innervation gehemmt werden. Die Steuerung der Glucagonsekretion wird<br />
möglicherweise durch Glukoserezeptoren im Hypothalamus ausgelöst, wobei das<br />
Wachstumshormon GH als tropes Hormon für die A-Zellen wirkt. Zudem kann die<br />
Glucagonsekretion durch Erregung des Sympathikus gesteigert werden. Bei der Regelung der<br />
Blutzuckerkonzentration ist zu beachten, daß außer Glucagon auch das Wachstumshormon selbst<br />
sowie das im Rahmen sympathischer Erregung ausgeschüttete Adrenalin eine<br />
blutzuckersteigernde Wirkung haben. Darüber hinaus wirken die Glucocorticoide und die<br />
Schilddrüsenhormone im Sinne einer Blutzuckererhöhung.<br />
Hypoglykämie: Abfall des Blutzuckers unter 50 mg/dl Blut. Bei weiterem Absinken hypoglykämischer<br />
Schock mit Bewußtlosigkeit (mangelnde Versorgung der Hirnzellen, für die Glukose der einzige<br />
Energielieferant ist). Klinische Zeichen der Hypoglykämie: Schweißsekretion, Tachycardie,<br />
Tremor, Heißhunger, Erregung. Therapie: Zufuhr von Traubenzucker (Glukose).<br />
Hyperglykämie (Diabetes mellitus): Beruht auf Insulinmangel. Klinische Zeichen:<br />
Blutzuckererhöhung, Zuckerausscheidung im Harn (Glukosurie, bei mehr als 180 mg/dl Glukose<br />
im Plasma), Durst, große Harnmengen (Polyurie, osmotische Diurese), Gewichtsabnahme,<br />
Kraftlosigkeit, Neigung zu Hautkrankheiten, Potenz- und Menstruationsstörungen. Spätfolgen<br />
der Zuckerkrankheit: Netzhautveränderungen mit Blutungen im Augenhintergrund (evtl.<br />
Erblindung), Nephropathie (Nierenschädigung mit erhöhtem Blutdruck und Urämie),<br />
Neuropathie (Schmerzen, Muskelatrophie und Schwäche in den Beinen), Arteriosklerose<br />
(Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen). Therapie: Insulinsubstitution, in leichten Fällen orale<br />
Antidiabetika.<br />
52<br />
Hormonale Regulation des Mineralhaushaltes<br />
Beteiligte Hormone:<br />
(1) Aldosteron (über Renin und Angiotensin) für Na + , K + und H + -Ionen.<br />
(2) Parathormon und Thyreocalcitonin (syn. Calcitonin) für den Ca ++ - und Phosphathaushalt.<br />
Wirkungen des Aldosterons: Aldosteron wird in der Zona glomerulosa der NNR (Mineralocorticoid)<br />
gebildet und hat folgende Wirkungen:<br />
(1) Steigerung des aktiven Na + -Transports durch Zellmembranen.<br />
(2) In der Niere Reabsorption von Na + aus dem Tubulussystem und damit auch eine osmotisch<br />
bedingte Wasserreabsorption.<br />
(3) Ausscheidung von K + - und H + -Ionen in der Niere.<br />
(4) Regelung des NaCl-Gehalts im Schweiß, Speichel und Sekreten der Darmdrüsen.
Steuerung der Aldosteronsekretion: Drei Bedingungen haben eine Steigerung der Aldosteronsekretion<br />
zur Folge:<br />
(1) gesteigerte Kaliumzufuhr,<br />
(2) negative Na-Bilanz, z.B. verminderte NaCl-Zufuhr in der Nahrung, erhöhte NaCl-Verluste<br />
mit dem Schweiß,<br />
(3) Verminderung des Plasmavolumens bzw. des extrazellulären Raums durch Blutverlust oder<br />
mangelhafte Flüssigkeitszufuhr.<br />
Die Steigerung der Aldosteronsekretionsrate wird durch folgende Steuerungsmechanismen<br />
bewirkt:<br />
(1) Hormonzellen der Zona glomerulosa sprechen direkt auf Änderungen der Na + - und K + -<br />
Konzentrationen im Plasma an.<br />
(2) Aldosteronsekretion wird durch Angiotensin gesteigert, das auf dem Blutweg zur NNR<br />
gelangt und so den Charakter eines tropen Hormons für die Aldosteronsekretion hat. Angiotensin<br />
entsteht aus Angiotensinogen unter Einwirkung des im juxtaglomerulären Apparates gebildeten<br />
Renins (Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus; s. Niere).<br />
(3) Aldosteronsekretion wird durch ACTH beeinflußt, jedoch in weit geringerem Maße als die<br />
Glucocorticoidsekretion.<br />
Pathophysiologie: Störungen des Elektrolyt- und Wasserhaushalts bei Unterfunktion der NNR durch<br />
Aldosteronmangel (Addison'sche Krankheit, s. Kapitel NNR). Hyper-Aldosteronismus<br />
(vermehrte Bildung von Aldosteron) bei NNR-Tumor mit Hypernatriämie, Hypokaliämie und<br />
Ödemen.<br />
Hormone des Ca ++ - und Phosphathaushalts: Parathormon wird in den 4 Epithelkörperchen der<br />
Schilddrüse (Nebenschilddrüse) gebildet, Calcitonin in den sog. C-Zellen der Schilddrüse und<br />
Vitamin-D-Hormon aus Vitamin-D in der Niere. Die Hormone können als Stellglieder in einem<br />
Regelkreis zur Konstanthaltung des Blutcalciumspiegels aufgefaßt werden. Damit verknüpft ist<br />
die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Knochenan- und Knochenabbau.<br />
Wirkungen des Parathormons:<br />
(1) Lösung von Ca ++ - und Phosphationen aus der Knochensubstanz durch Stimulierung der<br />
Osteoklasten.<br />
(2) Verhinderung der Bindung des Calciums an Phosphationen durch Förderung der<br />
Phosphationenausscheidung in der Niere.<br />
(3) Stimulierung eines Enzyms in der Niere, welches das Vitamin-D in das biologisch wirksame<br />
Vitamin-D-Hormon überführt.<br />
(4) Verminderung der Ausscheidung von Calciumionen in der Niere.<br />
Wirkungen des Calcitonins:<br />
(1) Verminderte Osteolyse und vermehrten Einbau von Calcium in den Knochen.<br />
(2) Verlangsamung von Verdauungsprozessen (Magenentleerung, Sekretion des Pankreas), um<br />
Calciumaufnahme zu ermöglichen.<br />
Wirkung des Vitamin-D-Hormons:<br />
Das mit der Nahrung aufgenommenen Vitamin-D ist ein Prohormon. Bei zu niedrigen<br />
Calciumkonzentrationen im Blut wird verstärkt Parathormon ausgeschüttet, wodurch mehr<br />
Vitamin-D-Hormon in der Niere gebildet wird. Dieses erhöht am Darmepithel die<br />
Calciumresorption.<br />
53
Steuerung von Parathormon und Calcitonin: Die Zellen der Nebenschilddrüse reagieren auf<br />
Änderungen der Ca ++ -Konzentration mit einer Änderung ihrer Parathormonsekretion, wobei die<br />
negative Rückkoppelung über das Vitamin-D-Hormon erfolgt. Die Steuerung des Calcitonins<br />
erfolgt in ähnlicher Weise. Erhöhung des Ca ++ -Spiegels stimuliert unmittelbar die<br />
Hormonsekretion der C-Zellen. Darüber hinaus werden die C-Zellen nach Nahrungsaufnahme<br />
von den gastrointestinalen Hormonen Gastrin und Cholecystokinin stimuliert.<br />
Tetanie: Senkungen des Blutcalciumspiegels lösen eine Erhöhung der neuromuskulären Erregbarkeit<br />
aus. Schon leichte elektrische oder mechanische Reize (Beklopfen eines motorischen Nerven)<br />
bewirken eine Kontraktion der Skelettmuskulatur. Krämpfe können auch spontan auftreten. Tod<br />
durch Kontraktion der Atem- und Kehlkopfmuskulatur. Entscheidend für das Auftreten der<br />
tetanischen Krämpfe ist die Höhe des ionisierten Ca ++ im Blutplasma, das mit dem an Eiweiß<br />
gebundenem Ca im Gleichgewicht steht. Dieses Gleichgewicht ist abhängig vom Blut-pH. Bei<br />
zunehmendem Blut-pH (Alkalose) nimmt der Anteil von Ca ++ ab. Bei latenter Tetanie kann<br />
schon eine willkürliche Hyperventilation (Bewirkt Senkung des CO 2 -Partialdrucks im Blut und<br />
damit Alkalose) einen tetanischen Anfall auslösen (Hyperventilationstetanie).<br />
Hyperparathyreoidismus: Bei Geschwülsten der Nebenschilddrüse mit Überproduktion von<br />
Parathormon entsteht eine Hypercalcämie. Hierbei treten Kalkeinlagerungen in den Gefäßen und<br />
in der Niere auf (Nierensteinleiden).<br />
54<br />
Grenzbereiche des endokrinen Systems<br />
Enterohormone (syn. gastrointestinale Hormone): Verschiedene Stoffe, die für die Verdauungsfunktion<br />
von Bedeutung sind: Gastrin, Secretin, Entero-Oxyntin und Cholecystokinin (s. Funktion des<br />
Magen-Darm-Kanals).<br />
Gewebshormone: Stoffe, die nicht in speziellen endokrinen Organen, sondern „irgendwo im Gewebe“<br />
gebildet werden. Problematischer Begriff, da scharfe Abgrenzungen zu Enterohormonen und<br />
Neurotransmittern nicht möglich sind. Nachfolgend werden einige Stoffe erwähnt, deren<br />
Klassifizierung schwierig ist, und die gelegentlich noch als Gewebshormone bezeichnet werden:<br />
Prostaglandine: Wurden zunächst in den Samenblasen (produzieren zusammen mit der Prostata die als<br />
Träger der Spermien dienende Samenflüssigkeit) gefunden, inzwischen sind sie aber in nahezu<br />
allen Organen, so auch im Gehirn, nachgewiesen worden. Vielfältige Wirkungen der<br />
Prostaglandine: Z.B. Hemmung der Gelbkörperfunktion, Störung der Thrombozytenverklebung,<br />
Hemmung der Magensaftsekretion, Vermittlung der Wirkung von bakteriellen fiebererregenden<br />
Stoffen (Pyrogene).<br />
Serotonin: Wird an den Nervenendigungen bestimmter Hirnbezirke (Hypothalamus, Raphe-Kerne)<br />
freigesetzt. Kommt auch in Thrombozyten vor, wird bei Verletzungen freigesetzt und hat eine<br />
vasokonstriktorische Wirkung (Blutstillung).
Histamin: Entsteht beim Ablauf von Antigen-Antikörperreaktionen und löst einen Teil der allergischen<br />
Reaktionen (Hautrötung, Hautjucken, Quaddelbildung) aus. Auch in Hypophyse und<br />
Hypothalamus nachgewiesen (Neurotransmitter?).<br />
Bradykinin: Wird zusammen mit dem Schweiß freigesetzt und vermittelt Vasodilatation bestimmter<br />
Gefäßgebiete im Rahmen der Thermoregulation.<br />
Niere: Erythropoetin wird im juxtaglomerulären Apparat der Niere gebildet und regt die Erythropoese<br />
(Erythrozytenneubildung) an. Auf die Hormone Renin und Vitamin-D-Hormon sei nochmals<br />
hingewiesen.<br />
Thymus: Dieses hinter dem Brustbein gelegene Organ produziert eine Reihe von Peptiden. Man nimmt<br />
an, daß diese Peptide bei immunologischen Abwehrmechanismen eine Rolle spielen (vgl.<br />
Funktion des Blutes).<br />
Epiphyse (Pinealorgan oder Zirbeldrüse): Das Corpus pineale ist eine Ausstülpung des dritten<br />
Ventrikels. Produziert Melatonin, das eine Aggregation der Melaningranula in den Melanozyten<br />
der Haut bewirkt und so zu einer Entpigmentierung führt; somit Antagonist des in der<br />
Hypophyse gebildeten MSH. Melatonin soll auch die LHRH-Freisetzung hemmen und damit die<br />
Gonadotropinsekretion und die Aktivität der Keimdrüsen. Dieser Befund ist wichtig für das<br />
Verständnis der jahresperiodischen Fruchtbarkeit vieler Säuger. Beim Menschen soll die<br />
Sexualentwicklung vor der Pubertät durch Melatonin unterdrückt werden. Epiphysenzerstörung<br />
kann bei jugendlichen Menschen zu vorzeitiger Geschlechtsreifung (Pubertas praecox) führen.<br />
55<br />
Gehirnanatomie<br />
Literatur: Sobotta-Becher: Atlas der Anatomie des Menschen Bd III.<br />
Anatomische Gliederung:<br />
1 Telencephalon = Großhirn<br />
2 Diencephalon = Zwischenhirn<br />
3 Mesencephalon = Mittelhirn<br />
4 Metencephalon = Hinterhirn<br />
5 Medulla oblongata<br />
1 + 2 = Prosencephalon oder Vorderhirn<br />
3 + 4 + 5 = Hirnstamm = Truncus cerebri (physiologisch)<br />
4 + 5 = Rhombencephalon = Rautenhirn<br />
Telencephalon (Cerebrum): Hirnmantel, Stammganglien (Nucleus caudatus = Schweifkern und<br />
Nucleus lentiformis = Linsenkern, der wiederum aus Putamen und Pallidum besteht; N. caudatus<br />
und Putamen zusammen werden oft auch als Striatum bezeichnet), Riechhirn (Rhinencephalon),<br />
Balken (Corpus callosum), Gewölbe (Fornix) und Septum. Diese Strukturen zusammen bilden<br />
die paarige Großhirnhemisphäre.
Diencephalon: Thalamus und Hypothalamus.<br />
Mesencephalon: Hirnschenkel (Pedunculi cerebri), Tegmentum (Haube) und Vierhügelplatte (Lamina<br />
tecti oder Tectum).<br />
Metencephalon: Brücke (Pons) und Kleinhirn (Cerebellum).<br />
Medulla oblongata (Myelencephalon): = verlängertes Mark, zwischen Pons und Pyramidenkreuzung<br />
gelegen. Geht ohne scharfe Grenze in das Rückenmark über.<br />
Limbisches System: Funktionssystem, das sowohl Anteile der Großhirnrinde als auch<br />
Stammhirnanteile umfaßt. Wesentliche Strukturen: Gyrus cinguli, Hippocampus, Mandelkerne<br />
(Amygdala), Septum, Riechhirn, limbic midbrain area, Fornix, mediales Vorderhirnbündel, Teile<br />
des Hypothalamus.<br />
Formatio reticularis: Zieht sich durch den ganzen Hirnstamm bis zum Hypothalamus und stellt eine<br />
netzförmige, histologisch wenig gegliederte Nervenmasse dar. Stellenweise treten<br />
Zellverdichtungen auf, wie z.B. der Nucleus ruber. Es lassen sich vor allem 3 Aufgabengebiete<br />
unterscheiden:<br />
(1) Die Retikularisformation erhält Impulse über Kollateralen von allen Sinneskanälen, die<br />
verstärkt oder gehemmt werden können. Die zur Großhirnrinde oder zum limbischen Kortex<br />
weitergeleiteten Erregungen bewirken eine Aktivierung (ARAS = aufsteigendes reticuläres<br />
Aktivierungssystem).<br />
(2) Durch ihre extrapyramidalen Kerngruppen (z.B. Nucleus ruber und niger) gewinnt die<br />
Retikularisformation Einfluß auf die sensomotorischen Systeme des Rückenmarks. Dabei<br />
können reflexhemmende und reflexfördernde Areale unterschieden werden, die vornehmlich auf<br />
die Gamma-Motoneuronen in den Vorderhörnern einwirken (z.B. Tractus reticulospinalis).<br />
(3) In die Retikularisformation des Mittel- und Rautenhirns sind auch zahlreiche vegetative<br />
Kerngruppen eingelagert (z.B. Atmungszentrum, Kreislaufzentrum).<br />
Einteilung des Hirnmantels: Jede Großhirnhemisphäre unterteilt sich in vier Lappen (Lobus):<br />
Stirnlappen (L. frontalis), Scheitellappen (L. parietalis), Schläfenlappen (L. temporalis) und<br />
Hinterhauptlappen (L. occipitalis). Die Lappen werden durch Einschnitte (Sulcus) voneinander<br />
getrennt. Jeder Lappen besteht aus mehreren Windungen (Gyrus).<br />
Ventrikelsystem: Das Gehirn enthält im Innern vier Hohlräume, die Hirnkammern oder Ventrikel. Sie<br />
stehen untereinander und mit dem Zentralkanal des Rückenmarks in Verbindung. Zwei Ventrikel<br />
gehören dem Großhirn an und liegen paarig als Seitenventrikel in den Großhirnhemisphären. Der<br />
dritte Ventrikel ist unpaarig und gehört zum Zwischenhirn. Der vierte Ventrikel ist der Hohlraum<br />
des Rautenhirns. Alle Hirnkammern sind mit Flüssigkeit ausgefüllt, dem Liquor. Im Bereich des<br />
vierten Ventrikels steht diese Flüssigkeit in Kommunikation mit jener Flüssigkeit, die das Gehirn<br />
als ganzes umgibt.<br />
Hirnnerven: s. Schmidt, R.F. (Hrsg.) (1985 5 ). Grundriß der Sinnesphysiologie. Berlin: Springer (S.<br />
94). Nehmen Sie bitte auch den später folgenden Kommentar zur Literatur zur Kenntnis.<br />
Subcorticale vegetative „Zentren“:<br />
Inspirationszentrum: Ventral in der Retikularisformation der Medulla oblongata, beeinflußt reziprok<br />
des Exspirationszentrum.<br />
Exspirationszentrum: Dorsal in der Retikularisformation der Medulla oblongata, beeinflußt reziprok<br />
das Inspirationszentrum.<br />
56
Pneumotaktisches Zentrum: Retikularisformation der Pons, beeinflußt beide oben genannten Zentren.<br />
Pressorisches Kreislaufzentrum: Laterale Retikularisformation der Medulla oblongata, Reizung führt<br />
zu Blutdrucksteigerung.<br />
Depressorisches Kreislaufzentrum: Ventral in der Retikularisformation der Medulla oblongata,<br />
Reizung führt zu Blutdruckabfall.<br />
Schluckzentrum: Rostrales Drittel der Retikularisformation der Medulla oblongata, Koordination der<br />
Phasen des Schluckaktes und Erbrechen.<br />
Schlafzentrum: Massa intermedia des Thalamus und Retikularisformation des Mittelhirns, Ausfall<br />
führt zum Dauerwachzustand.<br />
Weckzentrum: Retikularisformation des Mittelhirns und viele andere Stellen des ARAS, Ausfall führt<br />
zum Dauerschlaf.<br />
Durstzentrum: Vorderer Hypothalamus, Reizung der Osmorezeptoren (durch Erhöhung der<br />
Salzkonzentration im Blut bzw. Extrazellulärraum) führt zu Durst und Ausschüttung von<br />
Adiuretin.<br />
Hungerzentrum: Ventro-lateraler Hypothalamus, Ausfall führt zur Verweigerung der<br />
Nahrungsaufnahme und zum Tod durch Verhungern.<br />
Sättigungszentrum: Ventro-medialer Hypothalamus, Ausfall führt zu extremer Fettsucht.<br />
Thermoregulationszentrum: Hinterer Hypothalamus, Ausfall führt zu Poikilothermie.<br />
Sexualzentrum: Medialer Hypothalamus, regelt die Abgabe der Releasing-Hormone für die<br />
gonadotropen Hormone aus dem HVL, Ausfall führt zu Hypogenitalismus.<br />
Wut-, Aggressions- und Fluchtzentren: Caudaler Hypothalamus; Reizung in diesem Bereich führt im<br />
Tierversuch zum Fauchen, Knurren, Bellen etc. mit Angriffen auf den Experimentator oder<br />
Fluchtversuch; Ausfall erzeugt Bewegungsunlust, Schlafsucht und Indifferenz im Verhalten; die<br />
vegetativen Reaktionen während des Abwehrverhaltens (Blutdruckzunahme, Abnahme der<br />
Darmbewegung, etc.) können durch die Änderung der Aktivität des Sympathikus erklärt werden.<br />
Bemerkungen zum Begriff „Zentrum“: Der Begriff soll hier nur zur didaktischen Vereinfachung<br />
verwendet werden. Es muß darauf hingewiesen werden, daß die lokalisationistische<br />
Betrachtungsweise weitgehend überholt ist, d.h. eine eindeutige Zuordnung Funktion - Zentrum<br />
nicht haltbar ist. Vielmehr sind ähnliche Reaktionen bzw. Empfindungen häufig von vielen<br />
Stellen eines Funktionssystems durch Hirnreizung auslösbar.<br />
Wichtige Projektionsfelder der Großhirnrinde („Zentren“):<br />
Stirnlappen:<br />
Motorisches Projektionsfeld: Gyrus praecentralis, Ursprung der Pyramidenbahn, somatotopisch<br />
gegliedert (motorischer Homunkulus). Ausfall: Verlust der Willkürmotorik.<br />
Motorisches Sprachzentrum (Broca): Gyrus frontalis inferior. Ausfall: Motorische Aphasie = beim<br />
erhaltenen Sprachverständnis sind Spontansprechen und Nachsprechen gestört oder aufgehoben.<br />
Schreibzentrum: Gyrus frontalis medialis. Ausfall: Agraphie = Schreibstörung.<br />
Tertiäre motorische Rindenfelder: Pol des Frontallappens. Ausfall: Perseverationstendenz bzw.<br />
mangelnde Umstellfähigkeit, Zerfall von Verhaltensplänen, starke Auswirkung proaktiver<br />
Hemmung.<br />
Scheitellappen:<br />
Sensorisches Projektionsfeld: Gyrus postcentralis, Ende des Tractus thalamocorticalis<br />
(Hinterstrangbahn, lemniscales System), somatotopisch gegliedert (sensorischer Homunculus).<br />
Ausfall: Verlust der Oberflächensensibilität (Druck, Berührung, Temperatur).<br />
57
Lesezentrum: Gyrus angularis. Ausfall: Alexie = Leseunfähigkeit. Lesen von geschriebener oder<br />
gedruckter Schrift nicht möglich, dagegen können durch Abtasten der Buchstaben mit den<br />
Fingern Worte entziffert werden (optisches Sprachzentrum).<br />
Gustatorisches Projektionsfeld: Operculum parietale, Ende der Geschmacksbahn. Ausfall: Ageusie =<br />
Aufhebung des Geschmackvermögens.<br />
Hinterhauptlappen:<br />
Optisches Projektionsfeld: Calcarina-Rinde, Ende der Sehbahn. Ausfall: Rindenblindheit.<br />
Optische Assoziationsfelder: Gyri occipitalis superior, medialis und inferior. Ausfall: Optische<br />
Agnosie = Unfähigkeit, trotz guten Lichtsinns, genügender Sehschärfe, etc. einen optischen<br />
Gesamteindruck zu erfassen; gezeigte Gegenstände werden nicht erkannt.<br />
Schläfenlappen:<br />
Akustisches Projektionsfeld: Heschl'sche Querwindungen, Ende der Hörbahn. Ausfall: Rindentaubheit.<br />
Sensorisches Sprachzentrum (Wernicke): Gyrus temporalis superior. Ausfall: Sensorische Aphasie =<br />
bei ungestörter Spontansprache Aufhebung des Sprachverständnisses; Gehörtes wird nicht<br />
verstanden und kann nicht nachgesprochen werden.<br />
Zentrum für Informationsspeicherung (Gedächtnis): Hippocampus. Ausfall: Unfähigkeit, neues<br />
Material über mehr als eine Minute zu behalten, starke Auswirkung retroaktiver Hemmung.<br />
Olfaktorisches Projektionsfeld: Riechhirn (Hippocampus), Ende der Riechbahn. Ausfall: Anosmie =<br />
Aufhebung des Geruchsvermögens.<br />
58<br />
Störungen der Hirnfunktion bei Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns<br />
Literatur: Spoerri, T. (1975 8 ). Kompendium der Psychiatrie. Basel: Karger.<br />
Dörner, K. & Plog, U. (1982). Irren ist menschlich oder Lehrbuch der<br />
Psychiatrie/Psychotherapie. Rehburg-Loccum: Psychiatrie-Verlag.<br />
Weltgesundheitsorganisation (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-<br />
10, Kapitel V (F). Herausgegeben von H. Dilling, W. Mombour & M.H. Schmidt. Huber: Bern.<br />
Vorbemerkung: Mit der ICD-10 wurde die Klassifikation der psychischen Störungen radikal verändert<br />
und die frühere Klassifikation aufgegeben. Auf eine Darstellung der Systematik kann hier<br />
verzichtet werden. Gleichwohl existieren in der Klinik eine Reihe von Begriffen und Syndromen,<br />
die man kennen sollte.<br />
Delir: Bewußtseinstrübung, Desorientiertheit, Halluzinationen, wahnhafte Ideen (z.B. Delirium<br />
tremens = bei Alkoholismus, Fieberdelirium).<br />
Dämmerzustand: traumhafte Bewußtseinseinengung (z.B. epileptischer Dämmerzustand).<br />
Benommenheit: Verschiedene Grade von Somnolenz (= krankhafte Schläfrigkeit) bis zum Koma (z.B.<br />
Infektionspsychosen).<br />
Durchgangssyndrome: kennzeichnen den Beginn bzw. Rückbildung einer hirnorganischen Schädigung<br />
(z.B. depressives Syndrom).
59<br />
Apallisches Syndrom: Nimmt eine Sonderstellung unter den Folgezuständen nach Hirntrauma ein.<br />
Funktionelle Trennung von Hirnstamm und Hirnmantel (= Pallium), bedeutet Dezerebration.<br />
Symptome: Rigor, Spastik, Krämpfe, orale Automatismen (z.B. Leerlaufsaugbewegungen).<br />
Körperliche Ursachen von Störungen der Hirnfunktion:<br />
Frühkindliche Hirnschäden: Ursachen: Intrauterin (z.B. mangelnde Sauerstoffversorgung),<br />
geburtstraumatisch (z.B. Stauung der Hirnnerven unter der Geburt mit Hirnödem), postnatal<br />
(meist Infektionskrankheiten). Symptome: Motorische Defekte, Intelligenzdefekte; bei<br />
leichtgradigen Schädigungen Stimmungslabilität, Distanzstörungen, Schwererziehbarkeit,<br />
Stottern, Enuresis. Leichte Schäden sind oft nur schwer diagnostisch zu sichern.<br />
Körperkrankheiten mit Hirnbeteiligung: Infektionskrankheiten (z.B. Pneumonie, Typhus),<br />
Herzkrankheiten (bedingen Hypoxie des Gehirns). Hierher gehören auch die endokrinen<br />
Psychosyndrome (= psychische Störungen bei Erkrankungen der endokrinen Drüsen, z.B.<br />
Hyperthyreose mit Übererregbarkeit, Unruhe und Stimmungsschwankungen).<br />
Ernährungsmängel: Hungerdystrophien (aufgrund von Eiweißmangel kommt es zu Ödemen) in<br />
Kriegszeiten, etc. können zu einer Funktionsstörung des Gehirns führen.<br />
Postoperative Störungen: Meist akut. Ursachen: Blutverlust, Elektrolytstörungen, Infektionen,<br />
Narkose, mangelhafte präoperative Vorbereitung (Angst, mangelnde Bearbeitung der<br />
Operationsfolgen).<br />
Akute und chronische Vergiftungen: Medikamente (z.B. Corticosteroide, Antibiotika,<br />
Tuberkulostatika), industrieübliche Lösungsmittel, Schwermetalle (vor allem Blei),<br />
Kohlenmonoxid und Leuchtgas, Drogenabhängigkeit, Alkoholismus. Alle genannten Ursachen<br />
können zu akuten oder chronischen Störungen der Hirnfunktion führen.<br />
Entzündliche Hirnkrankheiten: Früher vor allem die Syphilis (Lues), seit 1943 mit Penicillin gut zu<br />
behandeln, Tendenz in jüngster Zeit wieder steigend. Nach dem zeitlichen Ablauf unterscheidet<br />
man frühluische Meningitis (wenig auffällige Symptome), Lues cerebrospinalis (3 - 5 Jahre nach<br />
Infektion, Erweichungsherde im Gehirn durch Gefäßverschlüsse) und progressive Paralyse<br />
(chronische Encephalitis mit Rindenatrophie) oft zusammen mit Tabes dorsalis (Degeneration<br />
der Hinterwurzeln des Rückenmarks mit sensiblen Ausfallserscheinungen). - Heute praktisch<br />
wichtig die Meningitis (Hirnhautentzündung) oft kombiniert mit Encephalitis (Hirnentzündung).<br />
Ursachen: Viren, Bakterien, Mittelohrentzündung, offene Hirnverletzung. Symptome:<br />
Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen, Bewußtseinstrübung. - Multiple Sklerose:<br />
Entmarkungsschäden im gesamten ZNS. Verlauf sehr wechselnd. Folgen: Sehschwäche,<br />
Lähmungen, Blasenstörungen.<br />
Traumatische Hirnschäden: Bei der Commotio (Hirnerschütterung) anatomisch nicht faßbare<br />
Hirnschädigung ohne Dauerfolgen; meist durch stumpfe Gewalteinwirkung. Symptome:<br />
Bewußtlosigkeit (kurzdauernd), retrograde und anterograde Amnesie (keine Erinnerung an eine<br />
kurze Zeit vor und nach dem Unfall), Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Durchgangssyndrom.<br />
Contusio (Hirnquetschung) anatomisch faßbar mit Rindenprellungsherd am Ort der<br />
Gewalteinwirkung und am Gegenpol (contre-coup), Hirnödem und Zirkulationsstörungen.<br />
Symptome: Längere Bewußtlosigkeit, längere Amnesie, Krämpfe, Blutungen aus<br />
Schädelöffnungen, akut-organisches Psychosyndrom („Contusionspsychose“). Als Folge häufig
traumatische Epilepsie.<br />
Hirnhautblutungen: Beim Epiduralhämatom Blutansammlung zwischen Hirnhaut und<br />
Schädelkalotte durch Verletzung der Meningealarterien, beim subduralen Hämatom venöse<br />
Sickerblutung (weniger dramatisch). Auslösendes Trauma bei vorgeschädigten Gefäßen oft<br />
gering, typisch das sog. „freie Intervall“ nach der Initialsymptomatik, danach schnelle<br />
Verschlechterung des Zustandes. Kompression einer Hirnhälfte mit Einklemmen des<br />
Hirnstamms durch die Blutung (Kreislauf- und Atemzentrum in der Medulla oblongata!).<br />
Therapie: Schädeltrepanation.<br />
Hirntumoren: Diese raumfordernden Prozesse bedingen Herdsymptome (unterschiedliche Ausfälle, s.<br />
„Großhirnzentren“) bzw. Massenverschiebungen (Einklemmen des Hirnstamms). Symptome:<br />
Kopfschmerzen, häufig epileptische Anfälle, Persönlichkeitsveränderungen.<br />
Hirngefäßkrankheiten: Synonyme Cerebralsklerose, Hirnarteriosklerose. Häufigste Ursache von<br />
Störungen der Hirnfunktion, vor allem im Alter. Es kommt zu Ischämie mit Zerfall von<br />
Hirnsubstanz. Symptome: Schwindel, Ohrensausen, Schlafumkehr, Verwirrtheitszustände. Meist<br />
erhöhter Blutdruck. In diesem Zusammenhang auch häufig apoplektischer Insult (Schlaganfall).<br />
Hirngewebskrankheiten: Hirnatrophische Prozesse verschiedener, hier nicht spezifizierter Ursache.<br />
Folge: Präsenile und senile Demenz. Symptome: Merkschwäche (Altgedächtnis intakt),<br />
Wortfindungsstörungen, Urteilsschwäche, Desorientiertheit.<br />
Epilepsie: Charakterisiert durch wiederholte Anfälle, psychische Veränderungen und pathologische<br />
Abläufe im EEG. Zwei Hauptformen: Genuine Epilepsie (erbliche Belastung scheint<br />
Hauptursache zu sein) und symptomatische Epilepsie (z.B. Hirntumor, traumatische<br />
Hirnschädigung).<br />
Kleinere epileptische Anfälle: Bevorzugt in einem bestimmten kindlichen oder jugendlichen<br />
Lebensalter, gebunden an verschiedene Reifungsstadien des Gehirns. Z.B. Blitz-Nick-Salaam-<br />
Krämpfe (BNS, in den ersten 3 Lebensjahren; Vorwärtsbewegung des Kopfes, Einschlagen der<br />
Arme; Bewußtseinstrübung; meist als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung) und<br />
Pyknolepsie (= Petit Mal, 6. - 10. Lebensjahr; indifferente Absence; kein Hinstürzen; gehört zur<br />
genuinen Epilepsie).<br />
Großer epileptischer Anfall (= Grand Mal): Häufig durch Aura (halluzinatorische<br />
Wahrnehmungen) eingeleitet; Hinstürzen mit Verletzungsgefahr, tonische Krampfstadien gefolgt<br />
von rhythmisch klonischen Zuckungen, Terminalschlaf.<br />
Allgemeine psychische Veränderungen: Im Denken und Handeln langsam, umständlich,<br />
weitschweifig, affektiv monoton mit Neigung zu explosiven Ausbrüchen, Neigung zu<br />
überwertigen Ideen.<br />
60<br />
Physiologische Grundlagen von Drogenabhängigkeit und Alkoholismus<br />
Literatur: Spoerri (s.o.), Dörner & Plog (s.o.), WHO (s.o.) und Bösel, R. (1981). Physiologische<br />
Psychologie. Berlin: de Gruyter.
Drogenabhängigkeit (WHO): Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung durch ein<br />
zentralnervös wirkendes Mittel, der zu seelischer oder seelischer und körperlicher Abhängigkeit<br />
von diesem Mittel führt und der das Individuum und/oder die Gesellschaft schädigt.<br />
Die ICD-10 listet die folgenden Störungen auf:<br />
F 1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen<br />
F 10 Störungen durch Alkohol<br />
F 11 Störungen durch Opioide<br />
F 12 Störungen durch Cannabinoide<br />
F 13 Störungen durch Sedativa oder Hypnotika<br />
F 14 Störungen durch Kokain<br />
F 15 Störungen durch andere Stimulantien einschließlich Koffein<br />
F 16 Störungen durch Halluzinogene<br />
F 17 Störungen durch Tabak<br />
F 18 Störungen durch flüchtige Lösungsmittel<br />
F 19 Störungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper<br />
Substanzen<br />
Hier sollen nur ein paar besonders wichtige Störungen genannt werden.<br />
Typ Morphin: Opium, gewonnen aus den Kapseln des Schlafmohns, besteht aus einer Mischung<br />
verschiedener Opiatsubstanzen. Hauptwirkstoff ist das Morphin. Härteste Droge ist das Heroin,<br />
andere Opiate in Hustenmitteln (Kodein). Wirkort: Limbisches System, neuronale Schmerzfilter<br />
des Rückenmarks (Afferenzen von Schmerzrezeptoren werden nicht weitergeleitet). Wirkung:<br />
Euphorie, nach 1 - 4 Std. Verstimmungszustand. Starke Dosissteigerung erforderlich durch<br />
Toleranz (= zelluläre Gewöhnung, beschleunigter Abbau, verzögerte Resorption), starke<br />
Entzugssymptome (Bauch- und Gliederschmerzen). Folgen: Beschaffungskriminalität, Hepatitis<br />
und AIDS (verunreinigte Spritzen), Infektionsanfälligkeit, Tod durch Überdosierung.<br />
Rückfallquote oft 100 %. Chance nur in Therapieketten unter rigoroser Aufsicht.<br />
Typ Cocain: Vorkommen in den Blättern des Coca-Strauches. Konsum durch Kauen der Blätter (=<br />
Cocaismus, bei peruanischen Indianern; relativ ungefährlich, da nur eine anregende Substanz<br />
aufgenommen wird) und Spritzen bzw. Schnupfen (= Cocainismus, hierbei wird Cocain<br />
wirksam). Cocain erzeugt starke Abhängigkeit, hohe Dosissteigerung. Anstieg unspezifischer<br />
Aktivierung durch die Formatio reticularis. Wirkung: Bei erster Dosis Angstzustand; später<br />
anregend mit subjektivem Gefühl der Leistungssteigerung, nach ca. 60 Minuten Mißmut mit<br />
Depressionen. Abstinenzsymptome: Schlaflosigkeit, Herzklopfen, Angstsymptome.<br />
Typ Cannabis: Vorkommen in den Blütenspitzen von Hanfpflanzen. Harz der Blütenspitzen =<br />
Haschisch, getrocknete Blüten und Blätter = Marihuana. Beides kann geraucht werden. Wirkstoff<br />
Cannabinol. Wirkung auf das limbische System und die Formatio reticularis.<br />
Wahrnehmungseinschränkung mit Übersteigerung einzelner Reize (Illusionen), euphorische<br />
Grundstimmung, Dauer des Rauschzustandes ca. 2 Std. Körperliche Gefahren: Entzündung von<br />
Mund, Hals und Bindehaut durch Austrocknen, Kreislaufbelastung, hoher Teergehalt der<br />
Hanfblätter, Zyklusstörungen, Störungen der Spermienproduktion. Cannabis wird häufig als<br />
Einstiegsdroge angesehen.<br />
Typ Amphetamin: Alle Weckamine sind mit Amphetamin und dieses wiederum mit Adrenalin<br />
chemisch verwandt. Gehandelt werden Weckamine (z.B. Captagon) und Appetitzügler (z.B.<br />
Ritalin). Wirkung: Stimulation der Formatio reticularis mit Erregung des Cortex, Unterdrückung<br />
61
der Müdigkeit, Erhöhung der Aufmerksamkeit, Unterdrückung des Hungers. Je nach Dosis<br />
Wirkung zwischen 1 - 8 Std., gefolgt von bleierner Müdigkeit. Leistungen quantitativ<br />
beeindruckend, qualitativ unterdurchschnittlich. Hohe Toleranz, die starke Dosissteigerungen<br />
nötig macht. Mißbrauch führt zu Schlaflosigkeit und Verfolgungsvorstellungen.<br />
Typ Barbiturate/Alkohol: Barbiturate, Analgetika und Alkohol haben ähnliche Intoxikations- und<br />
Abstinenzsymptome. Alkohol wirkt wie andere Beruhigungsmittel unspezifisch dämpfend im<br />
ZNS. An den Neuronen wird durch Hyperpolarisation die Erregungsschwelle heraufgesetzt. Bei<br />
geringen Dosen: Hautrötung, aufsteigende Wärme, Wohlbefinden, Störung der Augenmotorik.<br />
Bei höheren Dosen: Störungen der Sprachmotorik, motorische Koordinationsstörungen,<br />
Aufmerksamkeitsmängel, herabgesetzte Schmerzempfindung. Bei mehr als 2 %o: Reduktion der<br />
corticalen Selbstkontrolle, Störung von Atem- und Kreislaufzentren, Koma. Folgen des<br />
chronischen Alkoholkonsums: Abbau von Hirnsubstanz durch Einschränkung der O 2 -<br />
Versorgung, Leberschäden, Herzschäden, Alkoholpsychosen (Delirium tremens,<br />
Alkoholhalluzinose, Korsakow-Syndrom). Delirium tremens: Bewußtseinstrübung,<br />
Desorientiertheit, Bewegungsdrang, Halluzinationen („weiße Mäuse“), Tremor; Behandlung mit<br />
Distraneurin. Alkoholhalluzinose: Gehörshalluzination bei ungestörtem Bewußtsein. Korsakow-<br />
Syndrom: Merkfähigkeitsstörungen, Desorientiertheit, Neigung zu Konfabulationen, entwickelt<br />
sich aus dem Delirium tremens.<br />
Typ Halluzinogene: Chemische Grundstruktur aller Halluzinogene ist der Indolring. Vorkommen: LSD<br />
(1943 synthetisiert), Mescalin (mexikanisches Kaktusgift). Wirkung auf das limbische System<br />
und die Formatio reticularis. Nach Injektion von LSD bzw. Aufnahme durch den Mund tritt<br />
zunächst eine Katerphase mit Brechreiz auf, später tritt der „psychedelische Zustand“ mit Farbund<br />
Formvisionen ein. Diese Halluzinationen sind stimmungsabhängig; es handelt sich um eine<br />
Neubewertung von Sinneseindrücken. Keine Abstinenzerscheinungen, keine körperliche<br />
Abhängigkeit, keine eindeutigen körperlichen Schäden. Allerdings ist die Auslösung<br />
psychotischer Phasen (Typ Schizophrenie) möglich.<br />
Typ Khat: Vorkommen in der Khat-Pflanze (Äthiopien). Wird als Tee genossen. Pharmakologisch mit<br />
den Weckaminen verwandt. Ähnliche Symptomatik wie beim Amphetamin, jedoch schwächer.<br />
62<br />
Physiologisch-biochemische Wirkungen von Psychopharmaka<br />
Literatur: Linden, M. & Manns, M. (1977). Psychopharmakologie für Psychologen. Salzburg: Müller.<br />
Psychotrope Pharmaka: „Psychopharmaka im weiteren Sinne“. Es handelt sich um Substanzen, die<br />
eine obligatorische Wirkung auf die Psyche haben. Die folgende Einteilung entspricht der<br />
Hauptwirkung:<br />
(01) Analgetika = Schmerzmittel: Schmerzhemmend, entzündungshemmend.
(02) Hypnotika = Schlafmittel: In geringen Dosen sedativ-beruhigend, in mittleren Dosen<br />
schlaffördernd, in hohen Dosen narkotisch = betäubend.<br />
(03) Narkotika = Narkosemittel: Bewirken reversiblen Bewußtseinsverlust, Schmerzfreiheit,<br />
Erschlaffung der Muskulatur.<br />
(04) Antiemetika = Anti-Brechmittel: Verhindern Erbrechen in Zusammenhang mit<br />
Bewegungskrankheiten (Kinetosen).<br />
(05) Antiepileptika: Setzen die Krampfschwelle des ZNS herauf.<br />
(06) Analeptika: Wirken zentral erregend, z.B. Anregung des Atemzentrums, in höheren Dosen<br />
Krampfgifte.<br />
(07) Psychoanaleptika: Allgemeine Anregung psychischer Funktionen, z.B. Amphetamin, Coffein.<br />
(08) Euphorika: Erhöhen die Stimmungslage.<br />
(09) Psychodysleptika = Psychotomimetika = Halluzinogene: Erzeugen psychoseähnliche Zustände mit<br />
Halluzinationen (z.B. LSD).<br />
(10) Antidepressiva: Zur Therapie bei Depressionen.<br />
(11) Neuroleptika = Major tranquilizer: Zur Behandlung psychischer Zustände vorwiegend aus dem<br />
schizophrenen Formenkreis.<br />
(12) Tranquilizer = Sedativa = Minor tranquilizer: Dämpfung von Angst- und Spannungszuständen.<br />
Antidepressiva, Neuroleptika und Tranquilizer bilden die Gruppe der „Psychopharmaka im<br />
engeren Sinne“, die vorwiegend in der Psychiatrie eingesetzt werden.<br />
Neuroleptika: Beeinflussen schizophrene Zustandsbilder positiv. Substanzklassen: Butyrophenon-<br />
Derivate (z.B. Haldol, vorrangig antipsychotische Wirkung bei geringer Sedierung) und<br />
Phenothiazin-Derivate (z.B. Psyquil; diese Derivate lassen sich in 3 chemische Untergruppen<br />
gliedern, die je nach Seitenkette mehr sedierend oder mehr antipsychotisch wirken).<br />
Wirkungsmechanismus: Phenothiazine und Butyrophenone führen zu einer Verminderung von<br />
Dopamin (Vorstufe von Adrenalin und Noradrenalin, dient selbst auch als Transmitter) an den<br />
Dopamin-Rezeptoren der subsynaptischen Membran durch Blockierung der Rezeptoren.<br />
Allerdings ist noch offen, ob dieser Mechanismus die psychischen Wirkungen erklären kann.<br />
Fest steht jedoch, daß die Neuroleptika die Wirkungen von Psychodysleptika (LSD im Rahmen<br />
der sog. Modellpsychose) antagonistisch beeinflussen.<br />
Nebenwirkungen: Extrapyramidale Symptome: Störungen des Bewegungsablaufs, Erhöhung des<br />
Muskeltonus (neuroleptisch bedingter Parkinsonismus); vegetative Symptome:<br />
Blutdrucksenkung, Übelkeit.<br />
Antidepressiva: Trizyklische Antidepressiva (chemische Formel besteht aus 3 Ringen, wichtigste<br />
Gruppe, Beispiel Laroxyl), tetrazyklische Antidepressiva (4 Ringe, Beispiel Ludiomil),<br />
Monoaminooxydase-Hemmer (Beispiel Jatrosom) und Lithiumsalze. Trizyklische und<br />
tetrazyklische Antidepressiva haben vor allem stimmungsaufhellende Wirkung (Thymoleptika),<br />
MAO-Hemmer wirken vorwiegend antriebssteigernd (Thymeretika).<br />
Wirkungsmechanismus: Diskutiert wird die Aminmangel-Hypothese. Antidepressiva verhindern<br />
den Abbau der aus den praesynaptischen Speichern freiwerdenden Neurotransmitter. MAO-<br />
Hemmer blockieren dabei die Mono-Amin-Oxydase, die die Neurotransmitter abbaut; die<br />
trizyklischen Antidepressiva blockieren den Rücktransport der Neurotransmitter aus dem<br />
synaptischen Spalt in die Speicher. Dadurch steigt die Konzentration der Neurotransmitter im<br />
synaptischen Spalt.<br />
Nebenwirkungen: Psychische Nebenwirkungen: Erhöhung der Suizidalität vor allem bei primär<br />
antriebssteigernden Antidepressiva. Vegetative Symptome: Störung der Speichelsekretion.<br />
63
Tranquilizer: Indikation bei neurotischen Störungen mit deutlicher Angstkomponente (z.B.<br />
Gespanntheit, Angst, Unruhe, hypochondrische Beschwerden, Phobien etc.). Wichtigste Gruppe<br />
die Benzodiazepine (z.B. Librium, Valium).<br />
Wirkungsmechanismus: Wirkungsort das limbische System, das für die affektive Färbung des<br />
Gesamtverhaltens verantwortlich ist. Spontanaktivität des limbischen Systems bleibt<br />
unbeeinflußt, überschießende Erregung wird jedoch abgebremst.<br />
Nebenwirkungen: Schwindel, Benommenheit, Übelkeit. Abhängigkeit ist bei chronischer<br />
Einnahme möglich.<br />
64<br />
Überblick über den Stoff der Vorlesung im Winter-Semester<br />
Entsprechend dem Vorlesungsmanuskript:<br />
Definition der Biologischen Psychologie;<br />
Anatomischer Aufbau des menschlichen Organismus;<br />
Zellen, Gewebe und Organe;<br />
Menschliche Ontogenese;<br />
Grundlagen der Humangenetik und Erbpsychologie;<br />
Grundlagen der Verhaltensbiologie;<br />
Funktion des Blutes;<br />
Funktion des Herzens;<br />
Gefäßsystem;<br />
Atmung;<br />
Energiehaushalt;<br />
Wärmehaushalt;<br />
Ernährung;<br />
Funktion des Magen-Darm-Kanals;<br />
Nierenfunktion<br />
Allgemeine Endokrinologie;<br />
Hypothalamisch-hypophysäres System;<br />
Nebennierenrinde und Glucocorticoide;<br />
Hormone der Schilddrüse;<br />
Keimdrüsen und Sexualhormone;<br />
Sympathico-adrenales System;<br />
Pankreashormone und Blutzuckerregelung;<br />
Hormonale Regulation des Mineralhaushaltes;<br />
Grenzbereiche des endokrinen Systems.<br />
Literatur:<br />
Schmidt, R.F. (Hrsg.) (1987 6) . Grundriß der Neurophysiologie. Berlin: Springer.<br />
Schmidt, R.F. (Hrsg.) (1985 5) Grundriß der Sinnesphysiologie. Berlin: Springer<br />
Beide Bücher sind vergriffen und werden nicht mehr aufgelegt. Ersetzt wurden sie durch:<br />
Schmidt, R.F., (Hrsg.) (1998) Neuro- und Sinnesphysiologie. Berlin: Springer.
Die alten Bücher sind didaktisch wesentlich besser, vor allem die Abbildungen. Zudem werden<br />
grundlegende Tatsachen, z.B. die Hirnnerven, nicht mehr vernünftig abgehandelt. Wer sich die<br />
alten Bücher noch besorgen kann, sollte danach lernen.<br />
Aufbau des Nervensystems:<br />
Die Nervenzellen: Neurone; Synapsen; Effectoren; Rezeptoren.<br />
Stütz- und Ernährungsgewebe: Aufgaben der Gliazellen; Interstitium.<br />
Die Nerven: Die Nervenfasern; Funktionelle Klassifikation der Nervenfasern; Klassifikation der<br />
Nerven; axonaler Transport.<br />
Erregung von Nerv und Muskel:<br />
Das Ruhepotential: Messung des Membranpotentials; Ursache des Ruhepotentials;<br />
Konzentrationsverteilung der Ionen; Die K + -Ionen und das Ruhepotential; Beteiligung der Cl - -<br />
Ionen am Ruhepotential.<br />
Ruhepotential und Na + -Einstrom: Abhängigkeit des Ruhepotentials von der Kaliumkonzentration; Die<br />
Membranleitfähigkeit für K + und Na + ; Instabilität des Ruhepotentials bei passiven Ionenstömen.<br />
Die Natriumpumpe: Messung des aktiven Transportes; Die gekoppelte Na + -K + -Pumpe; Übersicht über<br />
die Ionenströme durch die Membran.<br />
Das Aktionspotential: Zeitverlauf der Aktionspotentiale; Auslösung des Aktionspotentials und<br />
Erregung; Definition des Aktionspotentials; Die Ionenverschiebungen während des<br />
Aktionspotentials; Ionenumsätze während des Aktionspotentials; Das Aktionspotential im Na + -<br />
Mangel.<br />
Kinetik der Erregung: Änderungen der Membranleitfähigkeiten nach einer Depolarisation;<br />
Refraktärphasen nach dem Aktionspotential; Der Membrankanal für Na + .<br />
Elektrotonus und Reiz: Unter- und überschwellige Reize; Minimaler Reizstrom und Reizzeit.<br />
Fortleitung des Aktionspotentials: Leitungsgeschwindigkeit des Aktionspotentials; Mechanismus der<br />
Fortleitung; Faktoren die die Leitungsgeschwindigkeit beeinflussen, saltatorische Leitung.<br />
Synaptische Übertragung:<br />
Die Neuromuskuläre Endplatte: Beispiel einer chemischen Synapse: Bauelemente chemischer<br />
Synapsen; Die Endplatte; Nachweis des Endplattenpotentials; Mechanismus der<br />
neuromuskulären Übertragung; Die Natur des Endplattenpotentials; Das Schicksal des<br />
Acetylcholins; Neuromuskuläre Blockade.<br />
Die Quantennatur der chemischen Übertragung: Miniatur-Endplattenpotentiale; Freisetzung in<br />
Quanten; Steuerung der Überträgersubstanzfreisetzung durch das praesynaptische<br />
Aktionspotential; Beteiligung des Calciums; Verallgemeinerung der Quantenhypothese.<br />
Zentrale erregende Synapsen: Erregende postsynaptische Potentiale. EPSP; Ionenmechanismus des<br />
EPSP; Die Auslösung des Aktionspotentials; Elektrische Synapsen.<br />
Zentralnervöse hemmende Synapsen: Inhibitorische postsynaptische Potentiale im Motoneuron;<br />
Ionenmechanismus des IPSP; Hemmende Wirkungen des IPSP; Praesynaptische Hemmung.<br />
Überträgerstoffe chemischer Synapsen: Allgemeine Gesichtspunkte; Acetylcholin als<br />
Übertägersubstanz im Nervensystem; Adrenerge Überträgersubstanzen; Aminosäuren als<br />
Überträgersubstanzen.<br />
65
Überblick über den Stoff der Vorlesung im Sommer-Semester<br />
66<br />
Entsprechend dem Vorlesungsmanuskript:<br />
Gehirnanatomie<br />
Literatur:<br />
Schmidt, R.F. (Hrsg.) (1987 6 ) Grundriß der Neurophysiologie. Berlin: Springer (siehe Bemerkung<br />
oben).<br />
Aufbau des Nervensystems:<br />
Der Aufbau des Rückenmarks: Aufbau der Rückenmarkssegmente; Rückenmarkswurzeln.<br />
Physiologie kleiner Neuronenverbände, Reflexe:<br />
Typische neuronale Verschaltungen: Divergenz; Konvergenz; Zeitliche und räumliche Bahnung;<br />
Occlusion; Einfache hemmende Schaltkreise; Fördernde Mechanismen: positive Rückkopplung<br />
und synaptische Potenzierung.<br />
Der monosynaptische Reflexbogen: Definition des Reflexbegriffs; Die Muskelspindel; Der<br />
monosynaptische Dehnungsreflex; Funktion der intrafusalen Muskelfasern.<br />
Polysynaptische motorische Reflexe: Beispiele polysynaptischer motorischer Reflexe; Eigenschaften<br />
polysynaptischer Reflexe; Motorische und vegetative polysynaptische Reflexe; Angeborene und<br />
erworbene Reflexe.<br />
Der Muskel:<br />
Die Kontraktion des Muskels: Isotonische und isometrische Kontraktion; Zeitverlauf der<br />
Einzelzuckung; Feinstruktur des Skelettmuskels; Verschiebungen der Aktin- und<br />
Myosinfilamente während der Kontraktion; Molekularer Mechanismus der Kontraktion;<br />
Herzmuskulatur und glatte Muskulatur.<br />
Abhängigkeit der Muskelkontraktion von Faserlänge und Verkürzungsgeschwindigkeit:<br />
Ruhedehnungskurve; Die Kurve der isometrischen Kontraktionsmaxima; Kontraktionskraft und<br />
Verkürzungsgeschwindigkeit; Summation von Einzelzuckungen, Tetanus; Mechanismus der<br />
Summation.<br />
Regulation der Kontraktion eines Muskels: Summation der Kontraktion mehrerer Fasern; Erzeugung<br />
der maximalen Muskelkraft; Die motorische Einheit, das Elektromyogramm.<br />
Motorische Systeme:<br />
Spinale Motorik I: Aufgaben der Muskelspindeln und Sehnenorgane: Aufbau und Lage von<br />
Muskelspindel und Sehnenorgan; Entladungsmuster der Muskelspindeln und Sehnenorgane;<br />
Dehnungsreflex und reziproke antagonistische Hemmung; Aufgaben der Gamma-Schleife;<br />
Segmentale Verschaltung der Ib-Fasern, Aufgaben der Golgi-Organe.<br />
Spinale Motorik II: Polysynaptische motorische Reflexe: Flexorreflex und gekreuzter Extensorreflex;<br />
Intersegmentale Reflexbögen; Leistungen des isolierten Rückenmarks.<br />
Funktionelle Anatomie supramedullärer motorischer Zentren: Supraspinale motorische Zentren,<br />
Benennung, Lage im ZNS; Der Tractus cortico-spinalis; Corticale motorische Efferenzen zum<br />
Hirnstamm.
Reflektorische Kontrolle der Körperstellung im Raum: Anteile des Hirnstammes und ihre Zuflüsse;<br />
Querschnittsdurchtrennungen im Hirnstamm; Motorische Leistungen des decerebrierten Tieres,<br />
Haltereflexe; Motorische Leistungen des Mittelhirntieres, Stellreflexe; Statische und<br />
statokinetische Reflexe.<br />
Funktionen der Basalganglien, des Kleinhirns und des motorischen Cortex: Die Rolle der<br />
Basalganglien; Die Rolle des Kleinhirns; Pathophysiologie der Basalganglien; Pathophysiologie<br />
des Kleinhirns; Die Rolle des motorischen Cortex; Pathophysiologie des motorischen Cortex und<br />
seiner Efferenzen; Handlungsantrieb und Bewegungsentwurf.<br />
Vegetatives Nervensystem:<br />
Funktionelle Anatomie des peripheren vegetativen Nervensystems: Peripherer Sympathicus; Peripherer<br />
Parasympathicus; Darmnervensystem; Viscerale Afferenzen.<br />
Acetylcholin, Noradrenalin und Adrenalin: Acetylcholin, nicotinerge und muscarinerge Übertragung;<br />
Noradrenalin, Adrenalin, α-ß-Rezeptoren-Konzept; Nebennierenmark; Sonstige<br />
Überträgersubstanzen im peripheren vegetativen Nervensystem.<br />
Glatter Muskel: Myogene Aktivität, Reaktion auf Dehnung, Acetylcholin und Adrenalin: Myogene<br />
Aktivität; Zeitverlauf der Kontraktion der glatten Muskulatur; Kraftentwicklung glatter Muskeln<br />
auf Dehnung; Neuromuskuläre Übertragung im glatten Muskel.<br />
Antagonistische Wirkungen von Sympathicus und Parasympathicus auf vegetative Effectoren:<br />
Vegetative Beeinflussung des Herzens; Beeinflussung der Darmmuskulatur durch das vegetative<br />
Nervensystem.<br />
Zentralnervöse Regulation: Spinaler Reflexbogen, Blasenregulation: Der spinale vegetative<br />
Reflexbogen; Segmentale Verschaltung vegetativer Efferenzen mit visceralen und somatischen<br />
Afferenzen; Neuronale Regulation der Harnblasenentleerung.<br />
Zentralnervöse Regulation: Arterieller Blutdruck, Regulation der Muskeldurchblutung: Regelung des<br />
arteriellen Blutdruckes; Regelung der Organdurchblutung während Muskelarbeit.<br />
Der Hypothalamus. Die Regulation von Körpertemperatur, Osmolarität des Extracellulärraumes und<br />
endokrinen Drüsen: Anatomie des Hypothalamus; Regulation der Körpertemperatur; Regelung<br />
der endokrinen Drüsen durch den Hypothalamus; Regelung der Osmolarität (des Wassergehaltes)<br />
des Extracellulärraumes.<br />
Literatur:<br />
Vaitl, D. (1978). Entspannungstechniken. In: L.J. Pongratz (Hrsg.), Klinische Psychologie (= K.<br />
Gottschaldt et al. (Hrsg.) Handbuch der Psychologie) Band 8/2 (S. 2104-2143). Göttingen:<br />
Hogrefe.<br />
VNS und Entspannungstechniken:<br />
Folgen einer Stimulation der trophotropen Zonen im Hypothalamus;<br />
Physiologische Veränderungen während der Entspannungsreaktion;<br />
Physiologische Veränderungen beim autogenen Training (Unterstufen-Übung);<br />
Klinische Einsatzmöglichkeiten des autogenen Trainings;<br />
Wirkung der transzendentalen Meditation auf das EEG.<br />
67
68<br />
Literatur:<br />
Birbaumer, N. & Schmidt, R.F. (2002 5 ). Biologische Psychologie. Berlin: Springer.<br />
Methoden der Biologischen Psychologie:<br />
Elektro- (EEG) und Magnetenzephalogramm (MEG): Geschichte und Definition; EEG-Rhythmen; Die<br />
Regularität der EEG-Wellen; Synchronisation und Spontan-EEG; Postinhibitorische Endladung<br />
thalamischer Neurone; Frequenzspektren und Amplitude; Fourier-Analyse; Interpretation des<br />
EEGs; Klinisches EEG.<br />
Ereigniskorrelierte Hirnpotentiale (EKP): Definition; Mittelungstechnik; Identifikation der<br />
Komponenten; Exogene und endogene Komponenten; Skopeutische Verarbeitung;<br />
Komponenten und Topographie; Informationsverarbeitung und EKP.<br />
Bewußtsein und Aufmerksamkeit:<br />
Psychologie der Bewußtseinsformen: Heterogene Bewußtseinsprozesse; Bewußtsein als<br />
Schwellenregulation; Bewußtsein und Kurzzeitgedächtnis; Begrenzte Aufmerksamkeit und<br />
Bewußtsein; Subliminale Wahrnehmung; Arbeitsgedächtnis; Flaschenhalstheorien; Kritik der<br />
Filtertheorie; Orientierung und Habituation; Habituation; Allgemeine Kennzeichen von<br />
Habituation; Automatische und kontrollierte Verarbeitung; Willentliche Anstrengung;<br />
Ressourcen-Zuordnung.<br />
Neuropsychologie der Bewußtseinsformen: Geschichte der Split-brain-Forschung; Aktiver<br />
Übertragungsmechanismus; Zwei getrennte Willensimpulse; Zwei Bewußtseinsprozesse; LP und<br />
kontrollierte Aufmerksamkeit; Ressourcen-Bereitstellung; LP und die Entstehung bewußter<br />
Willenshandlungen.<br />
Unspezifische Aktivierungssysteme: Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem (ARAS);<br />
Neurophysiologie tonischer und phasischer Aktivierung; Thalamokortikales „Gating“.<br />
Psychophysiologie selektiver Aufmerksamkeit: Anatomie des LCCS; Funktion und Dynamik des<br />
LCCS.<br />
Literatur:<br />
Fahrenberg, J. (1979 2 ). Psychophysiologie. In: K.P. Kisker et al. (Hrsg.), Psychiatrie der Gegenwart,<br />
Bd. I/1. (S. 109-125). Berlin: Springer.<br />
Aktivierungstheorien: Synergismenlehre von Hess; Organismische Aktivations-Theorie von Duffy;<br />
Zweifaktorielles Modell der biologischen Basis der Persönlichkeit von Eysenck; Prinzip der<br />
richtungsabhängigen funktionalen Fraktionierung von Lacey.<br />
Streßtheorien: Streßkonzept von Selye; Notfallfunktion von Cannon; Streß-Schwellenmodell von<br />
Cofer und Appley; Kognitives Streßmodell von Lazarus.<br />
Spezifitätsproblem: Individualspezifische Reaktionsmuster; Stimulusspezifische Reaktionsmuster.<br />
Literatur:<br />
Birbaumer, N. & Schmidt, R.F. (1999 4 ). Biologische Psychologie. Berlin: Springer.<br />
Zirkadiane Periodik, Schlaf und Traum:
Schlaf und Traum: Die Klassifikation der Schlafstadien; Verlauf einer Nacht; Tiefschlaf vor<br />
Traumschlaf; Augenbewegungen; Motorische Begleiterscheinungen des REM-Schlafes;<br />
Weckschwelle und Zustand sensorischer Systeme; Evolution; Ontogenie.<br />
Psychophysiologie der Schlafstadien: Schlafdeprivation; REM-Schlaf-Entzug; Psychisches Erleben<br />
während REM- und NREM-Schlaf; Traumberichte innerhalb einer Nacht; Methodische<br />
Probleme der Schlaf-Gedächtnisforschung; „Lernen im Schlaf“; Lernen im Schlaf beim<br />
Menschen; Psychoanalyse.<br />
Schlafstörungen: Primäre Schlafstörungen; Idiopathische Insomnia; Verzögertes Einschlafen; Drogen-<br />
Insomnia; Insomnia bei Verhaltensstörungen; Schlaf-Apnoe; Somnambulismus und andere<br />
Störungen des SWS.<br />
Plastizität, Lernen, Gedächtnis:<br />
Psychologie von Lernen und Gedächtnis: Gedächtnissysteme; Implizites versus explizites Lernen und<br />
Gedächtnis; Assoziatives und nicht-assoziatives Lernen; Akquisition (Aneignung) der<br />
klassischen Konditionierung; Eigenschaften der klassischen Konditionierung; Ablauf der<br />
instrumentellen (operanten) Konditionierung; Primäre Verstärker; Sekundäre Verstärker;<br />
Eigenschaften instrumentellen Lernens; Vergleich zwischen klassischer und instrumenteller<br />
Konditionierung; Allgemeines Modell des Wissensgedächtnis; Perzeptive Repräsentation im<br />
sensorischen Speicher; Elaboriertes Speichern und Erinnern; Merken im Kontext.<br />
Entwicklung des Nervensystems: Lernen und Wachstum; Apoptose (Zelltod); Synaptisches Überleben;<br />
Physiologische Plastizität.<br />
Assoziative neuronale Plastizität: D.O. Hebbs synaptische Theorie spezifischer Gedächtnisinhalte;<br />
Reverberatorisches Kreisen; Erregungskreise, Lernen und Wiedergabe von Information; Die<br />
Bedeutung von Oszillationen.<br />
Zelluläre Korrelate von Lernen: Die Konsolidierungshypothese und Proteine; Hemmung der<br />
Proteinbiosynthese (Proteinbiosyntheseinhibition, PSI) und Gedächtnisbildung.<br />
Neuropsychologie der Konsolidierung: Korsakoff Syndrom; Der Fall H.M.; Der Hippokampus und<br />
Konsolidierung im LZG; Zerebellum und Hippokampus als „Lernmaschinen“; Zwei Formen von<br />
Lernen.<br />
Motivation:<br />
Grundbegriffe der Motivation: Trieb; Homöostatische und nichthomöostatische Triebe; Verstärkung;<br />
Charakteristische Eigenschaften von Verstärkung; Interaktion von Trieb und Verstärkung;<br />
Anreizmotivation (incentive motivation); Anreize (incentives); Instinktives und motiviertes<br />
Verhalten.<br />
Durst und Hunger: Bedingungen für das Auftreten einer Durstempfindung; Präresorptive und<br />
resorptive Durststillung; Durstschwelle; Die glukostatische Theorie; Konditionierte<br />
Nahrungsaufnahme; Thermostatische Hypothese; Lipostatische Hypothese; Faktoren der<br />
präresorptiven Sättigung; Faktoren der resorptiven Sättigung; Hypothalamus und Hunger;<br />
Hypothalamus und Sättigung.<br />
Neurobiologie süchtigen Verhaltens: Intrakranielle Selbstreizung (ICSS) und Belohnung: positive<br />
Verstärkung im Tierversuch; Anatomie von ICSS.<br />
69
Emotionen:<br />
Psychophysiologie von Gefühlen: Gefühlsdimensionen; Abgrenzung zwischen Gefühlen und<br />
Stimmungen; Kommunikative Bedeutung von Gefühlen; Die Rolle motorisch-verhaltensmäßiger<br />
Ausdrucksreaktionen für Gefühle; Die Rolle des autonomen Nervensystems für Gefühle: Die<br />
James-Lange-Kontroverse; Die Rolle kognitiver Prozesse für Gefühle.<br />
Vermeidung (Furcht und Angst): Lernen von Angst; Zwei-Prozeß Theorie der Angstentstehung; Drei<br />
Emotionssysteme; Psychopharmaka und das Verhaltenshemmungssystem; Psychologische<br />
Therapie der Angst.<br />
Trauer - Depression: Trauer; Diagnose der Depression; Soziale und psychologische Faktoren; Genetik<br />
der Depression; Zirkadiane Periodik; Biogene Amine; Antidepressiva und die Bewältigung von<br />
Angst und Hilflosigkeit; Therapie der Depression.<br />
Aggression: Arten von Aggression; Gemeinsamkeiten aggressiven Verhaltens; Sexualhormone;<br />
Verhalten von Soziopathen; Psychophysiologie; Soziopathie und septo-hippokampisches<br />
Hemmsystem; Prävention und Behandlung.<br />
Verhaltensmedizin und Biofeedback: die Anwendung der Gefühlsphysiologie und -psychologie auf<br />
Krankheit: Verhaltensmedizin; Verhaltensmedizin der Skoliose; Kurarisierungsversuche<br />
Kognitive Prozesse (Denken):<br />
Zerebrale Asymmetrie: Das 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts; Das 20. Jahrhundert; Ontogenetische<br />
Entwicklung von Lateralität; Bedeutung auditorischer Erfahrung; Dominanzanalyse mit dem<br />
Wada-Test; Händigkeit; Begabung und Linkshändigkeit; Sensomotorische Funktionen.<br />
Evolution und Neurophysiologie der Sprache und ihre Störungen: Evolutionäre Aspekte; Spracherwerb<br />
bei nicht-humanen Primaten.<br />
Sprechen und Störungen der Sprache: Aphasien und Lateralisation des Gehirns; Broca- und Wernicke-<br />
Region; Lokalisation der Aphasien; Broca-Aphasie; Wernicke-Aphasie.<br />
Die Assoziationsareale des Neocortex: Anatomie; Ideomotorische und konstruktive Apraxie; Visuellräumliche<br />
Funktionen; Kontralateraler Neglekt; Neglekt und Aufmerksamkeit;<br />
Kurzzeitgedächtnis (KZG); Zeitliche Kontiguität; Handlungspläne und korrolare Entladungen;<br />
Der Zerfall von Verhaltensplänen; Psychochirurgie und frontale Leukotomie;<br />
Pseudopsychopathie; Funktionen des Temporallappens; Visuelle Unterscheidung; Akustische<br />
Unterscheidung und Sprache.<br />
70<br />
Literatur:<br />
Schmidt, R.F. (Hrsg.) (1985 5 ). Grundriß der Sinnesphysiologie. Berlin: Springer (siehe Bemerkung<br />
oben).<br />
Allgemeine Sinnesphysiologie, Psychophysik:<br />
Grundbegriffe der allgemeinen Sinnesphysiologie: Sinnesorgane; Modalität, Qualität, spezifische<br />
Sinnesreize; Quantität, Schwelle; Sinneseindruck, Wahrnehmung; Abbildungsverhältnis von<br />
Phänomen und Wahrnehmung, objektive und subjektive Sinnesphysiologie.<br />
Messung der Intensität von Empfindungen, Psychophysik: Eigenmetrik; Schätzung des Vielfachen<br />
einer Empfindungsintensität; Intermodaler Intensitätsvergleich; Eigenmetrik mit Hilfe von<br />
Unterschiedsschwellenschritten.
71<br />
Räumliche, zeitliche und affektive Aspekte der Empfindungen: Raumdimension der Empfindung;<br />
Kontrast; Zeitdimension der Empfindung.<br />
Neurophysiologie sensorischer Systeme:<br />
Transformation von Reizen in Rezeptoren: Der adäquate Reiz, Einteilung der Rezeptoren; Das<br />
Rezeptorpotential; Der Transduktionsprozeß, primäre und sekundäre Sinneszellen; Das<br />
Rezeptorpotential als Generator für fortgeleitete Aktionspotentiale; Adaptation; Die<br />
Transformation von Reizintensität in Entladungsfrequenz.<br />
Sensorischen Funktionen des Zentralnervensystems - Übersicht: Periphere Nerven, Spinalnerven,<br />
Hinterwurzeln und ihre Innervationsgebiete; Die Gehirnnerven; Zentrale Stationen der Sensorik;<br />
Anatomie des spezifischen Systems der Somatosensorik; Anatomie des unspezifischen Systems.<br />
Eigenschaften und Arbeitsweise sensorischer Neurone und Neuronenverbände: Laterale Inhibition;<br />
Descendierende Hemmung; Das rezeptive Feld; Reizstärke-Reizantwort-Beziehungen,<br />
Unterschiedsschwellen.<br />
Somatosensorik: Rückenmark, aufsteigende Bahnen und Hirnstamm: Verschaltung der Afferenzen im<br />
Hinterhorn; Aufsteigende Bahnen des Rückenmarks; Trigeminuskerne und ihre aufsteigenden<br />
Bahnen; Die Formatio reticularis.<br />
Somatosensorik: Thalamus und Cortex: Der spezifische Thalamuskern der Somatosensorik;<br />
Somatosensorische Projektionsareale des Cortex; Das spezifische thalamo-corticale System und<br />
die bewußte Sinneswahrnehmung; Assoziationsfelder des Cortex; Extralemniscales System und<br />
bewußte Wahrnehmung.<br />
Somatoviscerale Sensibilität:<br />
Mechanorezeption: Empfindungsschwelle und Intensitätsfunktion mechanischer Hautreizung;<br />
Räumliches Auflösungsvermögen; Druckrezeptoren (Intensitätsdetektoren);<br />
Berührungsrezeptoren (Geschwindigkeitsdetektoren); Vibrationsrezeptoren<br />
(Beschleunigungsdetektoren); Mechanosensible freie Nervenendigungen der Haut.<br />
Tiefensensibilität: Qualitäten der Tiefensensibilität; Rezeptoren der Tiefensensibilität; Zentrale<br />
Integration; Körperschema und Körperstellung.<br />
Thermorezeption: Statische Temperaturempfindungen; Dynamische Temperaturempfindungen; Kaltund<br />
Warmrezeptoren; Rezeptorfunktion und Thermorezeption; Sonderformen der<br />
Temperaturempfindung.<br />
Viscerale Sensibilität: Cardiovasculäres System; Gastro-Intestinal System; Renales System.<br />
Nociception und Schmerz:<br />
Schmerzqualitäten und Schmerzkomponenten: Schmerzqualitäten.<br />
Neurophysiologie und Psychophysik des Schmerzes: Nociceptoren; Zentrale Weiterleitung und<br />
Verarbeitung; Schmerzadaptation.<br />
Pathophysiologie des Schmerzes: Spezielle und abnorme Schmerzformen: Projizierter Schmerz;<br />
Neuralgie; Kausalgie; Übertragener Schmerz; Störungen der zentralen Schmerzverarbeitung.<br />
Schmerzbeeinflussung und Schmerztherapie: Pharmakologische Schmerzbehandlung; Physikalische<br />
Schmerzbehandlung; Psychologische Methoden der Schmerzbekämpfung.
Physiologie des Sehens:<br />
Das Auge: Das optisches System des Auges; Regelprozesse im dioptrischen Apparat;<br />
Pupillenreaktionen; Refraktionsanomalien; Die Netzhaut.<br />
Psychophysiologie der visuellen Wahrnehmung: Das Eigengrau; Graustufen; Simultankontrast; Der<br />
successive Hell-Dunkelkontrast, Nachbilder; Die Sehschärfe; Der blinde Fleck; Photopisches<br />
und skotopisches Sehen; Der zeitliche Verlauf der Hell-Dunkeladaptation, Blendung; Die<br />
zeitlichen Eigenschaften der visuellen Wahrnehmung; Das Farbensehen; Weiß und Schwarz als<br />
Farbe; Binocularsehen; Gestaltwahrnehmung.<br />
Neurophysiologie des Sehens: Der photochemische Primärprozeß; Das Rezeptorpotential;<br />
Neurophysiologie retinaler Ganglienzellen; Neurophysiologie des Simultankontrastes; Die<br />
Reaktion retinaler Ganglienzellen auf farbige Lichtreize; Die Projektion der Netzhaut in das<br />
Zentralnervensystem; Die Signalverarbeitung im Corpus geniculatum laterale; Die Neurone des<br />
visuellen Cortex.<br />
Augenbewegungen und sensorisch-motorische Integration beim Sehen: Konjugierte<br />
Augenbewegungen, Vergenzbewegungen; Die zeitlichen Eigenschaften der Augenbewegungen;<br />
Die Blickmotorik; Augenbewegungen und visuelle Wahrnehmung, Nystagmus;<br />
Augenbewegungen beim freien Sehen.<br />
Physiologie des Hörens:<br />
Anatomischer Aufbau des Ohres.<br />
Die Leistungen des Hörsystems: Physikalische Eigenschaften der Schallreize; Schallereignis und<br />
subjektive Hörempfindung: Technische Verfahren zur Beurteilung von Lärm; Akustische<br />
Raumorientierung.<br />
Die Aufgaben des Mittelohres und des Innenohres: Aufgaben des Mittelohres; Schallaufnahme im<br />
Innenohr, Ortstheorie; Reizaufnahme durch die Haarzellen; Unterscheidung zwischen Mittelohrund<br />
Innenohrschwerhörigkeit.<br />
Der Nervus acusticus und die höheren Stationen der Hörbahn: Erregungsbedingungen der<br />
Hörnervenfasern; Verlauf der Hörbahn.<br />
Physiologie des Gleichgewichtssinnes:<br />
Anatomischer Aufbau und Physiologie des peripheren Organs: Rezeptoren des Gleichgewichtsorgans<br />
und ihre Erregungsbedingungen; Aufbau und Aufgaben der Statolithen- und Bogengangsorgane.<br />
Die zentralnervösen Verschaltungen und die Leistungen des Gleichgewichtssinnes: Zentrale<br />
Verbindungen der Rezeptoren des Gleichgewichtsorgans; Statische und statokinetische Reflexe,<br />
Vestibulärer Nystagmus.<br />
Entsprechend dem Vorlesungsmanuskript:<br />
Störungen der Hirnfunktion bei Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns;<br />
Physiologische Grundlagen von Drogenabhängigkeit und Alkoholismus;<br />
Physiologisch-biochemische Wirkungsmechanismen von Psychopharmaka.<br />
72
Hinweise zur Prüfung:<br />
73<br />
Prüfungsgebiet in der 2 stündigen Klausur ist die Vorlesung im WS und SS. Der Inhalt wurde<br />
vorstehend umrissen. Pro Doppelstunde wird im Durchschnitt 1 Frage gestellt, so daß sich für die<br />
Gesamtklausur 52 Fragen ergeben. Die Prüfungsfragen verteilen sich in etwa auf den Prüfungsstoff wie<br />
folgt:<br />
Anatomischer Aufbau des Organismus 1<br />
Zellen, Gewebe und Organe 1<br />
Menschliche Ontogenese 3<br />
Humangenetik und Erbpsychologie 2<br />
Verhaltensbiologie 2<br />
Blut 1<br />
Herz und Gefäßsystem 3<br />
Atmung 1<br />
Energie- und Wärmehaushalt 1<br />
Ernährung und Magen-Darm-Kanal 2<br />
Nierenfunktion und Wasserhaushalt 1<br />
Hormonphysiologie 6<br />
Elektrophysiologie 3<br />
Anatomie des ZNS und Rückenmarks 1<br />
Reflexphysiologie 1<br />
Muskel und motorische Systeme 3<br />
Vegetatives Nervensystem und Entspannungstechniken 3<br />
EEG und EKP 1<br />
Bewußtsein und Aufmerksamkeit 2<br />
Aktivierungs- und Stresstheorien, Spezifitätsproblem 1<br />
Schlaf und Traum 1<br />
Plastizität, Lernen und Gedächtnis 2<br />
Motivation, Emotion und kognitive Prozesse 2<br />
Sinnesphysiologie 7<br />
Störungen der Hirnfunktion, Drogen und Psychopharmaka 1
Übungsklausur Biologische Psychologie<br />
74<br />
Aufgabentypen:<br />
(1) Einfachauswahl: Auf eine Frage oder unvollständige Aussage folgen 5 mit A - E gekennzeichnete<br />
Antworten oder Ergänzungen, von denen eine einzige ausgewählt werden soll, und zwar<br />
entweder die einzig richtige<br />
oder die beste von mehreren möglichen<br />
oder wenn es besonders gekennzeichnet ist, die nicht<br />
zutreffende.<br />
(2) Zuordnungsaufgaben - Aufgabengruppen mit gemeinsamem Antwortangebot: Jede dieser<br />
Aufgabengruppen besteht aus<br />
(a) einer Liste mit numerierten Begriffen, Fragen oder Aussagen (Liste 1 = Aufgabengruppe)<br />
(b) einer Liste von 5 durch die Buchstaben A - E gekennzeichneten Antwortmöglichkeiten (Liste<br />
2)<br />
Zu jeder numerierten Aufgabe der Liste 1 soll aus der Liste 2 die eine Antwort A - E ausgewählt<br />
werden, die für zutreffend gehalten wird oder von der man meint, daß sie im engsten<br />
Zusammenhang mit dieser Aufgabe steht. Man sollte beachten, daß jede Antwortmöglichkeit A - E<br />
auch für mehrere Aufgaben der Liste 1 die Lösung darstellen kann.<br />
(3) Kausale Verknüpfung: Dieser Aufgabentyp besteht aus drei Teilen:<br />
Teil 1: Aussage 1<br />
Teil 2: Aussage 2<br />
Teil 3: Kausale Verknüpfung (weil)<br />
Jede der beiden Aussagen kann unabhängig von der anderen richtig oder falsch sein. Wenn beide<br />
Aussagen richtig sind, so kann die Verknüpfung durch „weil“ richtig oder falsch sein.<br />
Der richtige Lösungsbuchstabe soll nach Prüfung der einzelnen Teile dem nachfolgenden<br />
Lösungsschema entnommen werden.<br />
Antwort Aussage 1 Aussage 2 Verknüpfung<br />
A richtig richtig richtig<br />
B richtig richtig falsch<br />
C richtig falsch -<br />
D falsch richtig -<br />
E falsch falsch -<br />
(4) Aussagenkombinationen: Bei diesem Aufgabentyp werden mehrere durch eingeklammerte Zahlen<br />
gekennzeichnete Aussagen gemacht. Die zutreffende Lösung soll unter den 5 vorgegebenen<br />
Aussagekombinationen A - E ausgewählt werden.<br />
(5) Freie Aufgabenbeantwortung: Schilderung bestimmter Sachverhalte in Stichworten, Aufzählungen,<br />
Anfertigung von Diagrammen.
(01) Im Serum eines Patienten mit der Blutgruppe 0 agglutinieren die Erythrozyten eines Spenders mit<br />
der Blutgruppe<br />
(1) A<br />
(2) B<br />
(3) AB<br />
(A) keine der Aussagen ist richtig<br />
(B) nur 1 ist richtig<br />
(C) nur 2 ist richtig<br />
(D) nur 3 ist richtig<br />
(E) 1 - 3 = alle sind richtig<br />
75<br />
(02) Welche Aussage trifft zu?<br />
Die Wirkung des Parasympathikus am Ventrikelmyocard ist<br />
(A) negativ chronotrop<br />
(B) negativ dromotrop<br />
(C) negativ inotrop<br />
(D) negativ bathmotrop<br />
(E) physiologisch bedeutungslos<br />
(03) Welche der folgenden Summen entspricht dem Lungenvolumen am Ende einer normalen<br />
Inspiration?<br />
(A) Residualvolumen + Inspirationskapazität<br />
(B) Residualvolumen + Atemvolumen<br />
(C) Funktionelle Residualkapazität + Atemvolumen<br />
(D) Exspiratorisches Reservevolumen + Inspiratorisches Reservevolumen<br />
(E) Residualvolumen + Exspiratorisches Reservevolumen<br />
(04) Ordnen Sie den in Liste 1 genannten Nährstoffen ihre physiologischen Brennwerte (Liste 2!) zu!<br />
Liste 1 Liste 2<br />
1 ..... Kohlenhydrat (A) 4,1 kcal/g<br />
(B) 5,6 kcal/g<br />
2 ..... Fett (C) 4,1 cal/g<br />
(D) 9,3 kcal/g<br />
3 ..... Eiweiß (E) 9,3 cal/g
76<br />
(05) Die Zusammensetzung des Primärharns unterscheidet sich vom Plasma vor allem durch das<br />
Fehlen größerer Eiweißmoleküle,<br />
weil<br />
im distalen Tubulus Glukose, Aminosäuren und filtriertes Protein fast vollständig resorbiert<br />
werden.<br />
Antwort Aussage 1 Aussage 2 Verknüpfung<br />
A richtig richtig richtig<br />
B richtig richtig falsch<br />
C richtig falsch -<br />
D falsch richtig -<br />
E falsch falsch -<br />
(06) Das Ruhemembranpotential einer Nervenmembran<br />
(1) ist mit dem K + -Gleichgewichtspotential identisch<br />
(2) weicht nur unerheblich vom K + -Gleichgewichtspotential ab<br />
(3) hat aktiven Na + -K + -Transport zur Voraussetzung<br />
(4) ändert sich periodisch („slow waves“) aufgrund einer elektrogenen Na + Pumpe<br />
(5) ist unabhängig von der extrazellulären K + -Konzentration<br />
(A) nur 1 ist richtig<br />
(B) nur 4 ist richtig<br />
(C) nur 2 und 3 sind richtig<br />
(D) nur 4 und 5 sind richtig<br />
(E) nur 2, 3 und 5 sind richtig<br />
(07) Welche Aussage trifft nicht zu?<br />
Das Endplattenpotential (EPP) bei der neuromuskulären Erregungsübertragung)<br />
(A) wird durch Acetylcholin ausgelöst<br />
(B) wird unter Einwirkung von Curare vermindert<br />
(C) entsteht nach dem Eintreffen eines Nervenaktionspotentials in der Endplatte<br />
(D) wird durch Blockade der Cholinesterase verstärkt<br />
(E) ist normalerweise unterschwellig für die Auslösung eines Muskelaktionspotentials<br />
(08) Folgende hormonproduzierende Organe sind lebensnotwendig und müssen bei einem Ausfall<br />
mittels einer Substitutionstherapie behandelt werden:<br />
(1) Nebennierenrinde<br />
(2) Nebenschilddrüse<br />
(3) Hypophyse<br />
(4) Pankreas<br />
(5) Hypothalamus<br />
(A) nur 5 ist richtig<br />
(B) nur 1 und 5 sind richtig<br />
(C) nur 1, 3 und 5 sind richtig<br />
(D) nur 2, 3 und 4 sind richtig
77<br />
(E) 1 - 5 = alle sind richtig<br />
(09) Ordnen Sie den in Liste 1 genannten Hormonen ihre Bildungsorte (Liste 2) zu!<br />
Liste 1 Liste 2<br />
1 ... Adiuretin (A) Nebenschilddrüse<br />
(B) Nebennierenmark<br />
2 ... ACTH (C) Zona glomerulosa<br />
(D) Hypophyse<br />
3 ... Gonadotropine (e) Hypothalamus<br />
(10) Welches der folgenden Symptome gehört nicht zum Cushing-Syndrom?<br />
(A) Stammfettsucht<br />
(B) Striae am Bauch infolge verstärkter Gluconeogenese<br />
(C) erhöhte Infektanfälligkeit<br />
(D) erhöhter Blutdruck<br />
(E) eingeschränkte glomeruläre Filtrationsrate<br />
(11) Wie entsteht Riesenwuchs?<br />
(1) durch Überproduktion von GH in der Kindheit<br />
(2) durch verfrühte Pubertät<br />
(3) durch verspäteten Epiphysenschluß<br />
(4) durch Überschuß an Parathormon in der fetalen Entwicklung<br />
(5) durch Überschuß an Thyroxin<br />
(A) nur 1 ist richtig<br />
(B) nur 3 ist richtig<br />
(C) nur 1 und 3 sind richtig<br />
(D) nur 2 und 3 sind richtig<br />
(E) 1 - 5 = alle sind richtig<br />
(12) Ordnen Sie den in Liste 1 genannten Strukturen des ZNS die entsprechenden Hirnteile zu!<br />
Liste 1 Liste 2<br />
1 ..... Kreislaufzentrum (A) Telencephalon (Großhirn)<br />
(B) Medulla oblongata (Nachhirn)<br />
2 ..... Hypothalamus (C) Metencephalon (Hinterhirn)<br />
(D) Diencephalon (Zwischenhirn)<br />
3 ..... Vierhügelplatte (E) Mesencephalon (Mittelhirn)
78<br />
(13) Welche der folgenden Aussagen trifft für den Flexorreflex zu?<br />
(1) reine Reflexzeit von 0,6 sec<br />
(2) nicht segmental (mehrere Segmente)<br />
(3) monosynaptisch<br />
(4) durch Aktivität der Muskelspindel ausgelöst<br />
(5) funktioniert nur an den oberen Extremitäten<br />
(A) nur 1 ist richtig<br />
(B) nur 1, 2 und 3 sind richtig<br />
(C) nur 2, 4 und 5 sind richtig<br />
(D) nur 2 ist richtig<br />
(E) keine Aussage trifft zu<br />
(14) Nennen Sie die Überbegriffe für die folgenden Pharmaka und Drogen:<br />
(A) Valium (R) ....................<br />
(B) Barbiturate ....................<br />
(C) Haldol (R) ....................<br />
(D) Mescalin ....................<br />
(E) Amphetamine ....................<br />
(15) Wo werden hohe Schallwellen absorbiert?<br />
(1) in der Nähe des ovalen Fensters<br />
(2) im Macula-Organ<br />
(3) im Corti'schen Organ<br />
(4) am Helicotrema<br />
(5) in den Bogengängen<br />
(A) nur 1 ist richtig<br />
(B) nur 1 und 3 sind richtig<br />
(C) nur 2, 3 und 4 sind richtig<br />
(D) nur 3 und 4 sind richtig<br />
(E) 1- 5 = alle sind richtig<br />
(16) Wodurch ist das hohe Auflösungsvermögen des Gesichtssinns bedingt?<br />
(A) durch die genaue sphärische Krümmung von Linse und Hornhaut<br />
(B) durch die Struktur des Glaskörpers<br />
(C) durch die Organisation des rezeptiven Feldes in der Retina und das Prinzip der lateralen<br />
Hemmung<br />
(D) durch die hohe Konvergenz im Bereich der Stäbchen<br />
(E) durch den Astigmatismus
79<br />
(17) Welche der folgenden akustischen Skalen ist wirklich eigenmetrisch?<br />
(A) die Dezibel-Skala<br />
(B) die Schalldruck-Skala<br />
(C) die sone-Skala<br />
(D) die phon-Skala<br />
(E) keine der genannten Skalen<br />
(18) Ordnen Sie den in Liste 1 genannten Autoren die entsprechenden Aktivierungstheorien (Liste 2)<br />
zu!<br />
Liste 1 Liste 2<br />
1 ..... Berlyne (A) Synergismenlehre (ergotrop-trophotrop)<br />
(B) organismische Aktivationstheorie<br />
2 ..... Lindsley (C) reticulo-corticale Aktivationstheorie<br />
(D) Erregungspotential-Verstärkungs-Funktion<br />
3 ..... Hess (E) Prinzip der richtungsabhängigen<br />
funktionalen Fraktionierung<br />
(19) Zur Orientierungsreaktion gehören:<br />
(1) steigende Atemfrequenz<br />
(2) Ansteigen des Hautwiderstandes<br />
(3) Senkung der Reizschwelle für ankommende Stimuli<br />
(4) Erweiterung der Fingergefäße<br />
(5) biphasischer Verlauf der Herzfrequenz<br />
(A) nur 1 und 4 sind richtig<br />
(B) nur 1, 2 und 5 sind richtig<br />
(C) nur 1, 3 und 5 sind richtig<br />
(D) nur 2, 3 und 4 sind richtig<br />
(E) 1 - 5 = alle sind richtig<br />
(20) Welche Aussage für den REM-Schlaf trifft nicht zu?<br />
(A) Erniedrigung der Herzfrequenz<br />
(B) schnelle, richtungslose Bewegungen des Augapfels<br />
(C) Erektion des Penis<br />
(D) Erhöhung der Atemfrequenz<br />
(E) Erniedrigte Entladung im EMG des Kopfbereichs
80<br />
(21) Vermehrte Sympathikuserregung führt zu<br />
(1) Pupillenverengung<br />
(2) Konstriktion der Hautgefäße<br />
(3) Konstriktion der Bronchialmuskeln<br />
(4) vermehrter Salzsäuresekretion im Magen<br />
(A) nur 1 ist richtig<br />
(B) nur 2 ist richtig<br />
(C) nur 1 und 2 sind richtig<br />
(D) nur 2 und 4 sind richtig<br />
(E) 1 - 4 = alle sind richtig<br />
(22) Welche Aussage trifft für das Parkinson-Syndrom nicht zu?<br />
(A) Dopaminmangel in den Basalganglien<br />
(B) Hypotonus der Muskulatur<br />
(C) Ruhetremor<br />
(D) Akinese<br />
(E) mimische Starre<br />
(23) Welche der genannten motivationalen Zustände rechnet man zu den nicht-homöostatischen<br />
Triebmechanismen?<br />
(1) sexuelle Erregung<br />
(2) Durst<br />
(3) Explorationsverhalten<br />
(4) Schlaf<br />
(5) Hunger<br />
(A) nur 1 und 3 sind richtig<br />
(B) nur 1 und 4 sind richtig<br />
(C) nur 1, 3 und 5 sind richtig<br />
(D) nur 2, 3 und 5 sind richtig<br />
(E) keine Aussage trifft zu<br />
(24) Phobisches Verhalten entsteht meist auf der Basis aktiven Vermeidens,<br />
weil<br />
aktives Vermeiden negativ verstärkt wird.<br />
Antwort Aussage 1 Aussage 2 Verknüpfung<br />
A richtig richtig richtig<br />
B richtig richtig falsch<br />
C richtig falsch -<br />
D falsch richtig -<br />
E falsch falsch -
81<br />
(25) Eine bedingte Reaktion kann immer nur von ein und demselben Reiz ausgelöst werden,<br />
weil<br />
die Verbindung nicht auf ähnliche Reize generalisiert.<br />
Antwort Aussage 1 Aussage 2 Verknüpfung<br />
A richtig richtig richtig<br />
B richtig richtig falsch<br />
C richtig falsch -<br />
D falsch richtig -<br />
E falsch falsch -<br />
(26) Das Erlernen des Hebeldrucks ist ein Vorgang<br />
(A) des bedingten Reflexes<br />
(B) des klassischen Konditionierens<br />
(C) des operanten Konditionierens<br />
(D) des Lernens von Signalen<br />
(E) des mechanischen Lernens<br />
Lösungsschlüssel:<br />
(01) E<br />
(02) E<br />
(03) C<br />
(04) 1A, 2D, 3A<br />
(05) C<br />
(06) C<br />
(07) E<br />
(08) E<br />
(09) 1E, 2D, 3D<br />
(10) E<br />
(11) C<br />
(12) 1B, 2D, 3E<br />
(13) D<br />
(14) (A) Tranquilizer, (B) Hypnotika/Schlafmittel, (C) Neuroleptica<br />
(D) Halluzinogene, (E) Psychoanaleptica/Aufputschmittel<br />
(15) B<br />
(16) C<br />
(17) C<br />
(18) 1D, 2C, 3A<br />
(19) C<br />
(20) A<br />
(21) B<br />
(22) B<br />
(23) A<br />
(24) D