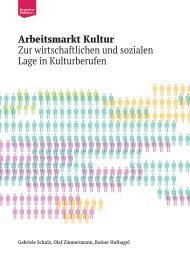Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ERINNERUNGSKULTUR<br />
politik <strong>und</strong> kultur • März – April 2007 • Seite 13<br />
Fortsetzung von Seite 12<br />
kann, zeigt die viel beachtete Ausstellung<br />
„Flucht, Vertreibung, Integration“<br />
der Stiftung Haus der Geschichte<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland,<br />
die auf große Zustimmung stieß.<br />
Dennoch wäre es klug, die bestehende<br />
Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen<br />
in die weitere Arbeit einzubeziehen,<br />
wie es auch mit dem Initiativkreis<br />
um Lea Rosh beim Holcaust-<br />
Mahnmal geschieht. Die Verantwortlichen<br />
der Stiftung Zentrum gegen<br />
Vertreibungen stellen sich gegen<br />
Flucht <strong>und</strong> Vertreibung, sie wollen<br />
nicht Schuld gegeneinander aufrechnen,<br />
sie wollen im Sinne der Versöhnung<br />
ein sichtbares Zeichen in der<br />
deutschen Hauptstadt errichtet wissen<br />
<strong>und</strong> sie beziehen die europäische<br />
Perspektive ein. Es wäre ein positives<br />
Zeichen, dieser von bürgerschaftlichem<br />
Engagement getragenen<br />
Initiative die Hand zu reichen<br />
<strong>und</strong> damit jene Kräften in den Vertriebenenverbänden<br />
zu stärken, die<br />
die Versöhnung <strong>und</strong> Verständigung<br />
mit unseren europäischen Nachbarn<br />
betreiben.<br />
Nichts ist so schwer wie Erinnerung.<br />
Erinnerung wird immer überlagert<br />
von Geschichten <strong>und</strong> Geschichtlichem.<br />
Erinnerung ist verb<strong>und</strong>en mit<br />
Schmerz <strong>und</strong> Trauer über das Geschehene.<br />
Diesem Schmerz den<br />
Raum zu geben, zugleich darüber hinaus<br />
zu weisen <strong>und</strong> die Gründe für<br />
Vertreibung, gestern <strong>und</strong> heute, zu<br />
analysieren, wird die Aufgabe des<br />
Zentrum gegen Vertreibungen sein.<br />
Der Verfasser ist Geschäftsführer des<br />
Deutschen <strong>Kultur</strong>rates<br />
<strong>Kultur</strong> der Erinnerung braucht einen Ort<br />
Vier Aufgaben des Zentrums gegen Vertreibung • Von Erika Steinbach<br />
„Es wird leider immer Vertreibungen<br />
geben.“ Dieser Satz des neuen<br />
tschechischen Außenministers,<br />
Fürst Karl Schwarzenberg, beschreibt<br />
das Gr<strong>und</strong>dilemma, gegen<br />
das sich seit dem 6. September<br />
2000 das Zentrum gegen Vertreibungen<br />
(ZgV) als gemeinnützige<br />
Stiftung der deutschen Heimatvertriebenen<br />
wendet. Fürst Schwarzenberg<br />
sieht dabei neben den europäischen<br />
Aspekten auch ganz neutral<br />
die Befindlichkeit der jeweils<br />
betroffenen Nation: „Ich verstehe<br />
völlig, dass man für die Opfer des<br />
eigenen Volkes <strong>und</strong> für die Vertriebenen,<br />
die Entsetzliches mitgemacht<br />
haben, ein Denkmal, eine Erinnerungsstätte<br />
schaffen soll.“ Dies<br />
steht ganz in der Tradition der<br />
deutsch-tschechischen Aussöhnungserklärung<br />
von 1997, in der<br />
Deutschland die nationalsozialistischen<br />
Verbrechen in Tschechien bedauerte,<br />
während Prag sein Bedauern<br />
über die Vertreibung der Sudetendeutschen<br />
zum Ausdruck brachte.<br />
B<strong>und</strong>eskanzlerin Angela Merkel<br />
zitierte mit Recht den französischen<br />
Philosophen <strong>und</strong> Goethepreisträger<br />
Raymond Aron: „Der<br />
Charakter <strong>und</strong> die Selbstachtung einer<br />
Nation zeigen sich darin, wie sie<br />
mit ihren Opfern der Kriege <strong>und</strong> mit<br />
ihren Toten umgeht.“<br />
Der ungarische Staatspräsident<br />
László Sólymon enttabuisiert die<br />
Vertreibung der Ungarndeutschen<br />
<strong>und</strong> weihte eine Gedenkstätte „Vertreibung<br />
der Ungarndeutschen“ ein.<br />
Ganz selbstverständlich legt in Mittelosteuropa<br />
die Jugend tradierte<br />
Denkverbote ab <strong>und</strong> hinterfragt die<br />
Geschichte ihrer Heimatländer.<br />
Vier Aufgaben<br />
Der B<strong>und</strong> der Vertriebenen hat dem<br />
Zentrum gegen Vertreibungen als<br />
Stiftungsgründer vier gleichberechtigte<br />
Aufgaben gestellt.<br />
· Zum einen soll das Zentrum das<br />
Schicksal der mehr als 15 Millionen<br />
deutschen Deportations- <strong>und</strong> Vertreibungsopfer<br />
aus ganz Mittel-,<br />
Ost- <strong>und</strong> Südosteuropa mit ihrer<br />
<strong>Kultur</strong> <strong>und</strong> ihrer jahrh<strong>und</strong>ertealten<br />
Siedlungsgeschichte erfahrbar machen.<br />
Tausende der Vertriebenen<br />
<strong>und</strong> Deportierten durchlitten jahrelange<br />
Zwangsarbeit <strong>und</strong> Lagerhaft<br />
unter unmenschlichen Bedingungen.<br />
Fast 2,5 Millionen Kinder, Frauen<br />
<strong>und</strong> Männer haben die Torturen<br />
von Vertreibung, Folter, Zwangsarbeit<br />
oder monatelanger Vergewaltigung<br />
nicht überlebt. Die Überlebenden<br />
dürfen mit ihren Schicksalen<br />
nicht allein gelassen werden.<br />
Chef der Sächsischen Polizei: Keine Rückkehr von Antifaschisten, Sudetendeutsches<br />
Archiv, München. Alle Fotos auf dieser Seite: © Zentrum gegen Vertreibungen<br />
· Die zweite Hauptaufgabe des Zentrums<br />
soll es sein, die enormen<br />
Auswirkungen zu ergründen, die<br />
die Aufnahme von Millionen<br />
Flüchtlingen auf die religiösen,<br />
wirtschaftlichen <strong>und</strong> gesellschaftlichen<br />
Strukturen jener Regionen<br />
hatten, die sie aufnehmen mussten.<br />
Es gibt wohl kaum einen Lebensbereich,<br />
der von diesen Umwälzungen<br />
in der Bevölkerung<br />
nicht betroffen war. Das „unsichtbare<br />
Fluchtgepäck“ (Gertrud Fussenegger)<br />
war dabei das gesammelte<br />
Fachwissen der deutschen<br />
Land- <strong>und</strong> Stadtbevölkerung des<br />
Ostens. Von den Universitäten, aus<br />
den Fabriken, den Handwerksbetrieben<br />
<strong>und</strong> den florierenden Agrarstrukturen<br />
des Ostens kamen<br />
ganze Belegschaften mitsamt ihren<br />
Arbeitgebern, die Professoren mit<br />
ihren Studenten, die Ingenieure<br />
wie die Facharbeiter. Die Integration<br />
der Vertriebenen wurde als die<br />
größte sozial- <strong>und</strong> wirtschaftspolitische<br />
Aufgabe bezeichnet, die von<br />
Deutschland gemeistert worden sei<br />
(Alfred Grosser). Diese Leistung ist<br />
eine Aufarbeitung wert!<br />
· Das Zentrum gegen Vertreibungen<br />
hat als dritte Aufgabe die generelle<br />
Dokumentation von Vertreibungen<br />
<strong>und</strong> Genoziden. Allein in Europa<br />
waren bzw. sind mehr als 30<br />
Volksgruppen von solchen Menschenrechtsverletzungen<br />
betroffen:<br />
von den Albanern, Armeniern,<br />
Azeris über die Esten, Georgier, Inguschen,<br />
Krim-Tataren, Polen,<br />
Tschetschenen, Urkrainern bis zu<br />
den Weißrussen <strong>und</strong> griechischen<br />
Zyprioten <strong>und</strong> der singuläre Massenmord<br />
an den Juden Europas<br />
durch die Nationalsozialisten. So<br />
hat die Völkergemeinschaft über<br />
den Genozid 1914/15 am armenischen<br />
Volk durch das Osmanische<br />
Reich lange hinweggesehen. Ethnische<br />
„Flurbereinigung“ durch<br />
Zwangsumsiedlungen wurden 1922<br />
vom Völkerb<strong>und</strong> nicht nur geduldet,<br />
sondern selbst beschlossen.<br />
Hitler spekulierte auf das Desinteresse<br />
der Völkergemeinschaft bei<br />
seinen Vernichtungsplänen. Er<br />
setzte Schritt um Schritt sein grausames<br />
Werk an unseren jüdischen<br />
Mitbürgern, an den europäischen<br />
Juden <strong>und</strong> anderen Menschen in<br />
die Tat um. Er öffnete die Büchse<br />
der Pandora vollständig. Und so<br />
gab es auch nach ihm kein Halten.<br />
Neben den Deutschen erlitten<br />
Krim-Tartaren <strong>und</strong> Ostpolen durch<br />
Stalin wie auch die der Ungarn<br />
durch Beneš im Nachkriegszeitraum<br />
ihre Vertreibung aus der Heimat.<br />
Auf dem Balkan <strong>und</strong> in Tschetschenien<br />
sehen wir bis heute Bilder<br />
der Gewalt. Getrieben von Rache<br />
<strong>und</strong> Vergeltung sind die Menschen<br />
oft in einem Teufelskreis gefangen.<br />
Gründe der Rechtfertigung<br />
werden immer wieder gesucht. Es<br />
gibt sie nicht! Vertreibung <strong>und</strong> Genozid<br />
lassen sich niemals rechtfertigen.<br />
Sie sind immer ein Verbrechen,<br />
sie widersprechen den Menschenrechten<br />
<strong>und</strong> sie verharren im<br />
archaischen Denken von Blutrache.<br />
· Die vierte Stiftungsaufgabe ist die<br />
Verleihung des mit 10.000 € dotierten<br />
Franz-Werfel-Menschenrechtspreises<br />
für Verantwortungsbewusstsein<br />
förderndes Handeln. Der<br />
Preis kann an Einzelpersonen, aber<br />
auch an Initiativen oder Gruppen<br />
verliehen werden, die sich gegen<br />
die Verletzung von Menschenrechten<br />
durch Völkermord, Vertreibung<br />
<strong>und</strong> die bewusste Zerstörung nationaler,<br />
ethnischer oder religiöser<br />
Gruppen gewandt haben. Die<br />
Ausweis Elisabeth Pfuhle: Fritz A. Pfuhle (Professor für Freihandzeichnen an<br />
der Fakultät für Architektur) aus Danzig gehörte zu den nicht kriegsdienstverpflichteten<br />
Hochschulangehörigen, die im Januar 1945 auf das Schiff „Deutschland“<br />
evakuiert wurden. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Irene Pfuhle sowie<br />
seinen Töchtern Elisabeth Roggemann, geb. Pfuhle, <strong>und</strong> Gesa Pfuhle.<br />
Preisverleihung erfolgt im Geiste<br />
des IV. Haager Abkommens von<br />
1907, das ausdrücklich die Zivilbevölkerung<br />
während <strong>und</strong> nach kriegerischen<br />
Handlungen unter<br />
Schutz stellte. Sie erfolgt im Sinne<br />
der Allgemeinen Erklärung der<br />
Menschenrechte von 1948, des Internationalen<br />
Paktes von 1966, der<br />
Entschließung der Menschenrechtskommission<br />
der Vereinten<br />
Nationen von 1998, aber auch der<br />
Kopenhagener Kriterien des Europäischen<br />
Rates von 1993.<br />
Ohne Unterstützung<br />
geht es nicht<br />
Ein solches Zentrum kann nicht<br />
ohne Unterstützung entstehen. Die<br />
Stiftung hat in den letzten Jahren viel<br />
an Unterstützung erfahren. Namhafte<br />
Persönlichkeiten wie unter anderem<br />
Arnulf Baring, Axel Frhr. von<br />
Campenhausen, Joachim Gauck,<br />
Ralph Giordano, Otto von Habsburg,<br />
Helga Hirsch, Walter Homolka, Imre<br />
Kertesz, Eckart Klein, Freya Klier, György<br />
Konrad, Rudolf Kucera, Otto<br />
Graf Lambsdorff, Franz Maget, Hans<br />
Maier, Siegfried Matthus, Horst Möller,<br />
Rüdiger Safranski, Julius Schoeps,<br />
Peter Scholl-Latour, Christoph<br />
Stölzl, Christian Thielemann, Christian<br />
Tomuschat, Gabriele Wohmann,<br />
Michael Wolffsohn, Alfred M. de Zayas<br />
oder Tilman Zülch gaben ihren<br />
guten Namen zur Unterstützung des<br />
Zentrums gegen Vertreibungen. Die<br />
ConBrio Zeitschriften<br />
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte<br />
hat über 10.000 Unterschriften<br />
gesammelt. Die B<strong>und</strong>esregierung<br />
hat ihre Unterstützung für<br />
einen Ort der Erinnerung signalisiert.<br />
Alle Kommunen Deutschlands<br />
haben die Möglichkeit mit 5 Cent<br />
pro Einwohner Pate unserer Stiftung<br />
zu werden. Über 450 Städte haben<br />
bereits ein Zeichen gesetzt – für die<br />
gelungene Eingliederung der Vertriebenen<br />
<strong>und</strong> Aussiedler <strong>und</strong> den gemeinsamen<br />
Wiederaufbau nach<br />
Krieg, Flucht <strong>und</strong> Vertreibung.<br />
Die Zukunft<br />
Bis zur Mitte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts galt<br />
Vertreibung als geeignetes Mittel der<br />
<strong>Politik</strong>, obwohl es gegen geltendes<br />
Völkerrecht verstieß. Die Erfahrung<br />
<strong>und</strong> das Leid im „Jahrh<strong>und</strong>ert der<br />
Vertreibung“ führten zu der Erkenntnis,<br />
dass erzwungene Bevölkerungsverschiebungen<br />
nie human waren.<br />
Das „Recht auf Heimat“ wurde von<br />
den Vereinten Nationen kodifiziert,<br />
die Vertreibung geächtet. Es bleibt<br />
eine Aufgabe für die Zukunft über<br />
eine Erinnerungskultur zu einer <strong>Kultur</strong><br />
des besseren Umgangs miteinander<br />
zu kommen <strong>und</strong> gangbare<br />
Wege für ein Miteinander der Völker<br />
zu finden.<br />
Stellen wir uns dieser Aufgabe.<br />
Die Verfasserin ist Vorsitzende<br />
der Stiftung Zentrum gegen<br />
Vertreibungen<br />
Oper&<br />
Tanz<br />
Zeitschrift der VdO für<br />
Opernchor <strong>und</strong> Bühnentanz<br />
ZEITUNG DES DEUTSCHEN KULTURRATES<br />
Armbinde zur Kennzeichnung von Deutschen. Die hier auf dieser Seite abgedruckten Bilder zeigen Exponate aus der<br />
Ausstellung „Erzwungene Wege. Flucht <strong>und</strong> Vertreibung im Europa des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts“, die die Stiftung Zentrum<br />
gegen Vertreibungen vom 11. August bis zum 29. Oktober 2006 im Kronprinzenpalais in Berlin veranstaltet hat.<br />
ConBrio Verlagsgesellschaft,<br />
Brunnstr. 23, 93053 Regensburg,<br />
Tel. 0941/945 93-0, Fax 0941/945 93-50,<br />
E-Mail: info@conbrio.de, www.conbrio.de