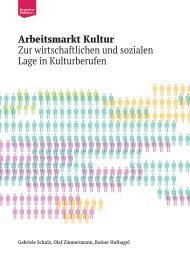Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LEITARTIKEL<br />
politik <strong>und</strong> kultur • März – April 2007 • Seite 3<br />
Fortsetzung von Seite 2<br />
Geisteswissenschaften: Stolz <strong>und</strong> Vorurteil.<br />
Auf der einen Seite der Physiologe<br />
Emil Du Bois-Reymond, der<br />
1882 in seiner Berliner Rektoratsrede<br />
mit dem polemischen Titel „Goethe<br />
<strong>und</strong> kein Ende“ dem „Collegen“ Faust<br />
vorwarf, er hätte „statt an Hof zu gehen,<br />
ungedecktes Papiergeld auszugeben<br />
<strong>und</strong> zu den Müttern in die vierte<br />
Dimension zu steigen, besser [daran]<br />
gethan, Gretchen zu heiraten,<br />
sein Kind ehrlich zu machen, <strong>und</strong><br />
Elektrisirmaschine <strong>und</strong> Luftpumpe<br />
zu erfinden“. Auf der anderen Seite<br />
der Romanist Ernst Robert Curtius,<br />
der den Ruf an eine Technische Universität<br />
erhält <strong>und</strong> diesen Ruf, so geht<br />
jedenfalls die Sage, voller Schrecken<br />
mit den Worten ablehnt: „Dann kann<br />
es ja dazu kommen, dass der ordentliche<br />
Professor für Heizung <strong>und</strong> Lüftung<br />
mich mit Herr Kollege anredet!“<br />
Wie fruchtbar aber die Verpflanzung<br />
der Geisteswissenschaften in<br />
ein fremdes Milieu sein kann, zeigte<br />
sich 1959 nach der Berufung Walter<br />
Höllerers auf einen Lehrstuhl für Literaturwissenschaft<br />
an der Technischen<br />
Universität Berlin. Die Skepsis<br />
im Kollegenkreis war ebenso groß wie<br />
die Überraschung unter den Dichtern;<br />
Paul Celan gratulierte dem Neuberufenen<br />
mit den Worten: „Lieber Walter<br />
Höllerer, meinen herzlichen Glückwunsch<br />
zu Ihrer Berufung nach Berlin:<br />
hoffentlich schaden Sie der Technik!“<br />
Höllerer aber hatte anderes im<br />
Sinn. Sein Antwortschreiben an den<br />
Dekan der Humanistischen Fakultät –<br />
so etwas gab es einmal – klang nüchtern:<br />
„Spectabilität – soweit es auf<br />
mich ankommt, ich würde es begrüßen,<br />
an einer technischen Universität<br />
lehren zu können.“ Höllerer gründete<br />
ein „Institut für Sprache im technischen<br />
Zeitalter“ <strong>und</strong> wenig später eine<br />
Zeitschrift gleichen Namens.<br />
Eine Schlüsselrolle bei diesen Namensgebungen<br />
spielte Arnold Gehlens<br />
wenige Jahre zuvor publizierte<br />
Schrift Die Seele im technischen Zeitalter<br />
– ein Essay nicht nur über die<br />
„sozialpsychologischen Probleme in<br />
der industriellen Gesellschaft“, sondern<br />
zugleich ein kritisches Porträt<br />
der noch jungen B<strong>und</strong>esrepublik. Bewusst<br />
vermied Gehlen eine in<br />
Deutschland in langer kulturkritischer<br />
Tradition gewachsene, „gegen<br />
die Technik gerichtete polemische<br />
Tönung“; die Technik wurde wie<br />
selbstverständlich zum Gegenstand<br />
der Humanwissenschaften. Folgerichtig<br />
war bei Höllerer keine Rede<br />
von „Interdisziplinarität“ – dieser<br />
stets ebenso erfolgreichen wie meist<br />
folgenlosen Suche nach dem kleinsten<br />
gemeinsamen Nenner. Er forderte<br />
auch keinen „Dialog“ zwischen<br />
Geisteswissenschaften auf der einen,<br />
Natur- <strong>und</strong> Technikwissenschaften<br />
auf der anderen Seite. Für die Geisteswissenschaften<br />
ging es darum,<br />
sich im Milieu einer Technischen<br />
Universität neu zu disziplinieren. In<br />
dieser Haltung, aus der sich eine erfolgreiche<br />
Strategie der Selbstbehauptung<br />
entwickelte, liegt eine exemplarische<br />
Bedeutung.<br />
In fremder Umgebung gelangten<br />
die Geisteswissenschaften zu überraschenden<br />
Einsichten. Es ist wie in der<br />
B<strong>und</strong>esliga: Ordentliche Heimmannschaften<br />
sind die Regel <strong>und</strong> ein bisschen<br />
langweilig; Außerordentliches<br />
bieten Auswärtsmannschaften, die<br />
sich auf fremdem Platz <strong>und</strong> gegen ein<br />
skeptisches bis feindseliges Publikum<br />
behaupten, das ihnen am Ende Beifall<br />
spendet. Höllerer liebte das Konterspiel:<br />
An einer Technischen Universität<br />
ein Symposium über die Literaturkritik<br />
in Deutschland zu veranstalten,<br />
erschien ihm weder abwegig<br />
noch absurd: „Die analytisch-empirische<br />
Betrachtungsweise benachbarter<br />
technischer Wissenschaften<br />
kann für die sprachkritische Methode<br />
förderlich sein“, lautete die taktische<br />
Anweisung an seine Mitspieler.<br />
In einem Klima intellektueller Nüchternheit<br />
entwickelte der Libero Höllerer<br />
einen unvergleichlichen Enthusiasmus.<br />
Aus der Außenseiterposition<br />
entwickelte die Zeitschrift „Sprache<br />
im technischen Zeitalter“ Mut<br />
zum antizyklischen Verhalten: Druckten<br />
andere Primärliteratur, fanden<br />
sich in Höllerers Zeitschrift Essays<br />
<strong>und</strong> Reflexionen – verdrängten in der<br />
Szene literarische Theorien die Texte,<br />
kehrte „Sprache im technischen<br />
Zeitalter“ zur Primärliteratur zurück.<br />
Als das „Institut für Sprache im<br />
technischen Zeitalter“ gegründet<br />
wurde, gab es in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
noch kein Farbfernsehen <strong>und</strong> keinen<br />
Videorecorder <strong>und</strong> kein ZDF; zum<br />
ersten Mal wurde eine Theorie zur<br />
Datenbündelung <strong>und</strong> Datenkompression<br />
formuliert – die entscheidende<br />
Voraussetzung für die Entwicklung<br />
des Internet. Die Seele im technischen<br />
Zeitalter? Das klingt fünfzig<br />
Jahre später zopfig, wie Biedermeier.<br />
Und doch ist die Erinnerung an die<br />
große Zeit der Geisteswissenschaften<br />
in einer Technischen Universität kein<br />
Ausdruck der Nostalgie. Sie ist Kritik<br />
an einer Institution, die durch ihre intellektuelle<br />
Magersucht Erkenntnis<strong>und</strong><br />
damit Zukunftschancen verspielt.<br />
Heute wäre über die Seele im Zeitalter<br />
des Internet nachzudenken,<br />
über den Menschen in der Ära von<br />
Google, von Web 2.0 <strong>und</strong> Second Life<br />
– der virtuellen 3D-Welt, in welcher<br />
wir uns eine alternative Existenz aufbauen<br />
können. Es ist höchste Zeit,<br />
den Ort der Geisteswissenschaften in<br />
Technischen Universitäten neu zu<br />
bestimmen; unzeitgemäß ist es, sie<br />
dort vom Platz zu stellen.<br />
Die alte Dame<br />
Geisteswissenschaft<br />
In einem berühmten Aufsatz aus dem<br />
Jahr 1957 fragte der Soziologe Helmut<br />
Schelsky: „Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar?“<br />
Für die Geisteswissenschaften<br />
kann die Frage beantwortet<br />
werden: „Ja“. Immer wird es<br />
hier mehr Manifeste geben als Meisterwerke.<br />
Das Bild bleibt widersprüchlich.<br />
In Deutschland versucht die Stiftungsinitiative<br />
Pro Geisteswissenschaften,<br />
in stärkerem Umfang als<br />
bisher ein knappes Gut bereitzustellen:<br />
Zeit. Mit Blick auf das Ausland<br />
kann es scheinen, als werde – punktuell<br />
jedenfalls – das Füllhorn über<br />
die Humanities ausgeschüttet. Von<br />
der Balzan- über die norwegische<br />
Holbergstiftung bis zur amerikanischen<br />
Library of Congress sowie den<br />
Mellon- <strong>und</strong> MacArthur-Stiftungen –<br />
von den japanischen Stiftungen ganz<br />
zu schweigen – werden Preise für<br />
Geisteswissenschaftler ausgelobt, die<br />
zum Teil höher dotiert sind als der<br />
Nobelpreis. Eine Internationale des<br />
schlechten Gewissens hat sich gebildet;<br />
gegenüber im Vergleich mit der<br />
Medizin <strong>und</strong> den Naturwissenschaften<br />
lange Zeit vernachlässigten Fächergruppen<br />
wird Wiedergutmachung<br />
geübt.<br />
In Deutschland darf man sich<br />
nicht davon täuschen lassen, dass<br />
Akademien, deren Interesse bisher<br />
nicht ohne eine Spur von Hochmut<br />
nur den Natur- <strong>und</strong> Technikwissenschaften<br />
galt, auf einmal Mitglieder<br />
aus den Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften<br />
berufen. Kommt darin ein<br />
frischgewonnener Familiensinn gegenüber<br />
den lange Zeit vernachlässigten,<br />
armen Verwandten zum Ausdruck?<br />
Oder ist es nur eine Vorsichtsmaßnahme,<br />
damit man im Rennen<br />
um den Titel einer Nationalakademie<br />
nicht vorzeitig auf der Strecke bleibt?<br />
Dass Geisteswissenschaftler von Nutzen<br />
sein können, wenn es darum<br />
geht, Probleme <strong>und</strong> Ergebnisse der<br />
Natur- <strong>und</strong> Technikwissenschaften<br />
einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln,<br />
hat sich im PR-Zeitalter<br />
mittlerweile herumgesprochen. Zu<br />
Illusionen wird das die Geisteswissenschaftler<br />
nicht verleiten. Vielen<br />
Vertretern der so genannten „harten<br />
Fächer“ gelten sie immer noch als so<br />
nützlich wie der Mann, von dem der<br />
Physiker Lichtenberg sagte, er sei<br />
kein großes Licht, wohl aber ein guter<br />
Leuchter für anderer Leute Meinungen.<br />
Paradoxer Weise sind <strong>und</strong> bleiben<br />
die preiswerten Geisteswissenschaften<br />
die bevorzugten Kürzungs- <strong>und</strong><br />
Kündigungskandidaten in den längst<br />
krankgesparten Universitäten. Am<br />
bedrohlichsten aber ist das Verschwinden<br />
ganzer Disziplinen. Auch<br />
wenn wir von den Biologen gelernt<br />
haben, dass zum Erhalt der Artenvielfalt<br />
keine Maximierungs-, sondern<br />
eine Optimierungsstrategie notwendig<br />
ist: Analog zum Artenschutz- benötigen<br />
wir längst ein Fächerschutzabkommen.<br />
Es steht zu befürchten,<br />
dass der so genannte „Bologna-Prozess“,<br />
der in das deutsche Universitätssystem<br />
Bachelor- <strong>und</strong> Masterstudiengänge<br />
hineinzwingt, für manch<br />
ein so genanntes „kleines Fach“ mit<br />
dem Todesurteil enden wird.<br />
In Deutschland droht heute die<br />
Reduzierung unserer Bildungsinhalte<br />
durch ihre Provinzialisierung. Daher<br />
ist es von besonderer Bedeutung,<br />
dass der Wissenschaftsrat gleichzeitig<br />
mit seinen Empfehlungen zur Förderung<br />
der Geisteswissenschaften<br />
auch Vorschläge zur konzentrierten<br />
Förderung der Regionalwissenschaften<br />
gemacht hat. Was wir dringend<br />
benötigen, ist eine Stärkung unserer<br />
Fremd- <strong>und</strong> Fernkompetenz. Die<br />
Geisteswissenschaften sind ein wichtiges<br />
Feld, auf dem diese Kompetenz<br />
erworben wird.<br />
Im Zeitalter der Wanderungen,<br />
des <strong>Kultur</strong>enwechsels <strong>und</strong> hoher Mobilitätsansprüche<br />
an den Einzelnen<br />
helfen die Geisteswissenschaften,<br />
sich in unterschiedlichen Milieus <strong>und</strong><br />
Lebenswelten zurechtzufinden. Sie<br />
bieten Verstehens- <strong>und</strong> Übersetzungshilfen<br />
– aber sie erstreben kein<br />
Weiter auf Seite 4