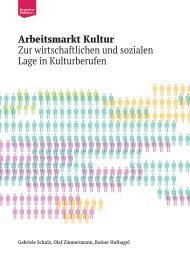Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Politik und Kultur - Deutscher Kulturrat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KULTURPOLITIK IN THÜRINGEN<br />
politik <strong>und</strong> kultur • März – April 2007 • Seite 5<br />
Fortsetzung von Seite 4<br />
tegration. Aber verstärkt geht es um<br />
die Sinnhaftigkeit der Existenz des<br />
modernern Menschen. Kein W<strong>und</strong>er<br />
also, dass es hier Meinungsverschiedenheiten<br />
<strong>und</strong> sogar Streit gibt –<br />
zwischen den <strong>Kultur</strong>mächten, aber<br />
auch innerhalb derselben. Natürlich<br />
muss man sich darüber streiten, ob<br />
man über Hitler im Kino lachen darf<br />
oder wie weit Karikaturen darin gehen<br />
dürfen, Religionen lächerlich zu<br />
machen. Es stehen nämlich Gr<strong>und</strong>werte<br />
wie Meinungsfreiheit oder<br />
Kunstfreiheit auf dem Spiel, die eben<br />
nicht sofort miteinander harmonieren.<br />
Und: kein W<strong>und</strong>er, dass man<br />
dieses wichtige Gesellschaftsfeld<br />
gerne vereinnahmen möchte, um<br />
seine Interessen durchzusetzen. Der<br />
Machthistoriker Wolfgang Reinhard<br />
(„Geschichte der Macht“, 1999) definiert<br />
lapidar: „<strong>Kultur</strong>politik“ ist „die<br />
bewusste Kontrolle <strong>und</strong> Instrumentalisierung<br />
bestimmter kultureller<br />
Felder durch <strong>und</strong> für die Staatsmacht.“<br />
(S. 388). Vielleicht klingt diese<br />
Begriffsbestimmung weniger<br />
drastisch, wenn man sich überlegt,<br />
dass die „Staatsmacht“ durchaus<br />
auch parlamentarisch-demokratisch<br />
zustande kommen kann, so dass<br />
auch dieses machtzentrierte Verständnis<br />
von <strong>Kultur</strong>politik kompatibel<br />
mit unserer politischen Gr<strong>und</strong>ordnung<br />
ist. Es zeigt allerdings auch<br />
die Relevanz dieses oft in der Öffentlichkeit,<br />
allerdings nie von Machtpolitikern<br />
unterschätzten <strong>Politik</strong>feldes.<br />
Völlig klar ist dann aber auch, dass<br />
<strong>Politik</strong> (als Durchsetzung von Gestaltungsabsichten)<br />
<strong>und</strong> <strong>Kultur</strong> (als<br />
selbstreflexive <strong>und</strong> kritische Beurteilung<br />
auch der <strong>Politik</strong>) immer in einem<br />
Spannungsverhältnis stehen<br />
müssen. „<strong>Kultur</strong>politik“ ist dann also<br />
erst recht ein spannungsvolles <strong>und</strong><br />
widerspruchsreiches Geschäft. Denn<br />
als <strong>Politik</strong> müssen Entscheidungen<br />
getroffen werden, die im eigenen Zuständigkeitsbereich<br />
wiederum funktionsgemäß<br />
hart kritisiert werden<br />
müssen. Der <strong>Kultur</strong>politiker muss es<br />
also aushalten, dass er genau aus<br />
dem Bereich, dessen Funktionsfähigkeit<br />
er sichern will, keine „Dankbarkeit“,<br />
sondern härteste Kritik zu<br />
erwarten hat. Denn <strong>Kultur</strong>politik ist<br />
im Verständnis dieses Textes <strong>Politik</strong><br />
<strong>und</strong> nicht primär diskursive geistige<br />
„<strong>Kultur</strong>“.<br />
Für jemanden, der diesen Widerstreit<br />
zwischen den unterschiedlichen<br />
Handlungslogiken nicht aushält,<br />
ist dies nicht das geeignete Aktivitätsfeld.<br />
Auszuhalten ist auch,<br />
dass jeder seinen ureigensten <strong>Kultur</strong>begriff<br />
in der „<strong>Kultur</strong>“-<strong>Politik</strong><br />
sucht <strong>und</strong> natürlich verärgert ist,<br />
wenn er diesen nicht findet. So ist<br />
die <strong>Kultur</strong>politik mit den <strong>Kultur</strong>begriffen<br />
der Ethnologen, Soziologen,<br />
Philosophen, aber auch mit den einzelnen<br />
<strong>Kultur</strong>begriffen der verschiedenen<br />
<strong>Kultur</strong>wissenschaften konfrontiert,<br />
die alle – zu Recht – bemängeln,<br />
dass weder in der kulturpolitischen<br />
Praxis noch im kulturpolitischen<br />
Diskurs genau ihr jeweiliger<br />
<strong>Kultur</strong>begriff zu finden ist. Und oft<br />
genug sind sogar Menschen in der<br />
<strong>Kultur</strong>politik selbst deswegen verwirrt,<br />
weil sie sich in ihrem Fachstudium<br />
mit solchen disziplinbezogenen<br />
<strong>Kultur</strong>begriffen auseinander gesetzt<br />
haben <strong>und</strong> diese nunmehr<br />
auch in der <strong>Kultur</strong>politik ohne Abstriche<br />
realisieren möchten (vgl.<br />
mein Buch „<strong>Kultur</strong> Macht Sinn“, i.V.).<br />
Auch dies ist also auszuhalten. Für<br />
denjenigen aber, der diese Positionen<br />
zwischen den Stühlen will <strong>und</strong><br />
aushalten kann, für den wird gerade<br />
dadurch <strong>Kultur</strong>politik spannend <strong>und</strong><br />
sinnhaft.<br />
Der Verfasser ist Vorsitzender des<br />
Deutschen <strong>Kultur</strong>rates<br />
Kleinstaatlich – kleinkariert – kleinzukriegen?<br />
Thüringen aus kulturgeschichtlicher Sicht • Von Stefanie Ernst<br />
Thüringen galt bis ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
strukturpolitisch betrachtet als<br />
Inbegriff der Kleinstaaterei. Gleichzeitig<br />
besaß <strong>und</strong> besitzt der heutige<br />
Freistaat eine erstaunliche <strong>Kultur</strong>-,<br />
Bildungs- <strong>und</strong> Wirtschaftsdichte,<br />
ohne jedoch über Ballungszentren<br />
oder regelrechte <strong>Kultur</strong>metropolen<br />
zu verfügen. Die nun folgende<br />
kleine <strong>Kultur</strong>-Geschichte soll den<br />
Sonderweg Thüringens veranschaulichen<br />
<strong>und</strong> die nachstehenden Artikel,<br />
die sich mit der aktuellen Lage<br />
der dortigen <strong>Kultur</strong>einrichtungen<br />
unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Theater <strong>und</strong> Orchesterlandschaft<br />
auseinandersetzen, historisch<br />
einbetten.<br />
Der heutige Freistaat brachte viele<br />
bedeutende Landeskinder<br />
hervor <strong>und</strong> zeichnete sich zugleich<br />
als Heimat <strong>und</strong> Wirkungsstätte für<br />
zugereiste Künstler <strong>und</strong> Gelehrte<br />
aus. Zu denken sei zum Beispiel an<br />
den im 13. Jahrh<strong>und</strong>ert nahe Erfurt<br />
geborenen Mystiker Meister Eckhart,<br />
an Lucas Cranach, der von Friedrich<br />
dem Weisen als Hofmaler nach Weimar<br />
geholt wurde oder an Friedrich<br />
Alles nur Theater?!<br />
Im Herbst letzten Jahres erregte die<br />
Thüringer <strong>Kultur</strong>politik die Aufmerksamkeit<br />
in den Feuilletons der großen<br />
Zeitungen. Einmal wieder wurde die<br />
Frage erörtert, wie viele Theater sich<br />
ein Land wie Thüringen leisten kann,<br />
ob Theater fusioniert werden müssen<br />
oder sollen, wie die kulturelle Infrastruktur<br />
gesichert werden kann. Hintergr<strong>und</strong><br />
dieser Debatte ist die mittelfristige<br />
Finanzplanung des thüringischen<br />
Kultusministers Jens Goebel, in<br />
der deutliche Kürzungen in der Theaterfinanzierung<br />
vorgesehen sind.<br />
Während dieser Debatte entstand in<br />
der kulturpolitischen Öffentlichkeit<br />
teilweise der Eindruck, als bestünde die<br />
thüringische <strong>Kultur</strong>politik ausschließlich<br />
aus der Theaterfinanzierung. In dieser<br />
Ausgabe soll sich daher der Frage der<br />
<strong>Kultur</strong>finanzierung in Thüringen von verschiedenen<br />
Seiten genähert werden:<br />
Stefanie Ernst setzt sich mit Thüringen<br />
als Föderalismus im Kleinen<br />
auseinander, sie beleuchtet die Geschichte<br />
des Landes <strong>und</strong> auf dieser<br />
Gr<strong>und</strong>lage die <strong>Kultur</strong>politik. Kultusminister<br />
Jens Goebel stellt sein kulturpolitisches<br />
Konzept für Thüringen vor<br />
<strong>und</strong> geht dabei auf die Finanzierungsnotwendigkeiten<br />
der verschiedenen<br />
künstlerischen Sparten ein. Der kulturpolitische<br />
Sprecher der CDU-Fraktion im<br />
Thüringer Landtag Jörg Schwäblein<br />
unterstützt die Argumentation von Kultusminister<br />
Jens Goebel. Der kulturpolitische<br />
Sprecher der SPD-Fraktion im<br />
Thüringer Landtag Hans-Jürgen Döring<br />
stellt die geplanten Kürzungen bei<br />
den Theatern <strong>und</strong> Orchestern in den<br />
Kontext von bestehenden Kürzungen<br />
Schiller, der als Dramatiker, Dichter<br />
<strong>und</strong> Philosoph von Thüringen ausgehend<br />
die Theaterlandschaft Deutschlands<br />
unglaublich bereicherte. Thüringen<br />
ist zudem das Kernland der<br />
Reformation. Der angebliche Thesenanschlag<br />
Martin Luthers an die Tür<br />
der Schlosskirche in Wittenberg gilt<br />
seither als Symbol für die geistige<br />
Schaffenskraft schlechthin. Parallel<br />
zu den Entwicklungen in Städten wie<br />
Weimar, Gera oder Nordhausen erklomm<br />
die Universität in Jena den<br />
Rang der meistfrequentierten deutschen<br />
Alma Mater der Weigel-Zeit.<br />
Und auch musikalisch kann Thüringen<br />
auf eine beachtliche Vergangenheit<br />
zurückblicken. Anno 1593 <strong>und</strong><br />
1603 wurden in Weimar <strong>und</strong> in Coburg<br />
die ersten thüringischen Hofkapellen<br />
gegründet. Und mit Johann<br />
Sebastian Bach war dort einer der<br />
bekanntesten deutschen Komponisten<br />
beheimatet.<br />
Lange galt Thüringen in der Geschichtswissenschaft<br />
als kleinstaatliches<br />
Gebilde, als Ausgeburt <strong>und</strong><br />
Inbegriff des Duodezabsolutismus.<br />
Nur selten gelangte das Gebiet im<br />
Herzen Deutschlands in den Fokus<br />
bei Museen, Bibliotheken <strong>und</strong> Musikschulen<br />
<strong>und</strong> fordert vor diesem Hintergr<strong>und</strong><br />
ein neues <strong>Kultur</strong>konzept. Birgit<br />
Klaubert, kulturpolitische Sprecherin<br />
der Fraktion Die Linke im Thüringer<br />
Landtag, befürchtet einen weiteren<br />
Abbau an Arbeitsplätzen durch die Einschränkungen<br />
in der Theaterfinanzierung.<br />
Katrin Göring-Eckhardt sieht in<br />
der <strong>Kultur</strong> mehr als einen „weichen<br />
Standortfaktor“. Mit der Theater- <strong>und</strong><br />
Orchesterfinanzierung in Thüringen setzen<br />
sich der Vorsitzende des Landesverbands<br />
Thüringen im Deutschen Bühnenverein<br />
Peter Hengstermann, der<br />
Landesvorsitzende Ost der Genossenschaft<br />
<strong>Deutscher</strong> Bühnenangehöriger<br />
Hans-Christoph Kliebes <strong>und</strong> der Stellvertretende<br />
Geschäftsführer der Deutschen<br />
Orchestervereinigung Claus<br />
Strulick auseinander. Peter Mittmann,<br />
der die „Initiative Erhalt Thüringer<br />
<strong>Kultur</strong>“ ins Leben gerufen hat, schildert<br />
deren Anliegen. Dass die Thüringer<br />
<strong>Kultur</strong> nicht allein aus den Theatern<br />
<strong>und</strong> Orchestern besteht, daran erinnern<br />
Bettina Rößger, Geschäftsführerin<br />
der Landesarbeitsgemeinschaft<br />
soziokultureller Zentren, Günter<br />
Schuchardt, Vorsitzender des Thüringer<br />
Museumsverbandes <strong>und</strong> Frank Simon-Ritz,<br />
Vorsitzender des Thüringer<br />
Bibliotheksverbandes. Sie verdeutlichen,<br />
dass andere künstlerische Sparten<br />
in den letzten Jahren massive Kürzungen<br />
hinnehmen mussten. Bei aller<br />
Solidarität mit den Theatern <strong>und</strong> Orchestern<br />
wird in den Beiträgen vor allem<br />
deutlich: Thüringen ist mehr als<br />
alles nur Theater.<br />
Die Redaktion<br />
des Interesses, zu sehr waren Historiker<br />
auf die „große“ <strong>Politik</strong>geschichte<br />
fixiert. Der deutsche Geschichtsschreiber<br />
Eduard Vehse stellt diesbezüglich<br />
eine Ausnahme dar. Während<br />
Thüringen von Vehse in seiner<br />
Geschichte der deutschen Höfe<br />
geradezu als Quelle der <strong>Kultur</strong> gepriesen<br />
wird, schildert von Treitschke<br />
in seiner deutschen Geschichte<br />
des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts das Land jedoch<br />
als Kleinstaatengebilde, das<br />
aufgr<strong>und</strong> der geteilten politischen<br />
Macht zu belächeln, wenn nicht gar<br />
zu verspottet sei. Und so gelangte<br />
Heinrich von Treitschke, deutscher<br />
Historiker, politischer Publizist <strong>und</strong><br />
Mitglied des Reichtags, in der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zu<br />
der Aussage: „Unsere <strong>Kultur</strong> verdankt<br />
ihnen [den Thüringern: Anm.<br />
d. V.] unsäglich viel, unser Staat gar<br />
nichts.“ Mittlerweile hat die Geschichtswissenschaft<br />
ihre Fixierung<br />
auf die große <strong>Politik</strong> überw<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> erkannte die besondere Eignung<br />
des Staatengebildes für die kulturgeschichtliche<br />
Forschung. Aber was<br />
genau macht kulturhistorisch den<br />
Sonderweg oder besser die Besonderheit<br />
Thüringens aus?<br />
<strong>Kultur</strong>elle Vielfalt durch<br />
Kleinstaatlichkeit<br />
Die seit dem Ende des 16. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
währenden Erbteilungen führten<br />
zu einer Vielzahl von entstandenen<br />
<strong>und</strong> wieder aufgelösten Zwergenstaaten.<br />
Die komplexe <strong>und</strong> zum<br />
Teil sehr verwirrende Teilungsgeschichte<br />
Thüringens soll hier nicht<br />
in Gänze erläutert werden. Belassen<br />
wir es bei der Nennung der Hauptlinien:<br />
Anzuführen sind die vor allem<br />
Das barocke Lustschloss Belvedere in Weimar<br />
die ernestinischen, die schwarzburgischen<br />
<strong>und</strong> die reußischen Geschlechter,<br />
die hinsichtlich ihrer<br />
Größe <strong>und</strong> Bedeutung herausstechen.<br />
Thüringen war wie das gesamte<br />
Heilige Römische Reich <strong>Deutscher</strong><br />
Nation in unzählige Kleinstterritorien<br />
unterteilt. Erst gegen Anfang des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts verringerte sich infolge<br />
der Napoleonischen Kriege<br />
<strong>und</strong> der Regelungen des Wiener Kongresses<br />
die Anzahl der deutschen<br />
Kleinstaaten erheblich. In Thüringen<br />
blieb jedoch „fast“ alles beim Alten.<br />
Mit Ausnahme von Sachsen-Weimar<br />
<strong>und</strong> Eisenach, die sich auf Kosten<br />
der aufgelösten katholischen Territorien<br />
vergrößerten <strong>und</strong> fortan den Titel<br />
eines Herzogtums führten. Während<br />
also im übrigen, gesamtdeutschen<br />
Raum eine Art Fusionsprozess<br />
vonstatten ging, muss sich die politische<br />
Landkarte Thüringens für die<br />
Zeitgenossen als bunter Flickenteppich<br />
dargestellt haben. Machtpolitisch<br />
mag eine solche Kleinteiligkeit<br />
von Nachteil gewesen sein. <strong>Kultur</strong>politisch<br />
betrachtet barg gerade diese<br />
Vielfalt einen immensen Vorteil.<br />
Denn anhand der Zurschaustellung<br />
des kulturellen Formats kompensierten<br />
die einzelnen Landesherrn<br />
möglicherweise ihre geringe politische<br />
Macht – mag sein. Oder sollte<br />
man die immense <strong>Kultur</strong>fülle nicht<br />
vielmehr als Ausdruck tatsächlicher<br />
Größe begreifen? Bestimmt sogar.<br />
Die hohe Anzahl der Residenzstädte<br />
in der Region erwuchsen zu markanten<br />
<strong>und</strong> bedeutenden Sammelbecken<br />
für Schriftsteller, Künstler <strong>und</strong><br />
Gelehrte. Schließlich war Thüringen<br />
kulturell so bedeutsam, dass eine seiner<br />
Städte Namenspate für eine ganze<br />
Epoche wurde. Von Thüringen ging<br />
eine enorme Schaffenskraft aus. Die<br />
hohe Konzentration von Residenzstädten<br />
einzelner Adelshäuser schuf<br />
quasi eine sehr segensreiche Ausgangslage.<br />
Denn Schriftsteller, Musiker,<br />
Künstler, schlichtweg alle <strong>Kultur</strong>schaffenden<br />
benötigten damals wie<br />
heute Förderer. Das Emporkommen<br />
der so genannten Musenhöfe sicherte<br />
<strong>und</strong> förderte die <strong>Kultur</strong> der Region<br />
über Jahrh<strong>und</strong>erte hinweg.<br />
Land der <strong>Kultur</strong>förderer<br />
Unter den Thüringer Adelsgeschlechtern<br />
hat es stets herausragende<br />
Förderer der Künste <strong>und</strong> der<br />
<strong>Kultur</strong> gegeben. Zu denken wäre hier<br />
u.a. an Anna Amalia, die Herzogin<br />
von Sachsen-Weimar-Eisenach. Seit<br />
1775 trafen sich an ihrer berühmt<br />
gewordenen Tafelr<strong>und</strong>e die geistigen<br />
Größen jener Zeit. Goethe, Herder,<br />
von Seckendorff, Knebel <strong>und</strong> viele<br />
mehr sinnierten dort gemeinsam<br />
über Frage der Musik, der Literatur,<br />
des Theaters oder der Kunst. Anna<br />
Amalia war es auch, die Wieland als<br />
Prinzenerzieher an ihren Hof holte.<br />
Und bis heute beherbergt die nach<br />
ihr benannte <strong>und</strong> von ihr <strong>und</strong> ihrem<br />
Gatten gegründete Bibliothek einzigartige<br />
Schätze der deutschen <strong>und</strong><br />
europäischen Geistesgeschichte.<br />
Der Weimarer Hof besuchte zu Zeiten<br />
Anna Amalias übrigens bis zu<br />
dreimal wöchentlich die Vorstellungen.<br />
Diese absolute Wertschätzung<br />
der Schauspielkunst äußerte sich<br />
auch in der Tatsache, dass Wieland<br />
die Theaterbesuche als zentral für<br />
die Prinzenerziehung ansah. Und<br />
Weiter auf Seite 6<br />
Foto: weimar GmbH/Maik Schuck