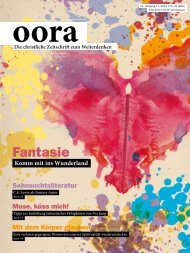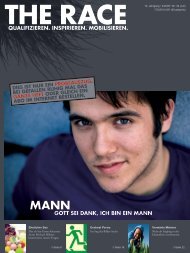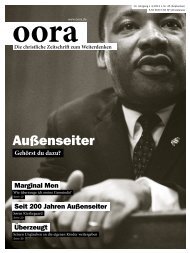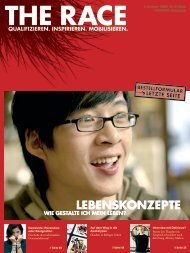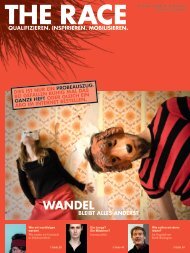oora eBook 42
oora eBook 42
oora eBook 42
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wenn der Staat zur Strafe tötet | Ende<br />
Herr Hermann, haben Sie Angst vor dem Tod?<br />
(überlegt) Ja. Tod bedeutet Trennung. Der Tod ist ein Feind<br />
Gottes. Das ist alles nichts Positives.<br />
Was, glauben Sie, passiert nach dem Tod?<br />
Ich werde bei Christus sein. Das betrifft nicht jede Person, aber<br />
gläubige Personen schon.<br />
Trotzdem haben Sie Angst davor, die Erde zu verlassen?<br />
Ja, denn diese negativen Begleiteffekte, wie die Trennung vom<br />
Partner, sind schließlich trotzdem da.<br />
Sie haben 52 verschiedene Studien zur Wirksamkeit der<br />
Todesstrafe miteinander verglichen. Was hat Sie dazu<br />
bewogen?<br />
Die Studie ist eingebunden in eine größere Untersuchung, eine<br />
sogenannte Metaanalyse, in der wir insgesamt 700 Abschreckungsstudien<br />
untersucht haben. Metaanalyse heißt, dass wir<br />
nicht Personen, Länder oder Regionen untersucht haben, sondern<br />
bereits vorhandene Studien. Wir haben uns gefragt, wie<br />
es zu den Ergebnissen einzelner Studien gekommen ist und wie<br />
man diese Ergebnisse so zusammenfassen kann, dass die Resultate<br />
insgesamt sicherer werden.<br />
Es ging also um Ergebnissicherung?<br />
Nicht nur. Die Studien kommen zu sehr unterschiedlichen Resultaten.<br />
Einige kommen zu dem Ergebnis, dass Abschreckung<br />
funktioniere, andere kommen zu dem gegenteiligen Ergebnis,<br />
nämlich, dass Abschreckung Kriminalität produzieren würde.<br />
Unsere Frage war deshalb: Wie kommen diese Unterschiede zustande?<br />
Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir natürlich<br />
auch solche Studien berücksichtigt, die sich speziell mit der Todesstrafe<br />
befassen. Eine Studie von Ehrlich beispielsweise, die in<br />
der Frühzeit der Forschungen zur Todesstrafe entstanden ist,<br />
kommt zu dem Ergebnis, dass jede Exekution sieben bis acht<br />
Morde verhindere. Es gab später dann Replikationen dieser Studie,<br />
die zu dem Ergebnis kamen, dass die Todesstrafe keine einzige<br />
Tötung verhindert.<br />
In Ländern, in denen die Todesstrafe abgeschafft wird, ist<br />
oft sogar ein Rückgang von Tötungsdelikten zu beobachten.<br />
Woher kommt das?<br />
Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Abschaffung<br />
der Todesstrafe zu einem Rückgang der Tötungsdelikte<br />
führt, und es gibt Studien, die in der Einführung der Todesstrafe<br />
diesen Effekt sehen. Der Grund für diese Diskrepanzen, so jedenfalls<br />
das Ergebnis der Metaanalyse, ist das Menschenbild des<br />
Forschers und die Theorie, die seiner Studie zugrunde liegt. Nehmen<br />
wir zum Beispiel einen Forscher mit einem utilitaristischen<br />
Ansatz, der postuliert, dass der Mensch Vor- und Nachteile verschiedener<br />
Handlungsalternativen abwägt und dann immer die<br />
wählt, die ihm den größten Nutzen bringt. Ein Forscher, der so<br />
vorgeht, nimmt an, dass die Todesstrafe zwangsläufig verhaltensrelevant<br />
ist. Der eigene Tod wäre in einer solchen Kosten-Nutzen-<br />
Rechnung immer der größte Kostenfaktor.<br />
Wenn man die Todesstrafe<br />
rechtfertigen will, findet man<br />
immer eine Studie, die das belegt.<br />
Wenn man der Todesstrafe gegenüber<br />
jedoch eher kritisch eingestellt ist,<br />
findet man genauso eine Studie,<br />
die das unterstützt.<br />
In diesem Menschenbild wäre kein Platz für eine Affekthandlung.<br />
Eine einseitige, rein ökonomische Sicht, die man auch<br />
anzweifeln kann.<br />
Richtig. Wenn man den Alltag beobachtet, gibt es ausgesprochen<br />
viele irrationale Handlungen.<br />
Ihr Ansatz ist offenbar kein rein ökonomischer. Welchen Ansatz<br />
verfolgen Sie?<br />
Ich verfolge eher eine Handlungstheorie, die auf den Arbeiten von<br />
Weber und Parsons basiert. Ich gehe davon aus, dass der Mensch<br />
einen freien Willen hat, in dem Sinne, dass er sich zwar zwischen<br />
mehreren Handlungsalternativen entscheiden, aber seine Entscheidung<br />
nicht unbedingt auch praktisch umsetzen kann. Bei der<br />
Wahl der Handlungsalternative spielen seine Werte eine größere<br />
Rolle. Welche Präferenzen hat er? Welche Ziele hat er für sein Leben?<br />
Dabei spielen sein Normverständnis und auch seine strukturelle<br />
Einbindung und seine Sozialisation eine Rolle.<br />
Prof. Dr. Dieter Hermann (60) ist Soziologe und Diplommathematiker. Er<br />
lehrt und forscht am Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg. Seine<br />
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kriminalsoziologie (Kriminalitätstheorien,<br />
Präventions- und Evaluationsforschung), Kultursoziologie (Werte-, Lebensstil-<br />
und Sozialkapitalforschung), Methoden empirischer Sozialforschung und<br />
Statistik sowie Ethik.<br />
<strong>oora</strong>.de<br />
17