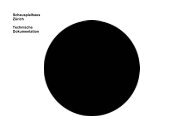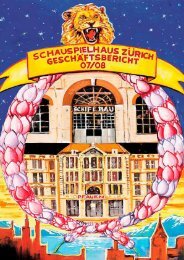Saisonvorschau 2010/11 - Schauspielhaus Zürich
Saisonvorschau 2010/11 - Schauspielhaus Zürich
Saisonvorschau 2010/11 - Schauspielhaus Zürich
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10 <strong>11</strong><br />
„Was heisst hier Heimat?“*<br />
„Wie soll ich mich in diesem Falle fassen?“*<br />
Der Autor Lukas Bärfuss in Betrachtung der Schweizer Natur<br />
Der Theatermacher René Pollesch über Sprache und Berührung<br />
Erinnerte mich neulich an eine Begegnung in Maroua,<br />
einer Wüstenstadt im Norden Kameruns, an der<br />
Grenze zum Tschad. In der Mittagszeit, im Zedernhain<br />
am Rande der Hauptstrasse, wohin sich die halbe<br />
Stadt vor der Hitze geflüchtet hatte, traf ich einen<br />
jungen Mann, einen Grundschullehrer, den ich zuerst<br />
für einen fliegenden Händler hielt und abzuwimmeln<br />
versuchte. Er aber wollte mir nichts verkaufen,<br />
sondern wissen, woher ich komme. Und ich erklärte<br />
in wenigen Worten die Schweiz, die Staatsform, das<br />
Klima, die Jahreszeiten, die vier Landessprachen, die<br />
Geschichte, den Reichtum –und obwohl ich meine<br />
Ausführungen knapp hielt, schien der Mann ungeduldig<br />
zu werden, und als ich mit meinem Abriss schliesslich<br />
zu Ende war, stellte er mir die Frage, um die sich<br />
seiner Ansicht nach alles drehte: Et alors, vous étiez<br />
colonisés par qui?<br />
Natürlich lachte ich über seine Einfältigkeit, wandte<br />
mich ab und beeilte mich, die knappe Zeit zu nutzen<br />
und die Hossère zu besteigen, den Hügel am Rande<br />
der Stadt. Und wie ich hinanstieg, beäugt von<br />
Kindern, die nicht verstanden, weshalb man freiwillig<br />
auf Berge klettert, da ging mir auf, wie berechtigt<br />
seine Frage war. Wer hat mir beigebracht, von Bergen<br />
sei mehr zu erfahren als von Menschen? Vielleicht<br />
waren mein Misstrauen und die Bevorzugung der<br />
Natur die Übernahme eines kolonialen Denkens?<br />
Der Urtourist Johann Wolfgang von Goethe beschreibt<br />
in den Briefen seiner Schweizreise aus dem Jahre<br />
1779 akribisch die geologischen, botanischen<br />
Gegebenheiten der Alpen. Über viele Seiten hinweg<br />
gibt er die Wege wieder, die Felsenschlünde, die<br />
Bewaldung, das Wetter, eine höchst detaillierte<br />
Beschreibung jener Gegend –und dann, am neunten<br />
November 1779, in Leukerbad, ganz unvermittelt dies:<br />
„Ich bemerke, dass ich in meinem Schreiben der<br />
Menschen wenig erwähne, sie sind auch unter diesen<br />
grossen Gegenständen der Natur, besonders im<br />
Vorbeigehen, minder merkwürdig.“ Einen Tagspäter,<br />
in Leuk, betritt er dann doch ein Haus. Aber: „Wie<br />
man auch nur hereintritt, so ekelts einem, denn es ist<br />
überall unsauber; Mangel und ängstlicher Erwerb<br />
dieser privilegierten und freien Bewohner kommt<br />
überall zum Vorschein.“<br />
Knapp vierzig Jahre später folgt ihm die junge Mary<br />
Shelley. Die Idee zu Frankenstein soll ihr bekanntlich<br />
in Genf zugefallen sein und man müsste einmal<br />
untersuchen, wie stark die autochthone Bevölkerung<br />
als Vorbild für ihr Monster diente. Aber das ist eine<br />
andere Geschichte. Wie Goethe ergeht sich Mary<br />
Shelley inden Naturbeschreibungen und wie bei<br />
Goethe fehlen die Menschen. „Die Schweizer<br />
erschienen uns damals, und die Erfahrung hat uns in<br />
dieser Meinung bestärkt, als ein Volk von langsamer<br />
Auffassungsgabe und Schwerfälligkeit.“ Mehr erwähnt<br />
sie nicht. Wenn einmal Menschen auftauchen, dann<br />
nur als Bedrohung. Über die Passagiere auf einer<br />
Diligence, einem Postboot, schreibt sie: „Für Gott<br />
wärs einfacher, den Menschen neu zu erschaffen, als<br />
diese Monster sauber zu bekommen.“<br />
Es waren nicht nur die Literaten und Touristen, die<br />
dieses spezifische Bild der Schweizer zeichneten. Das<br />
helvetische Direktorium, von Napoleon (unbestreitbar<br />
auch unser Kolonialisator) nach der Abschaffung der<br />
alten Eidgenossenschaft eingesetzt, schreibt an den<br />
französischen Oberkommandierenden, man solle von<br />
Vergeltungen an den aufständischen Innerschweizern<br />
absehen, denn: „Es sind Wilde, die aufzuklären und<br />
der gesellschaftlichen Vervollkommnung näher zu<br />
bringen wir uns zur Aufgabe gemacht haben.“<br />
Vielleicht liegt darin ein Grund für die schweizerische<br />
Verschwindungssucht, die ihren Niederschlag unter<br />
anderem bei Robert Walser findet. Zu Carl Seelig<br />
meinte er einmal, vor der Natur seien wir alle<br />
Stümper. Das Bankgeheimnis, überhaupt die<br />
sprichwörtliche Diskretion der Schweizer, ist vielleicht<br />
nichts anderes als die Einsicht, vor dem Hintergrund<br />
der Naturschönheiten unweigerlich als Wilde<br />
dazustehen. Und vor dieser Tatsache ist esbesser, so<br />
wenig wie möglich aufzufallen. In der Landschaft zu<br />
verschwinden. Vielleicht ist Scham der Grund, der<br />
Europäischen Union nicht beizutreten. Vielleicht aber<br />
auch eine Folge der fortdauernden touristischen<br />
Kränkung. Auch nach Goethe und Shelley hat kein<br />
Tourist jeunser Land besucht, um die Kultur<br />
kennenzulernen. Niemand interessiert sich für<br />
Schweizer Geschichte (am wenigsten wir selber),<br />
Schweizer Küche oder Schweizer Musik. Nein, dieses<br />
Land besucht man auch heute ausschliesslich der<br />
Natur wegen. Sie ist unsere wahre Kultur. Den<br />
Menschen aber, dessen Kultur die Natur ist, nennt<br />
man einen Wilden. Dessen schämen wir uns, wie sich<br />
jeder Knecht für das Bild schämt, das der Herr von<br />
ihm zeichnet. Und wie jeder Knecht fürchten wir, das<br />
Bild könnte die Wahrheit über uns enthalten.<br />
Eine andere Frage wäre –umdie gewöhnliche<br />
wegzukriegen: warum etwas nicht mehr funktioniert<br />
–eine richtige Frage wäre: „Warum hat es jemals<br />
funktioniert?“ Wir können nicht nach einem verloren<br />
gegangenen Rezept oder nach einem verloren<br />
gegangenen Sinn suchen, das Rad muss immer<br />
wieder neu erforscht werden. Wir können uns auf das<br />
Rad nicht verlassen.<br />
Alles, was man uns hinterlassen hat, ist für uns völlig<br />
unverständlich. Jede Quelle. Jeder Text. Das denke ich<br />
gerade bei diesem Dreissiger-Jahre-Farbfilm, bei dem<br />
die Leute sich gegenseitig berühren, als wären sie in<br />
unverständliche Klassiker verwickelt.<br />
Ich muss sehen, dass deine Hände nicht in Gesten<br />
verwickelt sind, sondern in die Erfindung von<br />
Berührungen, in die Erforschung dieser Werkzeuge.<br />
Ich hätte sehen müssen, dass es da nichts zu lesen<br />
gab in deinen Blicken, dass die Augen etwas ganz<br />
anderes machten als irgendwas zu signalisieren. Das<br />
war vielleicht der Schock, weisst dunoch, dieses eine<br />
Mal, als ich das in deinen Augen gesehen habe.<br />
Diesen Blick, der weder Sehen noch eine Geste war.<br />
Und es gab da keinen bekannten Grund mehr, warum<br />
die Augen existieren, als dieses Rätsel an Intensität.<br />
Sie wollen nichts signalisieren, sie wollen nichts<br />
sehen. Aus ihnen sprudelt nur der Verlust oder das<br />
Rätsel an Intensität.<br />
Meine Sprache stirbt jetzt schon aus. Das, was ich<br />
rede, wurde mir klar, kann schon in zwei Stunden<br />
nicht mehr verstanden werden. Die Sprache, die<br />
Sprache, war schon, in äh, einer Zehntel-Sekunde,<br />
ich, er und wir, meine Sprache, ich, er, meine Sprache<br />
weiss schon, die Sprache weiss schon in der<br />
nächsten Zehntel-Sekunde nichts mehr von mir. Sie<br />
wird, sie wird, und ich werde ineine ganz andere<br />
Richtung. Wir müssen das, leider leider leider, alles<br />
neu erfinden. Wir müssen ein, zwei Semester<br />
einschieben an einer unkreativen Universität. In denen<br />
es nur darum geht, schon bereits Erfundenes, bereits<br />
Erforschtes, noch ein Mal zu erforschen. Und so zu<br />
tun, als gäbe es das alles noch nicht. Das Problem<br />
auf einer Bühne ist, man soll sich da als Schauspieler<br />
mit etwas beschäftigen, mit dem man sich gerade<br />
nicht beschäftigt. Don Carlos, zum Beispiel. Wir<br />
brauchen das Abenteuer, sozutun, als gäbe es das<br />
alles noch gar nicht. Die Werkzeuge, wie Arme und<br />
Beine, und wie man die berührt, wie man ihnen<br />
begegnet. Es reicht leider leider leider nicht, dass wir<br />
unsere Knochen ausgraben. Und die Faustkeile und<br />
die Speere, um das hier zum Arm zu machen, das<br />
hier zum Bein. Das liegt leider nicht auf, in, auf der<br />
Hand.<br />
Wir können uns nicht auf den Flirt verlassen, der in<br />
der Luft liegt, als Grundlage einer gelungenen<br />
Kommunikation. Wie viele fette Komiker denken, dass<br />
sie Verführer sind, sie könnten sich auf den Flirt<br />
verlassen, der in der Luft liegt. (Besonders, wenn<br />
sie mit Frauen arbeiten.) Dieses widerliche Zeug,<br />
das dazu taugt, dass nichts gehört werden kann.<br />
Wissen Sie denn, wovon ich rede? Ich rede von dem<br />
diffusen Funkeln in der Luft, das eine Sphäre blinden<br />
Verstehens sein soll, das aber nur blind ist.<br />
*aus: Max Frisch, „Stiller“<br />
„Die Panne“ —abOktober im Pfauen<br />
„Stiller“ —abNovember im Schiffbau/Box<br />
„Weisse Flecken“ —abOktober im Pfauen/Kammer<br />
„Wer hat das Sagen?“ —abOktober im Pfauen<br />
*aus: Heinrich von Kleist, „Das Käthchen von<br />
Heilbronn“<br />
„Fahrende Frauen“ (Arbeitstitel) —abMai im Pfauen