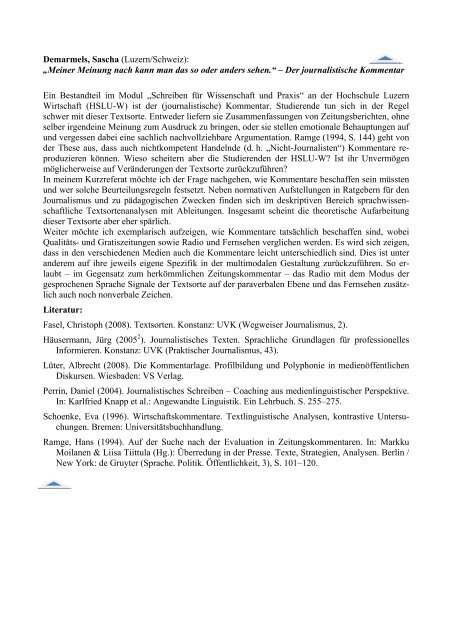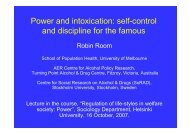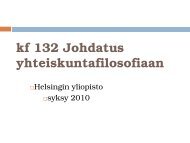Eine pdf-Datei mit allen Abstracts findet sich hier.
Eine pdf-Datei mit allen Abstracts findet sich hier.
Eine pdf-Datei mit allen Abstracts findet sich hier.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Demarmels, Sascha (Luzern/Schweiz):<br />
„Meiner Meinung nach kann man das so oder anders sehen.“ – Der journalistische Kommentar<br />
Ein Bestandteil im Modul „Schreiben für Wissenschaft und Praxis“ an der Hochschule Luzern<br />
Wirtschaft (HSLU-W) ist der (journalistische) Kommentar. Studierende tun <strong>sich</strong> in der Regel<br />
schwer <strong>mit</strong> dieser Textsorte. Entweder liefern sie Zusammenfassungen von Zeitungsberichten, ohne<br />
selber irgendeine Meinung zum Ausdruck zu bringen, oder sie stellen emotionale Behauptungen auf<br />
und vergessen dabei eine sachlich nachvollziehbare Argumentation. Ramge (1994, S. 144) geht von<br />
der These aus, dass auch nichtkompetent Handelnde (d. h. „Nicht-Journalisten“) Kommentare reproduzieren<br />
können. Wieso scheitern aber die Studierenden der HSLU-W? Ist ihr Unvermögen<br />
möglicherweise auf Veränderungen der Textsorte zurückzuführen?<br />
In meinem Kurzreferat möchte ich der Frage nachgehen, wie Kommentare beschaffen sein müssten<br />
und wer solche Beurteilungsregeln festsetzt. Neben normativen Aufstellungen in Ratgebern für den<br />
Journalismus und zu pädagogischen Zwecken finden <strong>sich</strong> im deskriptiven Bereich sprachwissenschaftliche<br />
Textsortenanalysen <strong>mit</strong> Ableitungen. Insgesamt scheint die theoretische Aufarbeitung<br />
dieser Textsorte aber eher spärlich.<br />
Weiter möchte ich exemplarisch aufzeigen, wie Kommentare tatsächlich beschaffen sind, wobei<br />
Qualitäts- und Gratiszeitungen sowie Radio und Fernsehen verglichen werden. Es wird <strong>sich</strong> zeigen,<br />
dass in den verschiedenen Medien auch die Kommentare leicht unterschiedlich sind. Dies ist unter<br />
anderem auf ihre jeweils eigene Spezifik in der multimodalen Gestaltung zurückzuführen. So erlaubt<br />
– im Gegensatz zum herkömmlichen Zeitungskommentar – das Radio <strong>mit</strong> dem Modus der<br />
gesprochenen Sprache Signale der Textsorte auf der paraverbalen Ebene und das Fernsehen zusätzlich<br />
auch noch nonverbale Zeichen.<br />
Literatur:<br />
Fasel, Christoph (2008). Textsorten. Konstanz: UVK (Wegweiser Journalismus, 2).<br />
Häusermann, Jürg (2005 2 ). Journalistisches Texten. Sprachliche Grundlagen für professionelles<br />
Informieren. Konstanz: UVK (Praktischer Journalismus, 43).<br />
Lüter, Albrecht (2008). Die Kommentarlage. Profilbildung und Polyphonie in medienöffentlichen<br />
Diskursen. Wiesbaden: VS Verlag.<br />
Perrin, Daniel (2004). Journalistisches Schreiben – Coaching aus medienlinguistischer Perspektive.<br />
In: Karlfried Knapp et al.: Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. S. 255–275.<br />
Schoenke, Eva (1996). Wirtschaftskommentare. Textlinguistische Analysen, kontrastive Untersuchungen.<br />
Bremen: Universitätsbuchhandlung.<br />
Ramge, Hans (1994). Auf der Suche nach der Evaluation in Zeitungskommentaren. In: Markku<br />
Moilanen & Liisa Tiittula (Hg.): Überredung in der Presse. Texte, Strategien, Analysen. Berlin /<br />
New York: de Gruyter (Sprache. Politik. Öffentlichkeit, 3), S. 101–120.