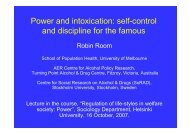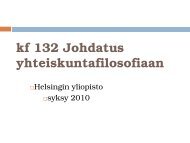Eine pdf-Datei mit allen Abstracts findet sich hier.
Eine pdf-Datei mit allen Abstracts findet sich hier.
Eine pdf-Datei mit allen Abstracts findet sich hier.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hoffmann, Michael (Potsdam/Deutschland):<br />
Kommunikative Dimensionen persuasiver Stile<br />
„Stil ist relational!“ Den von Sandig (2001) formulierten Leitsatz stiltheoretischen Denkens gilt es<br />
persuasionsstilistisch auszuloten. Um die Koordinaten des für persuasive Stile maßgeblichen<br />
Relationengefüges abzustecken und Anschlussstellen für deren Beschreibung zu finden, wird ein<br />
Raster <strong>mit</strong> drei kommunikativen Dimensionen als aus<strong>sich</strong>tsreich erachtet. Es umfasst (1) die kommunikationstypologische,<br />
(2) die kultursemiotische und (3) die argumentationstheoretische Dimension.<br />
Zur kommunikationstypologischen Dimension<br />
Auf der Grundlage eines semiotischen Kommunikationsmodells (vgl. Hoffmann 2004) können Wesensmerkmale<br />
des Kommunikationstyps Persuasion bestimmt werden. So ist persuasive Kommunikation<br />
u.a. codebezogen als elaboriert-strategische Kommunikation zu kennzeichnen. Stilistisch<br />
relevant ist <strong>hier</strong>bei die Beschreibung persuasiver Gestaltungsstrategien, wie sie <strong>sich</strong> bei der Herstellung<br />
thematischer Strukturen in der politischen Werbung (vgl. Hoffmann 1998) oder bei der Präsentation<br />
von Anbieter, Konsument und Weiterem in der kommerziellen Werbung (vgl. Hoffmann<br />
2011) offenbaren.<br />
Zur kultursemiotischen Dimension<br />
Besagtes Kommunikationsmodell stellt semiotisch vielgestaltige Kommunikate in Rechnung und<br />
setzt sie in Relation zu Parametern des kommunikativen Rahmens, des kommunikativen Raums und<br />
des kommunikativen Geschehens. Das Modell ermöglicht deshalb die Relationierung von Persuasion<br />
(als Prozess) und Persuasivität (als Potenz) <strong>mit</strong> einer Vielfalt an Codes, Zeichenarten und Präsuppositionen.<br />
Stilsemiotisch relevant ist u.a. die Beschreibung von (strategischen) Gestaltungszusammenhängen,<br />
in die sprachliche, para- und nichtsprachliche Gestaltungs<strong>mit</strong>tel (als Persuasorien)<br />
integriert sind (vgl. auch Stöckl 2006, 14: „Codeverkoppelungen“). <strong>Eine</strong> auf Mikrostilistika reduzierte<br />
Beschreibung persuasiver Stile (Stilwirkungen) nach sprachsystembezogenen Ebenen (vgl.<br />
Hosman 2008) wird dem Gegenstand nicht gerecht.<br />
Zur argumentationstheoretischen Dimension<br />
Persuasives kommunikatives Handeln kann ein „Überzeugen“ des Adressaten bezwecken, was an<br />
eine argumentative Themenentfaltung gebunden ist. Pragmatische Argumentationsmuster als eine<br />
Hauptressource des rhetorischen Codes für das Gelingen persuasiver Kommunikation erweisen <strong>sich</strong><br />
als stilistisch differenziert. Von Interesse sind u.a. die Muster des topischen (vgl. Quasthoff 1975;<br />
Herbig 1992) und des metaphorischen Argumentierens (vgl. Pielenz 1993; Isberner 2010). Ihre Beschreibung<br />
kann zugleich der Klärung des Verhältnisses von persuasiven Denk- und Sprachstilen<br />
(vgl. Hoffmann 1996) dienlich sein.<br />
Literatur<br />
Herbig, A. F. (1992): „Sie argumentieren doch scheinheilig!“ Sprach- und sprechwissenschaftliche<br />
Aspekte einer Stilistik des Argumentierens. Frankfurt/M. u.a.<br />
Hoffmann, M. (1996): Persuasive Denk- und Sprachstile. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. 6.2,<br />
293-307.<br />
Hoffmann, M. (1998): Gestaltungsstrategien und strategisches Gestalten. Zur Persuasivität von<br />
Thematisierungsstilen im politischen Diskurs. In: M. Hoffmann, Ch. Keßler (Hrsg.): Beiträge zur<br />
Persuasionsforschung. Frankfurt/M. u.a., 57-100.<br />
Hoffmann, M. (2004): Zeichenklassen und Zeichenrelationen bei der Verknüpfung von Text und<br />
Bild. Ein Beitrag zur semiotischen Semantik. In: I. Pohl, K.-P. Konerding (Hrsg.): Stabilität und<br />
Flexibilität in der Semantik. Frankfurt/M. u.a., 357-386.