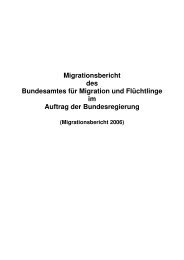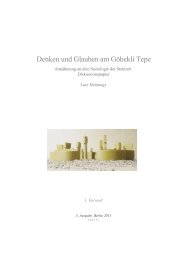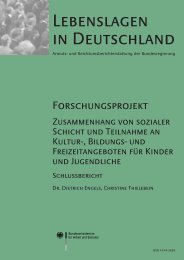3. Migrationslagerung - SSOAR
3. Migrationslagerung - SSOAR
3. Migrationslagerung - SSOAR
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Neben der Gruppendiskussion und dem biographischen Interview, in denen<br />
die Jugendlichen der Gruppe Katze ihre Handlungspraxis auf selbstläufige und<br />
metaphorische Weise schildern, lässt sich der „modus operandi“ des Breakdance<br />
vor allem in seiner Beobachtung rekonstruieren. Hier wird deutlich, dass<br />
der Breakdance nicht aufgrund einer kontemplativen Planung und in Form<br />
eines zweckrationalen Entwurfs entsteht, sondern sich in der Spontaneität der<br />
Handlungspraxis entfaltet. Einzelne Übungen werden, ohne dass darüber<br />
nachgedacht würde, zunächst einfach vollzogen und erhalten erst in der Wiederholung<br />
und in der Retrospektive ihre Signifikanz. Der Breakdance ist insofern<br />
das Produkt eines „Aktionismus“ (Bohnsack et al. 1995, S. 17f), der im<br />
Wesentlichen körperlich vollzogen wird (s. auch Bohnsack/Nohl 2000 a u. b).<br />
Es bietet sich an, den Entstehungsprozess des Breakdance mit dem Begriff<br />
der Mimesis bzw. des mimetischen Handelns (Gebauer/Wulf 1992 u. 1998) zu<br />
beschreiben. Das mimetische Handeln enthält zwar „rationale Elemente, doch<br />
diese entziehen sich zweckrationalen Zugriffen und Annäherungen an die<br />
Welt“ (1992, S. 11). Wenn die Tänzer trainieren, nimmt der eine Tänzer auf die<br />
Übungen des anderen Bezug und führt sie nochmals aus. Diese Bezugnahme<br />
stellt weder eine theoretische Bearbeitung noch eine identische Wiederholung<br />
der ersten Übung dar, in der eine intendierte Veränderung auszumachen wäre.<br />
Vielmehr werden im Noch-einmal-Machen „neue ästhetische Qualitäten“<br />
(1998, S. 16) und Kontingenzen erzeugt. Auf dieser Ebene der Praxis zeigen<br />
sich Gleichartigkeiten zwischen konjunktivem Wissen und mimetischem<br />
Handeln als „Beziehungsgeflecht von Personen“ (1992, S. 11), neben denen<br />
sich auch Gemeinsamkeiten mit der Praxeologie Pierre Bourdieus und insbesondere<br />
mit dem Begriff des „praktischen Sinnes“ (Bourdieu 1987) finden<br />
lassen. Hierauf wird nicht nur bei Bohnsack (vgl. 1999, S. 79f u. 173fi), sondern<br />
auch von Gebauer/Wulf hingewiesen:<br />
Das mimetische Handeln entspricht dem „praktischen Sinn“ insofern, als „dieser in der<br />
Praxis erworben, nicht explizit gelernt und gelehrt, sondern in unzähligen Wiederholungen<br />
geübt und in der Praxis angewendet wird. Er bildet keine von den Bewegungen<br />
getrennte Instanz, sondern ist in den praktischen körperlichen Akten präsent - man weiß<br />
ohne Zögern und ohne Überlegung, was in der Situation geschieht, was sich an zukünftigen<br />
Möglichkeiten aus dieser entwickeln wird und was man in diesem Augenblick zu<br />
tun hat.“ (1998, S. 49, i. O. k.)<br />
Im mimetischen Handeln entsteht also ein sozialer Geschmack. Dieser weist<br />
eine Regelmäßigkeit auf und lässt sich in „klassen- und gruppenspezifische<br />
Muster“ differenzieren (ebd., S. 263). Bei solchen Mustern handelt es sich um<br />
den Habitus (vgl. ebd., S. 27f).<br />
26