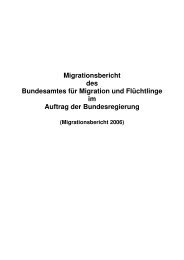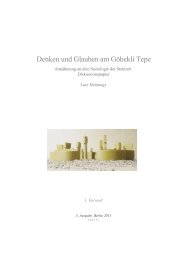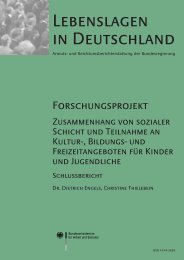3. Migrationslagerung - SSOAR
3. Migrationslagerung - SSOAR
3. Migrationslagerung - SSOAR
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zu verweisen. Wenn die von mir untersuchten Personen sich dann als „Türke“<br />
oder „Araber“ bezeichnen, so verweist dies also nicht unbedingt auf einen<br />
„ethnischen Gemeinsamkeitsglauben“ (Weber 1947b, S. 219), sondern kann<br />
auch eine Metapher für das Leben bzw. „für die besondere Lage, als Türke in<br />
Deutschland t u leben“ (SchifFauer 1997, S. 151, H. i. O.), d. h. für die <strong>Migrationslagerung</strong>,<br />
sein.<br />
An dieser Stelle muss genau zwischen der kommunikativen Selbstpräsentation<br />
im Sinne der „sozialen Identität“ (Goffman) und der konjunktiven Bedeutungsebene<br />
des sozialen Habitus unterschieden werden. Sich als „türkischer<br />
Mitbürger“ zu bezeichnen, wie dies ein Mitglied der Gruppe Geist tut, kann der<br />
Zuordnenbarkeit zu gesellschaftlichen Kategorien in der „Routine sozialen<br />
Verkehrs“ (Goffman 1975, S. 10) dienen. So hat die soziale Identität immer<br />
auch mit Fremdidentifizierung zu tun, d. h. sie ist „zuallererst Teil der Interessen<br />
und Definitionen anderer Personen hinsichtlich des Individuums, dessen<br />
Identität in Frage steht“ (ebd., S. 132).<br />
Neben den beschriebenen Bedeutungsgehalten ethnischer Kategorien (als<br />
Fremdidentifizierung und als kommunikative Selbstpräsentation) findet sich bei<br />
den Jugendlichen meiner Studie eine dritte Funktion: die ethnische Stilisierung<br />
im Zusammenhang mit einem Glauben an die Kontinuität einer ethnischen<br />
Kultur. Gerade insofern im Zuge der Migration sich in ihrem Milieu Brüche<br />
und familienbiographische Diskontinuitäten ergeben haben, fehlt dem ethnischen<br />
Zugehörigkeitsgefiihl der Jugendlichen die Erfahrungsbasis eines konkreten<br />
Raumes und einer spezifischen Zeit. Spätestens in der Migration wandeln<br />
sich die traditionellen, angestammten Milieus und „Gemeinschaften“<br />
(Tönnies 1926) zu „vorgestellten Gemeinschaften“ (Anderson 1988) der Ethnie,<br />
die unabhängig von Zeit und Raum existieren. Im Zusammenhang mit der<br />
fehlenden Erfahrungsbasis wird der „ethnische Gemeinsamkeitsglaube“ (Weber)<br />
dann auch stilisiert.<br />
Zu ethnischen Stilisierungen kommt es insbesondere im Bereich der Familie.<br />
Obwohl in den Schilderungen der Jugendlichen sich hauptsächlich Differenzen<br />
mit der älteren Familiengeneration und weitgehende familienbiographische<br />
Diskontinuitäten dokumentieren, verweisen sie gerade an jenem Punkt, wo<br />
der Gehalt dieser Beschreibungen und Erzählungen nicht mit der positiven<br />
Einschätzung ihrer „türkischen“ Familienverhältnisse übereinstimmt, auf ihre<br />
„deutschen“ Altersgenossen. Diese stellen die Jugendlichen in einen maximalen<br />
Kontrast zu den eigenen Familien. Die „deutschen“ Familien erscheinen als<br />
das absolute Andere, als der Gegenpol des Eigenen.<br />
40