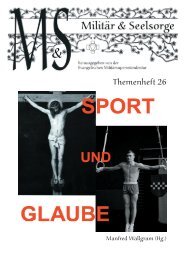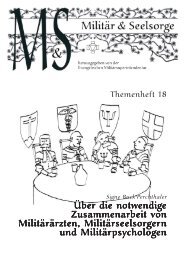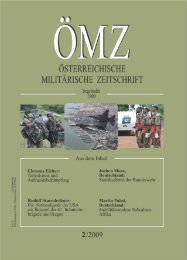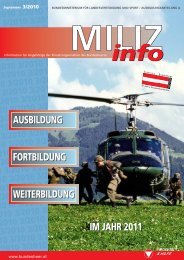ÖMZ 3/2009
ÖMZ 3/2009
ÖMZ 3/2009
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Geschützen) also 192 der „canon de 4, rayé, de campagne“ ins<br />
Feld, dazu noch vier Batterien Zwölfpfünder, ebenfalls in der<br />
Ausführung als gezogene Vorderlader. Napoleon III. ließ den<br />
noch mit glatten Musketen ausgestatteten Verbänden seiner Armee<br />
eine erhöhte Anzahl an gezogenen Geschützen zuteilen, um<br />
einen Ausgleich für die verminderte Reichweite und Feuerkraft<br />
ihrer Infanteriewaffen herzustellen.<br />
Die Bewaffnung<br />
der Österreicher<br />
Das Infanteriegewehr System Lorenz<br />
Der Unterlieutenant Josef Lorenz hatte nach langwierigen<br />
Versuchen ein Kompressionsgeschoß für die Jägerbüchse M 1849<br />
entwickelt und damit eine sehr einfache Methode der Geschoßstauchung<br />
eingeführt. Das Lorenz-Bleigeschoß (Abbildung 3)<br />
wies an seinem hinteren Ende zwei tiefe Rillen auf und wurde<br />
beim Abschuss infolge der Massenträgheit zusammengeschoben,<br />
dadurch breiter und so in Zug und Feld eingepresst.<br />
Dieses Geschoß löste alle Probleme, die bisher durch das<br />
mühsame Stauchen der Kugel mit dem Ladestock und die<br />
schlechten Flugeigenschaften der deformierten Geschoße entstanden<br />
waren.<br />
Die oberste Militärbehörde entschloss sich, alle eingeführten<br />
Handfeuerwaffen durch neue, einheitliche,<br />
gezogene Gewehre nach diesem<br />
System zu ersetzen. Die Neuanfertigung<br />
des Vorderladegewehres Muster 1854<br />
bot die Chance, das Kaliber von den<br />
bisher für Glattrohrmusketen üblichen<br />
18 mm auf 13,9 mm zu reduzieren. Der<br />
Vorteil gegenüber dem französischen<br />
Gewehr System Minié, bei dem das<br />
alte Kaliber beibehalten werden musste,<br />
weil man einfach in die alten Gewehre<br />
Züge eingeschnitten hatte, war ein zweifacher:<br />
Zum ersten wurde die Traglast<br />
für den Soldaten geringer. Die Lorenz-<br />
Patrone wog nur ca. 32 g (Geschoß<br />
28 g, Ladung 4,5 g), 8) also rund zwei<br />
Drittel der französischen Minié-Patrone.<br />
Die gleiche Pulvermenge bei viel<br />
geringerer Geschoßmasse resultierte<br />
in einer höheren Mündungsgeschwindigkeit<br />
und flacherer Flugbahn. Für<br />
die Perkussionszündung wurde ein sehr<br />
praktisches Zündhütchen eingeführt,<br />
das leicht anzubringen war und auch bei Regenwetter eine hohe<br />
Zündsicherheit bot. Der geringere Geschoßquerschnitt ergab<br />
einen geringeren Luftwiderstand im Flug und damit insgesamt<br />
eine höhere Reichweite als das französische Minié-Gewehr.<br />
Der chronische Geldmangel Österreichs - dem damaligen<br />
österreichischen Finanzminister Baron Bruck wird der Ausspruch<br />
zugeschrieben: „Gott erhalte die österreichische Armee,<br />
ich kann es nicht mehr!“ 9) - und die mangelnde Kapazität der<br />
Produktionsstätten führten dazu, dass 1859 nur die Linienregimenter<br />
der in Oberitalien stehenden 2. Armee mit dieser<br />
Waffe ausgerüstet wurden. Die übrigen Truppen verwendeten<br />
das glatte Infanteriegewehr M 1842 weiter. Die Verbände der<br />
in Österreich sehr starken Jägertruppe waren weiterhin mit der<br />
gezogenen Jägerbüchse M 1849, einer Verbesserung des Systems<br />
Delvigne mit dem Lorenz-Kompressionsgeschoß, ausgerüstet.<br />
Damit konnten in der Minute fünf gut gezielte Schüsse abgegeben<br />
werden. Die Jäger rekrutierten sich zum Beispiel aus<br />
Tirol, einem Land, dessen Bevölkerung auch zivil das Schießen<br />
pflegte, beziehungsweise aus einschlägigen Berufen wie Jägern<br />
und Förstern. Sie stellten als erfahrene Schützen in der österreichischen<br />
Armee eine Elitetruppe dar.<br />
Die nach und nach zur Verstärkung nach Oberitalien<br />
verlegten Regimenter wurden zwar mit dem Lorenz-Gewehr<br />
ausgerüstet, eine gründliche Ausbildung an dieser weittragenden<br />
Waffe hatte aber nicht stattgefunden. Sie konnten daher die Vorteile<br />
ihrer Gewehre kaum nützen. Die taktischen Veränderungen,<br />
die sich aus der erhöhten Schussweite ergaben, wurden ebenfalls<br />
nicht bzw. falsch berücksichtigt<br />
Die österreichische Artillerie 1859<br />
Das österreichische Artilleriematerial von 1859 stammte<br />
noch aus der Mitte des vorhergehenden Jahrhunderts. Fürst<br />
Wenzel von Liechtenstein, seit 1744 Generaldirektor der österreichischen<br />
Haus-, Land- und Feld-Artillerie, hatte bis 1753<br />
sein persönliches Vermögen eingesetzt, um für seine verehrte<br />
Kaiserin Maria Theresia jene moderne Artillerie zu schaffen, die<br />
man für die Kriege gegen Preußen benötigte. Er unterband auch<br />
<strong>ÖMZ</strong>-Online 3/<strong>2009</strong> 23