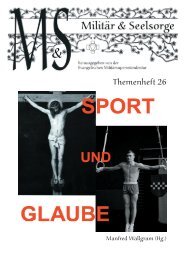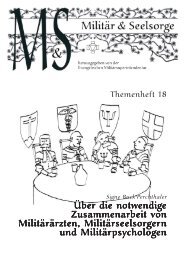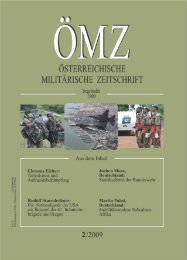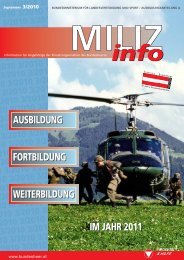ÖMZ 3/2009
ÖMZ 3/2009
ÖMZ 3/2009
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Österreich nach Solferino<br />
Die österreichische militärische Führung hatte aus dem<br />
Geschehen bei Solferino geradezu katastrophale Schlüsse<br />
für die zukünftige Einsatztaktik der Infanterie gezogen. Die<br />
österreichische Artillerieführung dagegen beurteilte die Lage<br />
völlig richtig und schuf in erstaunlicher Schnelligkeit eine neue<br />
Artilleriewaffe, die sich in den folgenden Kriegen ausgezeichnet<br />
schlug.<br />
Das Infanteriegewehr M 1854 war praktisch neu eingeführt<br />
worden, hatte sich nach Ansicht der obersten Militärbehörde<br />
1859 bewährt, es bestand kein Grund - und es gab auch kein<br />
Geld -, es zu ändern. 1861 wurde lediglich die Geschoßform<br />
verändert. Man wechselte vom Lorenzschen Kompressionsgeschoß<br />
zu einem Expansionsgeschoß, das eine etwas höhere<br />
Mündungsgeschwindigkeit erwarten ließ.<br />
Völlig anders war die Lage bei der Artillerie. Frankreich<br />
hatte als erstes Land Geschütze mit gezogenen Rohren nach dem<br />
System La Hitte eingeführt, und die klaren Erfolge in Oberitalien<br />
wurden vor allem den neuen Geschützen zugeschrieben. Das<br />
System La Hitte verbreitete sich demgemäß sehr schnell und fand<br />
in Belgien, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Norwegen, der<br />
Schweiz und in den USA Einführung.<br />
Österreich hatte einige französische La Hitte-Geschütze erbeutet<br />
und damit ausgedehnte Schießversuche unternommen.<br />
Man beschloss, als Zwischenlösung eine Anzahl vorhandener<br />
Glattrohr-Geschütze nach diesem System umzubauen, aber<br />
- wohl in richtiger Erkenntnis der Schwächen des Systems<br />
- die Suche nach einem leistungsfähigeren Geschütz mit<br />
gezogenem Rohr fortzuführen.<br />
Zuerst glaubte die militärische Führung in Wien eine ausgezeichnete<br />
Lösung in dem von dem Artillerieoffizier Oberst<br />
Baron Lenk von Wolfsberg, Departementchef bei der Generalartilleriedirektion,<br />
entwickelten Schießwolle-Geschütz<br />
gefunden zu haben. In einem großen Schritt nach vorne wollte<br />
man zusammen mit neuen gezogenen Vorderladern auch ein<br />
völlig neues Treibmittel, die Schießwolle, 30) einführen, um<br />
möglichst hohe Schussweiten zu erreichen. Nach sehr zufriedenstellenden<br />
Schießversuchen wurde am 19. Februar 1861<br />
die Einführung dieser Kanone beschlossen. 31) Nachdem schon<br />
drei Regimenter damit ausgerüstet worden waren, musste<br />
die weitere Einführung gestoppt werden, weil nacheinander<br />
mehrere Schießwollmagazine ohne äußeren Anlass explodiert<br />
waren. Trotz viel besserer ballistischer Eigenschaften gegenüber<br />
dem Schwarzpulver, wie höherem Gasdruck, keiner<br />
Rauchentwicklung und keinerlei Rückständen, musste dieses<br />
Treibmittel wegen seiner nicht sofort erkennbaren Tendenz zur<br />
Selbstentzündung schließlich aufgegeben werden.<br />
Unter Benützung der wesentlichen konstruktiven Vorteile<br />
des Schießwollgeschützes wurde die Entwicklung fortgeführt.<br />
Vor allen Dingen verbesserte man die Form der Züge so, dass<br />
beim Laden das Geschoß vollkommen zentriert wurde. Die<br />
Besonderheit war die Ausbildung der so genannten Bogenzüge<br />
am Umfang dieses Mantels. Sie passten in die entsprechenden<br />
Züge des Geschützrohres und bewirkten eine wesentlich bessere<br />
Abdichtung, als es die Warzenführung der französischen<br />
La Hitte-Geschütze vermochte. Ähnlich wie bei der La<br />
Hitte-Kanone wurden vier Munitionsarten eingeführt: Hohlgeschoße<br />
(Sprenggranaten), Schrapnells, Brandgeschoße und<br />
Büchsenkartätschen. Um einen problemlosen Ladevorgang zu<br />
ermöglichen, musste der Geschoßdurchmesser um 2,4 mm<br />
kleiner gemacht werden als das Geschützkaliber (Spiel). Beim<br />
Abschuss entwich natürlich ein Teil der Pulvergase durch<br />
diesen Spielraum und verringerte die ballistische Leistung<br />
im Vergleich zu einem Hinterlader. Das Geschütz war aber<br />
der beste Vorderlader, den es je gab.<br />
Die Geschoße wurden mit einem Ladewerkzeug genau<br />
in die Mündung eingesetzt und durch eine Rechtsdrehung<br />
bis zum hinteren Ende des Rohres geführt. Sie bestanden<br />
aus Gusseisen. Um den zylindrischen Eisenhohlkörper war<br />
ein Mantel aus einer Zinn-Zinklegierung gegossen. Die<br />
wichtigste und auch treffgenaueste Munitionsart war das<br />
Hohlgeschoß mit Aufschlagzünder. Die Schrapnelle waren mit<br />
80 Bleikugeln gefüllt und verfügten über einen verbesserten<br />
Brennzünder, der eine relativ gute Einstellung der Flugzeit<br />
bis zur Zerlegung erlaubte. Brandgeschoße und Kartätschen<br />
wurden nur in geringer Zahl mitgeführt, letztere nicht mehr<br />
zum Angriff, sondern nur mehr zur Notabwehr von Infanterieangriffen.<br />
Das neu eingeführte Vierpfünder-Feldgeschütz (8 cm) M<br />
1863 zeichnete sich daher durch seine für damalige Verhältnisse<br />
sehr zufriedenstellenden ballistischen Eigenschaften aus.<br />
Es war dazu außerordentlich leicht, sehr beweglich und manövrierfähig.<br />
Im neu erbauten Artilleriearsenal in Wien wurde<br />
innerhalb von nur zwei Jahren das komplette Geschützmaterial<br />
für die österreichische Artillerie neu gefertigt.<br />
Der Feldzug 1864 gegen Dänemark bot sofort die erste<br />
Gelegenheit, die Verwendbarkeit der neuen Waffe im Einsatz<br />
zu erproben. Man kämpfte gemeinsam mit Preußen. Es zeigte<br />
sich die völlige Überlegenheit der österreichischen gezogenen<br />
Geschütze über die dänische glatte Vorderladerartillerie, auch<br />
im Vergleich mit den glatten deutschen Hinterladern. Preußen<br />
sah sich daraufhin veranlasst, seine Artillerie schnellstens<br />
auf gezogene Geschütze umzurüsten. Bei Beibehaltung<br />
der Hinterladung wurde dabei eine sehr hohe Genauigkeit<br />
beziehungsweise geringe Streuung erreicht. Die von hinten<br />
geladenen Geschoße wurden beim Abschuss in die Züge<br />
gepresst und dichteten das Rohr völlig ab.<br />
Die Lehren aus Magenta und Solferino fanden ihren taktischen<br />
Niederschlag in einem 1865 neu verfassten „Exerzier-<br />
Reglement für die kaiserlich königliche Artillerie“.<br />
Die Feuerstellung (Ziffer 132 des Reglements) sollte auf<br />
alle Fälle vorher erkundet und so ausgewählt werden, dass<br />
die Geschütze vor der Feuereröffnung möglichst verdeckt<br />
waren und auch beim Feuern möglichst viel Deckung besaßen.<br />
Eine Lehre aus dem Gefecht des Hauptmanns Winterstein bei<br />
Melegnano. Als Deckung werden dichte Hecken, Mauern<br />
und Straßendämme empfohlen. Die Batterien mussten in den<br />
Marschkolonnen weit vorne eingegliedert werden, um Zeit für<br />
eine ausreichende Erkundung der Batteriestellungen zu haben.<br />
Die Batterien sollten grundsätzlich zusammenbleiben, feuerten<br />
aber (zur besseren Schussbeobachtung) geschützweise.<br />
Man hatte erkannt, dass die Sprenggranate die wirkungsvollste<br />
Munitionsart war. Gegen Infanterie im offenen deckungslosen<br />
Gelände fand auch das Schrapnell Verwendung, doch sollte<br />
es, wegen der ungenauen Brennzünder, die eine höhere Längenstreuung<br />
ergaben, nur gegen tiefe Ziele wie Kolonnen<br />
oder aus der Flanke heraus Verwendung finden. Gegen breite<br />
Ziele geringer Tiefe - Infanterie in Schwarmlinie - hatte man<br />
erkannt, dass Schrapnelle wenig Wirkung besaßen und ver-<br />
<strong>ÖMZ</strong>-Online 3/<strong>2009</strong> 29