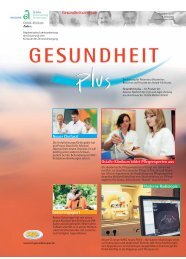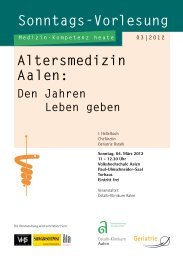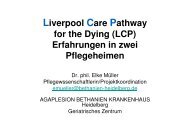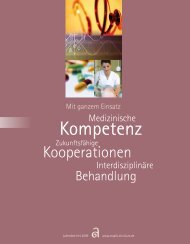Jahresbericht 2004 - Ostalb-Klinikum
Jahresbericht 2004 - Ostalb-Klinikum
Jahresbericht 2004 - Ostalb-Klinikum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin<br />
Dr. Askan Hendrischke<br />
Chefarzt<br />
Das Jahr <strong>2004</strong> war geprägt durch eine<br />
weiterhin positive Entwicklung der<br />
Psychosomatik, die nun im dritten Jahr<br />
besteht. Dies äußerte sich einerseits in<br />
der klinischen Arbeit, die auch überregional<br />
zunehmend auf Interesse stößt,<br />
andererseits in multiplen Aktivitäten,<br />
die von der Klinik organisiert und durchgeführt<br />
wurden.<br />
Leistungsentwicklung im stationären<br />
Bereich<br />
Im Jahr <strong>2004</strong> wurden 163 Patienten stationär<br />
behandelt (2003: 159), 72 % davon<br />
weiblich und 28 % männlich. Fast 55 % der<br />
behandelten Patienten hatten ihren Wohnsitz<br />
im Altkreis Aalen, 27 % der Patienten<br />
lebte innerhalb eines Radius von 30–40 km,<br />
die übrigen 18 % der Patienten kamen aus<br />
der weiteren Umgebung, mit zunehmender<br />
Tendenz. Kostenträger der Behandlung war<br />
in 75 % eine gesetzliche Krankenversicherung,<br />
in 23 % eine private Krankenversicherung,<br />
in 2 % war es die BG. Die durchschnittliche<br />
Verweildauer lag mit 39,2 Tagen<br />
wiederum unter der mit den Kostenträgern<br />
vereinbarten Zahl von 42,8 Tagen. Damit<br />
waren die 18 Betten im Jahresdurchschnitt<br />
zu 97,1 % belegt.<br />
Konsiliarbereich und Aufnahmeambulanz<br />
Im psychosomatischen Konsil- und Liaisondienst<br />
wurden im Jahr <strong>2004</strong> 257 Patienten<br />
der übrigen Abteilungen des <strong>Ostalb</strong>-<strong>Klinikum</strong>s<br />
gesehen. Diese Konsilanfragen betrafen<br />
40<br />
Patienten, deren psychosoziale Belastungen<br />
zu körperlichen Funktionsstörungen oder<br />
zu emotionalen Problemen geführt hatten.<br />
Die PatientInnen der Inneren Medizin machten<br />
dabei den größten Anteil aus (n=88 Pat.),<br />
gefolgt von den PatientInnen aus der<br />
Frauenklinik (n=67 Pat.), der Chirurgie<br />
(n=51 Pat.), der Neurologie (n=37 Pat.) und<br />
den pädiatrischen (n=12 Pat.) bzw. neurochirurgischen<br />
PatientInnen (n=2). Häufig<br />
war eine Krisenintervention bei Patienten<br />
mit Suizidversuch im Bereich der Notaufnahme<br />
oder auf der internistischen Intensivstation<br />
nötig.<br />
In der Ambulanz wurden im Jahr <strong>2004</strong> bei<br />
ca. 280 Patienten ein- oder mehrmalige Gespräche<br />
(n=393 Gespräche) durchgeführt,<br />
um die Notwendigkeit einer Behandlung in<br />
der Psychosomatik abzuklären. Die überweisenden<br />
Haus- oder Fachärzte wurden<br />
dazu telephonisch oder schriftlich in den<br />
Entscheidungsprozess einbezogen.<br />
Patienten, die nicht stationär im <strong>Ostalb</strong>-<br />
<strong>Klinikum</strong> aufgenommen werden mussten,<br />
erhielten eine Empfehlung zur ambulanten<br />
Psychotherapie, zur psychosomatischen<br />
Grundversorgung oder zur Behandlung in<br />
einer ortsfernen psychosomatischen Fachbzw.<br />
Reha-Klinik. Häufig erfolgte auch die<br />
Vermittlung an örtliche Selbsthilfegruppen,<br />
zu denen ein guter Kontakt besteht.<br />
Vielfach wurden auch Patienten aus der<br />
Schmerzambulanz des <strong>Ostalb</strong> <strong>Klinikum</strong>s<br />
konsiliarisch vorgestellt, insbesondere wenn<br />
es um die diagnostische Einordnung des<br />
psychosomatischen Krankheitsanteils bei<br />
chronifizierten Schmerzstörungen ging,<br />
oder wenn im Rahmen eines koordinierten<br />
Behandlungsplans eine stationäre Mitbehandlung<br />
des Patienten in der Psychosomatik<br />
indiziert erschien.<br />
Poststationäres Behandlungsangebot<br />
hat sich bewährt<br />
Um den Übergang in den Alltagsbereich zu<br />
erleichtern, hatten wir seit 2003 unseren<br />
Patienten nach einer mehrwöchigen stationären<br />
Therapie die ambulante Teilnahme<br />
an allen Gruppenangeboten der Station<br />
für die Dauer von 14 Tagen ermöglicht.<br />
Ca. 30 % der Patienten haben dieses Angebot<br />
genutzt.<br />
Bei ca. 60 % der Patienten der Psychosomatik<br />
besteht darüber hinaus nach Entlassung<br />
aus stationärer Therapie die Indikation<br />
zu einer ambulanten Psychotherapie.<br />
Dies ist nötig, um den Behandlungserfolg<br />
dauerhaft zu sichern, neue Entwicklungsschritte<br />
therapeutisch zu begleiten und<br />
Rückfälle in dysfunktionale Muster zu vermeiden.<br />
Ein Teil dieser Patienten konnte<br />
poststationär in ambulante Weiterbehandlung<br />
bei niedergelassenen Psychotherapeuten<br />
vermittelt werden. Zusätzlich hatten<br />
wir nach Erteilung einer persönlichen<br />
Ambulanzermächtigung für Dr. Hendrischke<br />
ab 2003 eine ambulante Nachsorge eingerichtet.<br />
Entwicklung störungsspezifischer<br />
Behandlungspfade<br />
Die im Vorjahr begonnene Formulierung<br />
störungsspezifischer Behandlungskonzepte<br />
konnte im Jahr <strong>2004</strong> für ausgewählte Krankheitsbilder<br />
im Sinne klinischer Behandlungspfade<br />
weiter spezifiziert werden. Grundlage<br />
dafür waren die Leitlinien der wissenschaftlichen<br />
Fachgesellschaften (www.awmf-online.de),<br />
verknüpft mit den Erfahrungen, die<br />
in der Aalener Psychosomatik inzwischen<br />
gesammelt werden konnten. Ziel ist es, für<br />
Patienten und ihre Angehörigen, für Behandler<br />
und nicht zuletzt für die Kostenträger<br />
einen Bezugsrahmen zu schaffen,<br />
der allen Beteiligten ein hohes Maß an prozessorientierter<br />
Transparenz und Reliabilität<br />
ermöglicht. Behandlungsqualität und –effizienz<br />
sind hier die Stichworte, denen wir<br />
uns zu stellen haben.<br />
Interessierte können die Texte der Leitlinien<br />
und die jeweiligen Arbeitsmaterialien unter<br />
www.psychosomatik-aalen.de abrufen.<br />
Einzelheiten zu unserer Leitlinie Chronische<br />
Schmerzkrankheit finden Sie auch unter<br />
www.schmerzklinik-aalen.de.<br />
Eine Übersichtsarbeit zur stationären Behandlung<br />
chronischer Schmerzstörungen in<br />
der Aalener Psychosomatik wurde soeben<br />
in der größten deutschen Psychotherapie-<br />
Zeitschrift veröffentlicht (Schwerpunktheft<br />
Schmerz, Psychotherapie im Dialog PiD,<br />
Heft 1/2005, Thieme Verlag, Stuttgart). Der<br />
Text kann unter www.thieme-connect.de<br />
abgerufen werden.