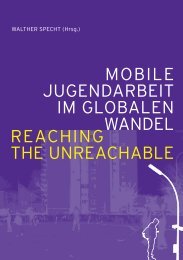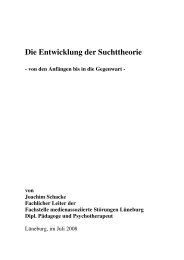Freiraumanalyse Schöpfwerk 2013 - Verein Wiener Jugendzentren
Freiraumanalyse Schöpfwerk 2013 - Verein Wiener Jugendzentren
Freiraumanalyse Schöpfwerk 2013 - Verein Wiener Jugendzentren
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Forschungsprozess und Methode<br />
<strong>Freiraumanalyse</strong> Am Schöpfwerk <strong>2013</strong><br />
Ausgangslage<br />
Nach der abgeschlossenen Gebäudesanierung steht für die Bezirksvorstehung die Parkanlage Am Schöpfwerk (im<br />
Volksmund „Hügelpark“ genannt) zur Umgestaltung an. Anläßlich der Reflexion des „BürgerInnenrates“ im Herbst<br />
2012 mit Bezirksvorsteherin Frau Votava, Bezirksrätin Frau Nemec und Bezirskrat Herr Zankl wurde von der Bassena<br />
angeboten, eine erweiterte Analyse der Nutzung des öffentlichen Raumes in Kooperation mit dem Jugendzentrum und<br />
dem Nachbarschaftszentrum zu erstellen.<br />
Es sollten damit auch die anderen Spiel- und Freizeiträume in Augenschein genommen werden, um ein Gesamtbild<br />
über die Nutzung der Freiflächen im Siedlungsgebiet zu erhalten, was als Informationsmaterial für die weitere Planung<br />
nützlich ist. Um eine Analyse der Nutzungen und Bedürfnisse aller Altersgruppen der BewohnerInnen des Schöpfwerks<br />
und der AnrainerInnen (Kleingartenanlage) zu erheben bot sich an, eine Befragung allgemein zu den öffentlichen Orten<br />
am und ums Schöpfwerk zu machen. Ein speziell entwickeltes Tool von Bernd Rohrauer (FH Campus Wien, Stadtteilzentrum<br />
Bassena) diente der Auswertung.<br />
Forschungsinteresse<br />
Die Erhebung der Bedürfnisse der Am Schöpfwerk lebenden BewohnerInnen hinsichtlich der Freiraumnutzung des<br />
Schöpfwerks.<br />
Forschungsdesign<br />
Als geeignetes Forschungsdesign wurde ein Methodenmix aus Phasenmodell der Methodenintegration (vgl. Kelle 2004,<br />
51) und Datentriangulation (vgl. Flick 2004, 12 ff) gewählt. Es wurden für den<br />
Zweck der Befragung drei Kernfragen herausgearbeitet, die mittels eines auf<br />
der Nadelmethode nach Deinet/Krisch (Deinet 2010, 45) und Ortman (1996, 29)<br />
beruhenden und durch das Projektteam weiterentwickelten sozialräumlichen<br />
computerbasierten Forschungsinstruments beforscht wurden.<br />
Die herausgearbeiteten Kernfragen lauteten:<br />
Frage 1: Wo halten Sie sich gerne/oft auf?<br />
Wenn sie frei haben, wenn sie draußen sind?<br />
Frage 2: Wo halten Sie sich nicht gerne auf?<br />
Frage 3: Wo würden Sie sich gerne aufhalten?<br />
Aus diesen drei Kernfragen wurde ein Leitfragebogen mit erweiternden Fragen entwickelt, die erkenntnisfördernde<br />
qualitative Daten bereitstellen sollten. Diese Daten wiederum stellten einerseits Material für die qualitative Analyse bereit<br />
und wurden durch die InterviewführerInnen den durch Vorerhebung herausgearbeiteten und jeweilig zutreffenden<br />
Clustern zugewiesen, was gute Einblicke in quantitative Verteilungen bezogen auf diverse Fragestellungen erlaubt und<br />
die Möglichkeit der datentriangulativen Auswertung des gesammelten Materials begründet.<br />
Das Nadeltool<br />
Das Nadeltool in der bereitgestellten Version erweitert die Nadelmethode in einigen<br />
Punkten und erlaubt die computergestützte Verarbeitung der umfangreichen<br />
Datensätze nach verschiedenen Kriterien. Als erweiternd zum Tragen kommen<br />
hierbei die Faktoren Zeit (Potential für Längsschnittstudien), quantitative Analyse<br />
(systematische clusterorientierte Auswertbarkeit), Datentriangulation (Auswertung<br />
der qualitativen Daten in Relation zu quantitativen Daten) und das Potential für<br />
Sekundärdatenanalysen.<br />
Phasierung des Projektes (März bis Juni <strong>2013</strong>) – Die vier Kernphasen der Beforschung:<br />
1. Vorbereitungsphase: Vorbesprechungen mit der Bezirksvorstehung Meidling und der MA42/Gartenbezirk 4. Ausarbeitung<br />
des Forschungsdesigns, des Leitfragebogens und Bereitstellung der nötigen Ressourcen.<br />
2. Vorerhebungsphase (Mitte März bis Anfang April): Mittels einer qualitativen Probebefragung wurden anhand von<br />
20 Interviews die für die Studie relevanten Kategorien/Cluster herausgearbeitet. Es folgte eine Evaluierung der Interviewerfahrungen<br />
und eine weitere Abstimmung des Tools sowie die Einschulung der ProjektmitarbeiterInnen (Handhabung<br />
Leitfragebogen und Tool, Gewaltfreie Kommunikation)<br />
3. Erhebungsphase (Mitte April bis Anfang Juni): Es wurden anhand des Leitfragebogens im Zeitraum zwischen<br />
April und Mitte Juni 145 Interviews geführt und in das Nadeltool eingespeist. Die Interviews wurden im Sinne einer<br />
induktionstauglichen Stichprobe an verschiedenen Orten sowohl im öffentlichen Raum, sowie auch in den Wohnungen<br />
(Stiegenhausbefragungen) geführt.<br />
4. Auswertungsphase (Juni): In der ersten Auswertungsphase (Anfang Juni bis 13. Juni) erfolgte eine quantitative<br />
Analyse der Datensätze durch das Projektteam zur Herausarbeitung der wesentlichen Kernthesen anhand auffälliger<br />
Tendenzen und Spitzen. Die weitere Ausarbeitung, Beleuchtung, Überprüfung der Thesen durch spezifische qualitative<br />
Sichtungen und Analysen des Materials und die Interpretation dieser Ergebnisse bildeten den nächsten Projektschritt.<br />
Zuletzt galt es diese Ergebnisse knapp und bündig in der aufliegenden Projektmappe zusammenzutragen.<br />
3