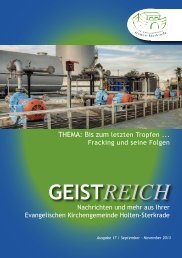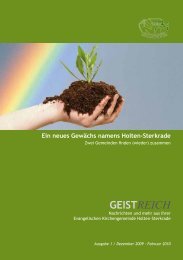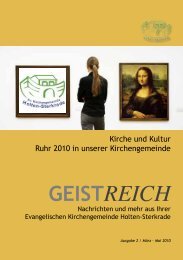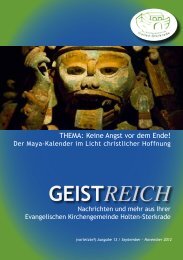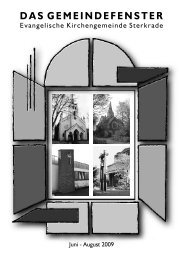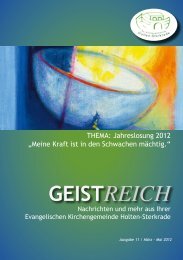GeistReich 3/2012 - Evangelische Kirchengemeinde
GeistReich 3/2012 - Evangelische Kirchengemeinde
GeistReich 3/2012 - Evangelische Kirchengemeinde
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
GEISTREICH<br />
Von der Freiheit<br />
eines Christenmenschen<br />
„Von der Freyheith eines Christenmenschen“<br />
(lateinischer Titel: De libertate<br />
christiana) ist der Titel einer aus 30<br />
Thesen bestehenden Denkschrift Martin<br />
Luthers aus dem Jahr 1520. Das Werk<br />
Luthers gehört zu seinen bedeutendsten<br />
Schriften zur Reformationszeit. Die Denkschrift<br />
widmete Luther seinem Freund Hieronymus<br />
Mehlpfordt (Hermann Mühlpfordt),<br />
dem Bürgermeister der Stadt Zwickau in<br />
Sachsen.<br />
Anlass für die Schrift war die gegen<br />
Martin Luther gerichtete päpstliche Bannbulle.<br />
Der Kammerherr Karl von Miltitz<br />
aus Sachsen versuchte im Streit zwischen<br />
Luther und dem Papsttum zu vermitteln,<br />
indem er einen Sendbrief an Papst Leo X.<br />
schrieb und ihm die ins Lateinische übersetzte<br />
Denkschrift hinzufügte.<br />
Im Mittelalter galt das Christentum als<br />
heilige Ordnung, welche jedem Menschen<br />
einen festen, von Gott vorbestimmten<br />
Platz zuordnete. Die Kirche als Ganzes<br />
hatte zwar laut dem Evangelium die Freiheit,<br />
diese Ordnung im Wesentlichen nach<br />
eigenem Gutdünken festzulegen (im Gegensatz<br />
zur Bindung an ein detailliertes<br />
göttliches Gesetz, wie es das Judentum<br />
kannte). Der einzelne Mensch aber hatte<br />
sich in diese Ordnung einzufügen. Nur<br />
durch die Einfügung in die Ordnung und<br />
die Erfüllung vielfältiger, von der Kirche<br />
definierter formaler Pflichten hatte der<br />
Christ gemäß der bis dahin verbindlichen<br />
Rechtfertigungslehre Teil am Heil Christi.<br />
Damit wirkte Religion der individuellen irdischen<br />
Freiheit direkt entgegen und verwies<br />
lediglich auf ein jenseits besseres,<br />
gerechtfertigtes Leben bei Gott.<br />
Martin Luther setzte dieser Sichtweise<br />
radikal die den Schriften des Paulus<br />
entnommene Auffassung entgegen, dass<br />
der Christenmensch gerade im Hier und<br />
Thema<br />
Jetzt frei sein müsse. Luther begründet<br />
dies damit, dass der Mensch nicht durch<br />
Taten, sondern allein durch den Glauben<br />
gerechtfertigt sei. Allerdings hatte auch<br />
Paulus christlichen Sklaven dazu geraten,<br />
sich nicht gegen (christliche) Herren zur<br />
Wehr zu setzen (1. Korintherbrief, Kap. 7,<br />
21-24), da wahre Freiheit nur im Glauben<br />
an Jesus Christus zu finden sei. (vgl. Johannesevangelium<br />
Kap. 8,32.34.36).<br />
Von der Freyheith eines Christenmenschen<br />
markiert eine geistesgeschichtliche<br />
Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit.<br />
In den Thesen postulierte er die Summe<br />
der christlichen Freiheiten. Diese stehen<br />
nicht unabhängig nebeneinander, sondern<br />
stellen nach heutigem Verständnis eher<br />
eine Argumentationsreihenfolge dar. Der<br />
zentrale Gedanke besteht in einer Umkehrung<br />
der bis dahin geltenden Grundauffassung<br />
der Beziehung zwischen Religion<br />
und Freiheit.<br />
Die <strong>Evangelische</strong> Freiheit wird durch folgende<br />
Stelle der Luther-Schrift oft zitiert:<br />
„Ein Christenmensch ist ein freier<br />
Herr über alle Dinge und niemand<br />
untertan. Ein Christenmensch ist ein<br />
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann<br />
untertan.“<br />
Luthers Text hatte – von ihm selbst ungewollt<br />
– bedeutenden Einfluss auf den<br />
Deutschen Bauernkrieg, da die aufständischen<br />
Bauern den Begriff Freiheit (von<br />
Luther in rein theologischem Sinn verwendet)<br />
auf ihre weltliche Lebenssituation bezogen<br />
und deshalb in den zwölf Artikeln<br />
das Ende der Leibeigenschaft von ihren<br />
Grundherren forderten. Luther distanzierte<br />
sich 1525 mit seiner Schrift „Wider die<br />
mörderischen Rotten der Bauern“ jedoch<br />
scharf von dieser Gewalt rechtfertigenden<br />
Lesart seines Textes.<br />
aus: wikipedia.de<br />
Ev. Kgm. Holten-Sterkrade Juni - August <strong>2012</strong><br />
7