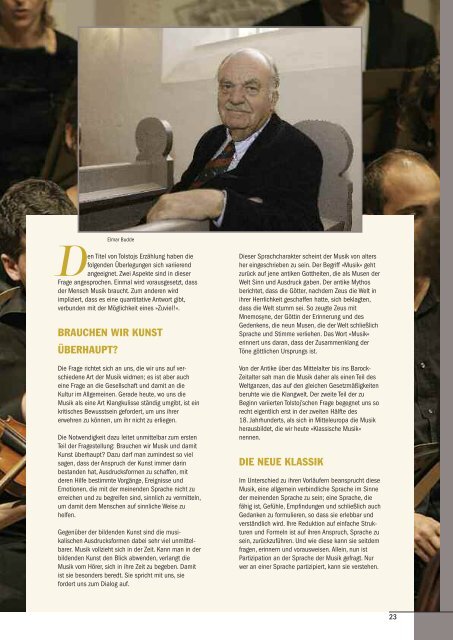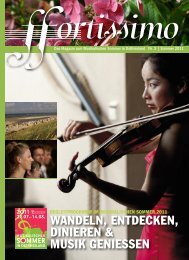Die Konzerte 2010 - Musikalische Sommer
Die Konzerte 2010 - Musikalische Sommer
Die Konzerte 2010 - Musikalische Sommer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Elmar Budde<br />
Den Titel von Tolstojs Erzählung haben die<br />
folgenden Überlegungen sich variierend<br />
angeeignet. Zwei Aspekte sind in dieser<br />
Frage angesprochen. Einmal wird vorausgesetzt, dass<br />
der Mensch Musik braucht. Zum anderen wird<br />
impliziert, dass es eine quantitative Antwort gibt,<br />
verbunden mit der Möglichkeit eines »Zuviel!«.<br />
BRAUCHEN WIR KUNST<br />
ÜBERHAUPT?<br />
<strong>Die</strong> Frage richtet sich an uns, die wir uns auf ver -<br />
schiedene Art der Musik widmen; es ist aber auch<br />
eine Frage an die Gesellschaft und damit an die<br />
Kultur im Allgemeinen. Gerade heute, wo uns die<br />
Musik als eine Art Klangkulisse ständig umgibt, ist ein<br />
kritisches Bewusstsein gefordert, um uns ihrer<br />
erwehren zu können, um ihr nicht zu erliegen.<br />
<strong>Die</strong> Notwendigkeit dazu leitet unmittelbar zum ersten<br />
Teil der Fragestellung: Brauchen wir Musik und damit<br />
Kunst überhaupt? Dazu darf man zumindest so viel<br />
sagen, dass der Anspruch der Kunst immer darin<br />
bestanden hat, Ausdrucksformen zu schaffen, mit<br />
deren Hilfe bestimmte Vorgänge, Ereignisse und<br />
Emotionen, die mit der meinenden Sprache nicht zu<br />
erreichen und zu begreifen sind, sinnlich zu vermitteln,<br />
um damit dem Menschen auf sinnliche Weise zu<br />
helfen.<br />
Gegenüber der bildenden Kunst sind die musikalischen<br />
Ausdrucksformen dabei sehr viel unmittelbarer.<br />
Musik vollzieht sich in der Zeit. Kann man in der<br />
bildenden Kunst den Blick abwenden, verlangt die<br />
Musik vom Hörer, sich in ihre Zeit zu begeben. Damit<br />
ist sie besonders beredt. Sie spricht mit uns, sie<br />
fordert uns zum Dialog auf.<br />
<strong>Die</strong>ser Sprachcharakter scheint der Musik von alters<br />
her eingeschrieben zu sein. Der Begriff »Musik« geht<br />
zurück auf jene antiken Gottheiten, die als Musen der<br />
Welt Sinn und Ausdruck gaben. Der antike Mythos<br />
berichtet, dass die Götter, nachdem Zeus die Welt in<br />
ihrer Herrlichkeit geschaffen hatte, sich beklagten,<br />
dass die Welt stumm sei. So zeugte Zeus mit<br />
Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung und des<br />
Gedenkens, die neun Musen, die der Welt schließlich<br />
Sprache und Stimme verliehen. Das Wort »Musik«<br />
erinnert uns daran, dass der Zusammenklang der<br />
Töne göttlichen Ursprungs ist.<br />
Von der Antike über das Mittelalter bis ins Barock-<br />
Zeitalter sah man die Musik daher als einen Teil des<br />
Weltganzen, das auf den gleichen Gesetzmäßigkeiten<br />
beruhte wie die Klangwelt. Der zweite Teil der zu<br />
Beginn variierten Tolstoj’schen Frage begegnet uns so<br />
recht eigentlich erst in der zweiten Hälfte des<br />
18. Jahrhunderts, als sich in Mitteleuropa die Musik<br />
herausbildet, die wir heute »Klassische Musik«<br />
nennen.<br />
DIE NEUE KLASSIK<br />
Im Unterschied zu ihren Vorläufern beansprucht diese<br />
Musik, eine allgemein verbindliche Sprache im Sinne<br />
der meinenden Sprache zu sein; eine Sprache, die<br />
fähig ist, Gefühle, Empfindungen und schließlich auch<br />
Gedanken zu formulieren, so dass sie erlebbar und<br />
verständlich wird. Ihre Reduktion auf einfache Struk -<br />
turen und Formeln ist auf ihren Anspruch, Sprache zu<br />
sein, zurückzuführen. Und wie diese kann sie seitdem<br />
fragen, erinnern und vorausweisen. Allein, nun ist<br />
Partizipation an der Sprache der Musik gefragt. Nur<br />
wer an einer Sprache partizipiert, kann sie verstehen.<br />
23