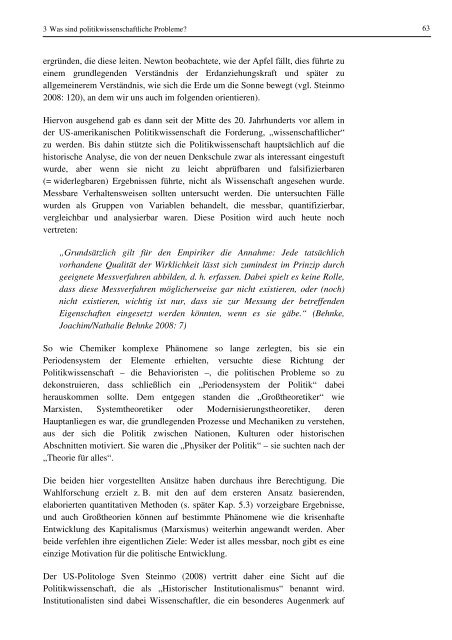Studium und Arbeitstechniken der Politikwissenschaft
Studium und Arbeitstechniken der Politikwissenschaft
Studium und Arbeitstechniken der Politikwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3 Was sind politikwissenschaftliche Probleme? 63ergründen, die diese leiten. Newton beobachtete, wie <strong>der</strong> Apfel fällt, dies führte zueinem gr<strong>und</strong>legenden Verständnis <strong>der</strong> Erdanziehungskraft <strong>und</strong> später zuallgemeinerem Verständnis, wie sich die Erde um die Sonne bewegt (vgl. Steinmo2008: 120), an dem wir uns auch im folgenden orientieren).Hiervon ausgehend gab es dann seit <strong>der</strong> Mitte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts vor allem in<strong>der</strong> US-amerikanischen <strong>Politikwissenschaft</strong> die For<strong>der</strong>ung, „wissenschaftlicher“zu werden. Bis dahin stützte sich die <strong>Politikwissenschaft</strong> hauptsächlich auf diehistorische Analyse, die von <strong>der</strong> neuen Denkschule zwar als interessant eingestuftwurde, aber wenn sie nicht zu leicht abprüfbaren <strong>und</strong> falsifizierbaren(= wi<strong>der</strong>legbaren) Ergebnissen führte, nicht als Wissenschaft angesehen wurde.Messbare Verhaltensweisen sollten untersucht werden. Die untersuchten Fällewurden als Gruppen von Variablen behandelt, die messbar, quantifizierbar,vergleichbar <strong>und</strong> analysierbar waren. Diese Position wird auch heute nochvertreten:„Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt für den Empiriker die Annahme: Jede tatsächlichvorhandene Qualität <strong>der</strong> Wirklichkeit lässt sich zumindest im Prinzip durchgeeignete Messverfahren abbilden, d. h. erfassen. Dabei spielt es keine Rolle,dass diese Messverfahren möglicherweise gar nicht existieren, o<strong>der</strong> (noch)nicht existieren, wichtig ist nur, dass sie zur Messung <strong>der</strong> betreffendenEigenschaften eingesetzt werden könnten, wenn es sie gäbe.“ (Behnke,Joachim/Nathalie Behnke 2008: 7)So wie Chemiker komplexe Phänomene so lange zerlegten, bis sie einPeriodensystem <strong>der</strong> Elemente erhielten, versuchte diese Richtung <strong>der</strong><strong>Politikwissenschaft</strong> – die Behavioristen –, die politischen Probleme so zudekonstruieren, dass schließlich ein „Periodensystem <strong>der</strong> Politik“ dabeiherauskommen sollte. Dem entgegen standen die „Großtheoretiker“ wieMarxisten, Systemtheoretiker o<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierungstheoretiker, <strong>der</strong>enHauptanliegen es war, die gr<strong>und</strong>legenden Prozesse <strong>und</strong> Mechaniken zu verstehen,aus <strong>der</strong> sich die Politik zwischen Nationen, Kulturen o<strong>der</strong> historischenAbschnitten motiviert. Sie waren die „Physiker <strong>der</strong> Politik“ – sie suchten nach <strong>der</strong>„Theorie für alles“.Die beiden hier vorgestellten Ansätze haben durchaus ihre Berechtigung. DieWahlforschung erzielt z. B. mit den auf dem ersteren Ansatz basierenden,elaborierten quantitativen Methoden (s. später Kap. 5.3) vorzeigbare Ergebnisse,<strong>und</strong> auch Großtheorien können auf bestimmte Phänomene wie die krisenhafteEntwicklung des Kapitalismus (Marxismus) weiterhin angewandt werden. Aberbeide verfehlen ihre eigentlichen Ziele: We<strong>der</strong> ist alles messbar, noch gibt es eineeinzige Motivation für die politische Entwicklung.Der US-Politologe Sven Steinmo (2008) vertritt daher eine Sicht auf die<strong>Politikwissenschaft</strong>, die als „Historischer Institutionalismus“ benannt wird.Institutionalisten sind dabei Wissenschaftler, die ein beson<strong>der</strong>es Augenmerk auf