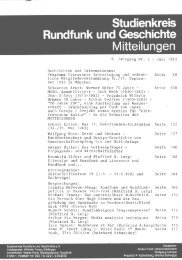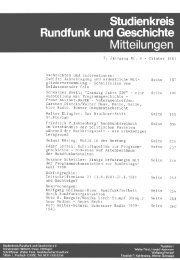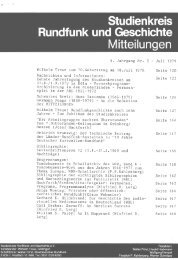Kommunikationsprozesse - Studienkreis Rundfunk und Geschichte
Kommunikationsprozesse - Studienkreis Rundfunk und Geschichte
Kommunikationsprozesse - Studienkreis Rundfunk und Geschichte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hagenah, Ahle <strong>und</strong> Weißpflug: Determinanten der Nachrichtennutzung 17<br />
sein des Publikums erreicht«. 7 Nach Staab gibt es<br />
unter anderem folgende Nachrichtenfaktoren: Status<br />
der Ereignisnation/-region, räumliche Nähe, kulturelle<br />
Nähe, Prominenz, tatsächlicher/ möglicher<br />
Schaden, Überraschung, Reichweite. 8 Nach Christiane<br />
Eilders spielen die Nachrichtenfaktoren jedoch<br />
nicht nur bei der journalistischen Verarbeitung eine<br />
Rolle, sondern auch bei der Rezeption. 9 Sie beeinflussen<br />
das Interesse der Zuschauer an <strong>und</strong> deren<br />
Hinwendung zu den Nachrichten.<br />
Eine gezielte Hinwendung zu Nachrichtensendungen<br />
kann natürlich nur unter der Voraussetzung erfolgen,<br />
dass die Inhalte bzw. Ereignisse schon vorab<br />
bekannt geworden sind – beispielsweise über andere<br />
Medien oder interpersonelle Kommunikation. Man<br />
kann jedoch davon ausgehen, dass herausragende<br />
Ereignisse den meisten Menschen schon vor den<br />
Abendnachrichten bekannt sind, denn: ȟber 70%<br />
lesen regelmäßig eine Tageszeitung, nahezu 75%<br />
hören tagsüber Nachrichtensendungen im <strong>R<strong>und</strong>funk</strong>«<br />
10 <strong>und</strong> der Rest kommuniziert mit denjenigen,<br />
die von dem Ereignis vorab erfahren haben. Somit<br />
kann angenommen werden, dass infolge von herausragenden<br />
Ereignissen, die einen entsprechend<br />
höheren Nachrichtenwert aufweisen, die Nachrichtennutzung<br />
stärker ausfällt. 11<br />
Einschränkend soll angemerkt werden, dass die<br />
subjektive Beurteilung des Nachrichtenwerts oft erst<br />
bei der stattfindenden Rezeption der Nachrichten<br />
selektiv zum Tragen kommt <strong>und</strong> nicht bereits im Vorfeld<br />
der Rezeption. Eilders beschreibt dies folgendermaßen:<br />
»Da sowohl Inhalt als auch Abfolge der<br />
Beiträge innerhalb einer Nachrichtensendung meistens<br />
unbekannt sind, nutzen Rezipienten in der Regel<br />
alle Beiträge. Hier kann lediglich durch ein erhöhtes<br />
Maß an Aufmerksamkeit ein bestimmter Beitrag<br />
‚ausgewählt‘ werden.« 12 Folglich muss berücksichtigt<br />
werden, dass selbst bei herausragenden Ereignissen<br />
die notwendige Information zur Vorab-Beurteilung<br />
des Nachrichtenwertes eines Ereignisses<br />
nicht unbedingt gegeben sein muss, was wiederum<br />
eine verstärkte Zuwendung zu den Hauptnachrichten<br />
verhindern könnte.<br />
Beim dynamisch-transaktionalen Modell wird davon<br />
ausgegangen, dass Medienwirkungen ein Ergebnis<br />
von Austauschprozessen zwischen Kommunikator<br />
<strong>und</strong> Rezipient sind. 13 Der Medienkontakt wird<br />
dadurch determiniert, dass Austauschprozesse <strong>und</strong><br />
gegenseitige Beurteilung zwischen Rezipient <strong>und</strong><br />
Medieninstitution (Kommunikator) stattfinden. Diese<br />
Zusammenhänge werden als Inter-Transaktionen<br />
bezeichnet. Im Gegensatz dazu stellen die Intra-<br />
Transaktionen die Prozesse innerhalb des kognitiven<br />
Systems der Kommunikationspartner dar. Beim Re-<br />
zipienten finden Transaktionen zwischen seinen Vorkenntnissen<br />
zum Inhalt der Medienbotschaft (bzw.<br />
Ereignis) <strong>und</strong> seiner Aufmerksamkeit dem gegenüber<br />
statt. Vereinfacht dargestellt: Informationen zu<br />
einem bestimmten Ereignis führen beim Rezipienten<br />
zu mehr Interesse am Thema <strong>und</strong> somit zu (stärkerer)<br />
Nachrichtennutzung. Diese wiederum veranlasst die<br />
Medieninstitutionen zu weiterer Berichterstattung. 14<br />
Daraus kann man schließen, dass infolge eines herausragenden<br />
Ereignisses über ein bestimmtes Zeitintervall<br />
eine stärkere Nachfrage nach weiteren<br />
Informationen entsteht, welche vermehrte Berichterstattung<br />
nach sich zieht, die wiederum intensiv genutzt<br />
wird. Gemäß der Ereignishypothese wird also<br />
erwartet, dass die Nachrichten an Ereignis- <strong>und</strong> Ereignisfolgetagen<br />
stärker rezipiert werden als davor.<br />
Des Weiteren müssen intervenierende Faktoren berücksichtigt<br />
werden, welche die Nachrichtennutzung<br />
von Tag zu Tag neu bedingen (Wetter, Wochentag),<br />
also situationale Einflüsse. Außerdem stellt sich die<br />
Frage nach konstanten Einflussfaktoren (Soziodemographie)<br />
beim Rezipienten, sprich personenbezogenen<br />
Faktoren. (Wie) Kann man Nachrichtenseher<br />
von Nichtsehern abgrenzen?<br />
Zu den situationalen Einflussfaktoren kann beispielsweise<br />
das Wetter gezählt werden. Denkbar ist, dass<br />
schlechtes <strong>und</strong> unbeständiges Wetter eher dazu<br />
führt, dass Menschen zu Hause bleiben <strong>und</strong> fernsehen,<br />
als dies bei schönem Wetter der Fall ist. Zudem<br />
soll der Wochentag des Ereignisses als möglicher<br />
Einflussfaktor in Betracht gezogen werden.<br />
Man kann annehmen, dass an manchen Wochentagen<br />
mehr ferngesehen wird als an anderen. Laut<br />
7 Winfried Schulz: Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien.<br />
Analyse der aktuellen Berichterstattung. Freiburg <strong>und</strong><br />
München 1976, S. 30.<br />
8 Staab, 1990 (Anm. 5), S. 120f.<br />
9 Christiane Eilders: Nachrichtenfaktoren <strong>und</strong> Rezeption. Eine empirische<br />
Analyse zur Auswahl <strong>und</strong> Verarbeitung politischer Information.<br />
Opladen 1997 (= Studien zur Kommunikationswissenschaft; 20),<br />
S. 69ff.<br />
10 Lutz Erbring: Nachrichten zwischen Professionalität <strong>und</strong> Manipulation.<br />
Journalistische Berufsnormen <strong>und</strong> politische Kultur. In: Max<br />
Kaase <strong>und</strong> Winfried Schulz (Hrsg.): Massenkommunikation. Theorien,<br />
Methoden, Bef<strong>und</strong>e. Opladen 1989 (= Kölner Zeitschrift für Soziologie<br />
<strong>und</strong> Sozialpsychologie; Sonderheft 30), S. 301–313; Zitat, S. 301.<br />
11 Vgl. Udo Michael Krüger: Fernsehnachrichten bei ARD, ZDF, RTL<br />
<strong>und</strong> SAT1: Strukturen, Themen <strong>und</strong> Akteure. In: Media Perspektiven,<br />
H. 2, 2006, S. 52 sowie Udo Michael Krüger: Themenprofile deutscher<br />
Fernsehnachrichten. In: Media-Perspektiven, H. 7, 2005, S. 302–319.<br />
12 Eilders, 1997 (Anm. 9), S. 69ff.<br />
13 Werner Früh: Medienwirkungen: Das dynamisch-transaktionale<br />
Modell. Theorie <strong>und</strong> empirische Forschung. Opladen 1991; sowie<br />
Früh <strong>und</strong> Schönbach, 2005 (Anm. 5).<br />
14 Werner Früh <strong>und</strong> Klaus Schönbach: Der dynamisch-transaktionale<br />
Ansatz. Ein neues Paradigma der Medienwirkungen. In: Werner<br />
Früh (Hrsg.): Medienwirkungen: das dynamisch-transaktionale Modell.<br />
Opladen 1991, S. 23–39; Zitat, S. 23ff.