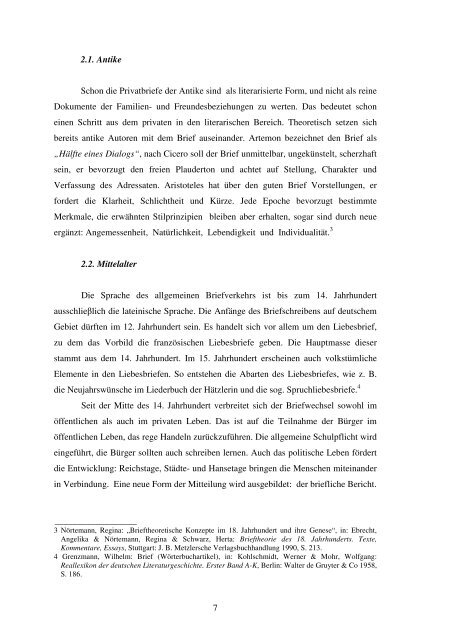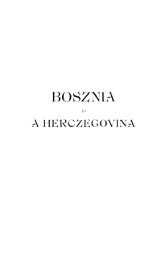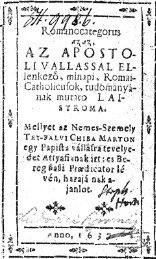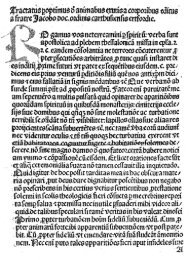DIE BRIEFFORM IM 18. JAHRHUNDERT - DEA - Debreceni Egyetem
DIE BRIEFFORM IM 18. JAHRHUNDERT - DEA - Debreceni Egyetem
DIE BRIEFFORM IM 18. JAHRHUNDERT - DEA - Debreceni Egyetem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.1. Antike<br />
Schon die Privatbriefe der Antike sind als literarisierte Form, und nicht als reine<br />
Dokumente der Familien- und Freundesbeziehungen zu werten. Das bedeutet schon<br />
einen Schritt aus dem privaten in den literarischen Bereich. Theoretisch setzen sich<br />
bereits antike Autoren mit dem Brief auseinander. Artemon bezeichnet den Brief als<br />
„Hälfte eines Dialogs“, nach Cicero soll der Brief unmittelbar, ungekünstelt, scherzhaft<br />
sein, er bevorzugt den freien Plauderton und achtet auf Stellung, Charakter und<br />
Verfassung des Adressaten. Aristoteles hat über den guten Brief Vorstellungen, er<br />
fordert die Klarheit, Schlichtheit und Kürze. Jede Epoche bevorzugt bestimmte<br />
Merkmale, die erwähnten Stilprinzipien bleiben aber erhalten, sogar sind durch neue<br />
ergänzt: Angemessenheit, Natürlichkeit, Lebendigkeit und Individualität. 3<br />
2.2. Mittelalter<br />
Die Sprache des allgemeinen Briefverkehrs ist bis zum 14. Jahrhundert<br />
ausschlieβlich die lateinische Sprache. Die Anfänge des Briefschreibens auf deutschem<br />
Gebiet dürften im 12. Jahrhundert sein. Es handelt sich vor allem um den Liebesbrief,<br />
zu dem das Vorbild die französischen Liebesbriefe geben. Die Hauptmasse dieser<br />
stammt aus dem 14. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert erscheinen auch volkstümliche<br />
Elemente in den Liebesbriefen. So entstehen die Abarten des Liebesbriefes, wie z. B.<br />
die Neujahrswünsche im Liederbuch der Hätzlerin und die sog. Spruchliebesbriefe. 4<br />
Seit der Mitte des 14. Jahrhundert verbreitet sich der Briefwechsel sowohl im<br />
öffentlichen als auch im privaten Leben. Das ist auf die Teilnahme der Bürger im<br />
öffentlichen Leben, das rege Handeln zurückzuführen. Die allgemeine Schulpflicht wird<br />
eingeführt, die Bürger sollten auch schreiben lernen. Auch das politische Leben fördert<br />
die Entwicklung: Reichstage, Städte- und Hansetage bringen die Menschen miteinander<br />
in Verbindung. Eine neue Form der Mitteilung wird ausgebildet: der briefliche Bericht.<br />
__________________<br />
3 Nörtemann, Regina: „Brieftheoretische Konzepte im <strong>18.</strong> Jahrhundert und ihre Genese“, in: Ebrecht,<br />
Angelika & Nörtemann, Regina & Schwarz, Herta: Brieftheorie des <strong>18.</strong> Jahrhunderts. Texte,<br />
Kommentare, Essays, Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 1990, S. 213.<br />
4 Grenzmann, Wilhelm: Brief (Wörterbuchartikel), in: Kohlschmidt, Werner & Mohr, Wolfgang:<br />
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Erster Band A-K, Berlin: Walter de Gruyter & Co 1958,<br />
S. 186.<br />
7