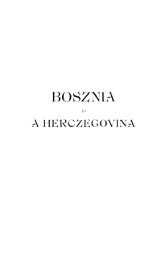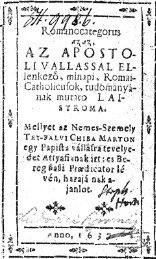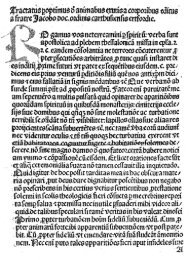DIE BRIEFFORM IM 18. JAHRHUNDERT - DEA - Debreceni Egyetem
DIE BRIEFFORM IM 18. JAHRHUNDERT - DEA - Debreceni Egyetem
DIE BRIEFFORM IM 18. JAHRHUNDERT - DEA - Debreceni Egyetem
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Brief-Stil zu verbreiten. 5<br />
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erscheinen die ersten Anzeichnen von<br />
Interesse an freundschaftlichen Briefen. Der schriftliche Austausch von gleich<br />
empfindenden Seelen tritt in den Vordergrund. Die Briefe sind durch Religiosität<br />
durchdrungen, die Menschen haben Sehnsucht nach Tröstung und Erbauung, sprechen<br />
sich wechselseitig aus. Die Frauen beginnen auch, am Briefwechsel teilzunehmen. Der<br />
Stil ändert sich auch. Die Übergänge werden flieβender, Fremdwörter verschwinden<br />
völlig, in Briefen von Frauen wird die Bitte um Freundschaft wichtiger als die um<br />
Protektion. Als Norm für den Briefstil wird die „Sprache des gemeinen Lebens“<br />
bezeichnet. Die Themen umfassen fast alle Bereiche des Lebens: Bildung, Erziehung,<br />
Tod, Liebe und Freundschaft. Die ‚natürliche Sprache des Herzens’ und die<br />
‚Individualität’ sind die neuen Fixpunkte, an denen man sich zu orientieren hat. 6 Gellert<br />
arbeitete auch eine Brieftheorie aus. Er lehnte alle Anweisungs- und Regelbücher ab,<br />
und räumte dadurch mit dem Vorschriftenzwang hinsichtlich der einzelnen<br />
Briefgattungen auf. Er offenbart sein Programm: „Nun werde ich ihnen sagen sollen,<br />
welches ich denn für die besten Regeln halte. Ich antworte, die wenigsten.“<br />
In den Briefstellern des <strong>18.</strong> Jahrhundert taucht immer wieder die Vorstellung vom Brief<br />
als Gespräch auf. Gellert schreibt so: „Das erste, was uns bey einem Briefe einfällt, ist<br />
dieses, daβ er die Stelle eines Gesprächs vertritt. Dieser Begriff ist vielleicht der<br />
sicherste.“. Gellert kritisiert sowohl die antiken Gröβen Cicero und Plinius als auch die<br />
zeitgenössischen französischen Gelehrten, weil sie zu viel unnatürliche Elemente in<br />
ihren Schreiben verwenden. Gellert propagiert den natürlichen Stil, geht davon aus, dass<br />
diesem Anspruch nur genüge tun kann, wer sich der Regeln enthält und beim Schreiben<br />
„seinem eignen Naturelle“ folgt. Durch ihre soziale und emotionale Bewertung<br />
hält Gellert die Frau als Briefschreiberin von Natur aus für geeigneter. Der Brief ist ein<br />
Medium, das den Menschen ermöglichte, Individualität aufzubauen, denn „die<br />
Selbstartikulation durch das Schreiben, das Wahrgenommenwerden durch den Partner<br />
__________________<br />
5 Grenzmann, Wilhelm: Brief (Wörterbuchartikel), in: Kohlschmidt, Werner & Mohr, Wolfgang:<br />
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Erster Band A-K, Berlin: Walter de Gruyter & Co<br />
1958, S. 187-193.<br />
6 Nörtemann, Regina: „Brieftheoretische Konzepte im <strong>18.</strong> Jahrhundert und ihre Genese“, in: Ebrecht,<br />
Angelika & Nörtemann, Regina & Schwarz, Herta: Brieftheorie des <strong>18.</strong> Jahrhunderts. Texte,<br />
Kommentare, Essays, Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung 1990, S. 215., 217.<br />
9