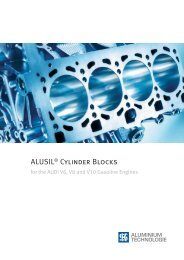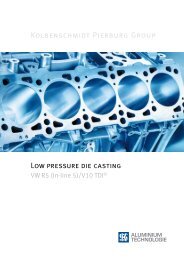Profil f r PDF - KSPG AG
Profil f r PDF - KSPG AG
Profil f r PDF - KSPG AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aktionärsbrief der Kolbenschmidt Pierburg <strong>AG</strong><br />
„Automotive“ ist auch<br />
weiterhin ertragsstark<br />
dp Düsseldorf. Die Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe setzte, wie die Führungsgesellschaft<br />
Kolbenschmidt Pierburg <strong>AG</strong> in ihrem jüngsten Aktionärsbrief mitteilt,<br />
ihren Erfolgstrend im 3. Quartal 2000 fort und steigerte den Umsatz um<br />
annähernd 19 Prozent auf 1,315 Milliarden € (Zeitraum: Januar bis September<br />
2000). Das Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen und Abschreibungen belief sich in<br />
den ersten neun Monaten 2000 auf 141,6 Millionen € und stieg damit gegenüber<br />
dem Vorjahresniveau deutlich um 18,7 Millionen € (plus 15,2 %) an. Das EBT belief<br />
sich auf 31,1 Millionen € gegenüber 32,4 Millionen € im gleichen Vorjahreszeitraum.<br />
Die Firmengruppe, die Ende September 2000 weltweit 12 315 Mitarbeiter<br />
beschäftigte, verfügt über eine sehr gute Auftragslage und erwartet für das<br />
gesamte Geschäftsjahr 2000 einen Umsatz deutlich über 1,7 Milliarden €.<br />
Die Entwicklung im Detail: Die Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe<br />
hat im<br />
dritten Quartal 2000 den Erfolgstrend<br />
des ersten Halbjahres 2000 überzeugend<br />
fortgesetzt. Der Umsatz des Vorjahresquartals<br />
wurde von Juli bis September<br />
2000 um fast 14 Prozent übertroffen.<br />
Zu dieser erfolgreichen Umsatzsteigerung<br />
haben die Akquisition<br />
des Geschäftsgebiets Pumpen von<br />
Magneti Marelli zu Beginn des Jahres<br />
2000, die weiterhin günstige Entwicklung<br />
des US-Dollar-Kurses und inter-<br />
1,109<br />
1,315<br />
1999 2000<br />
Umsatz (Mrd €) 1.-3. Quartal<br />
Auf 1,315 Milliarden € (+ 18,6 %) kletterte<br />
der Umsatz der Kolbenschmidt-<br />
Pierburg-Gruppe in den ersten neun<br />
Monaten des Geschäftsjahres 2000.<br />
nes Wachstum beigetragen. Damit<br />
konnte Kolbenschmidt-Pierburg die in<br />
mehreren wichtigen Märkten weiterhin<br />
positive konjunkturelle Entwicklung<br />
zu einem noch stärkeren eigenen<br />
Wachstum nutzen. Die vor allem in<br />
Deutschland bestehende Nachfrageschwäche<br />
nach neuen Automobilen,<br />
die sich im dritten Quartal 2000<br />
Auftragsplus<br />
bei 60 Prozent<br />
cd Wiesbaden. Die Heimann Systems-Gruppe<br />
(Wiesbaden) hat als<br />
führender Anbieter für Röntgenprüftechnik<br />
erneut ein kräftiges Auftragsplus<br />
zu verzeichnen. Nach einer<br />
50prozentigen Steigerung 1999<br />
wird der Auftragseingang 2000<br />
gegenüber dem Vorjahr um rund 60<br />
Prozent auf knapp 156 Millionen €<br />
(1999: 98 Mio €) steigen. Entsprechend<br />
positiv entwickelte sich auch<br />
der Auftragsbestand: Dort rechnet<br />
Heimann Systems für 2000 mit einem<br />
Zuwachs von knapp 89 Prozent<br />
auf über 98 Millionen € gegenüber<br />
dem Vorjahreswert von 52 Millionen<br />
€. Der Umsatz wird abrechnungsbedingt<br />
mit 110 Millionen € geringfügig<br />
unter dem Wert von 1999 (117<br />
Mio €) liegen.<br />
Das starke Auftragsplus des Jahres<br />
2000 ist vor allem auf das gute<br />
Die Zeitung des Rheinmetall-Konzerns 5/2000<br />
Das <strong>Profil</strong><br />
fortgesetzt hat, wirkte sich nicht aus.<br />
Die deutschen Automobilhersteller<br />
konnten die Entwicklung der Inlandsnachfrage<br />
durch nochmals gesteigerten<br />
Export kompensieren; Kolbenschmidt-Pierburg<br />
hat seine eigene<br />
Präsenz in attraktiven Auslandsmärkten<br />
weiter ausgebaut.<br />
Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)<br />
in dem durch Werksferien stets saisonal<br />
schwachen 3. Quartal war positiv.<br />
Insgesamt konnte in den Monaten Januar<br />
bis September 2000 mit einem<br />
EBT von 31,1 Millionen € an das erfolgreiche<br />
Jahr 1999 (32,4 Mio €) angeknüpft<br />
werden. Das Ergebnis vor Zinsen<br />
und Ertragsteuern (EBIT) erreichte<br />
mit 38,8 Millionen € das hohe Niveau<br />
des Vorjahres (39,2 Mio €). Die EBIT-<br />
Rendite lag in den ersten drei Quartalen<br />
2000 bei drei Prozent. Für das 4.<br />
Quartal 2000 wird eine Fortsetzung<br />
der Absatzerfolge erwartet.<br />
Von Januar bis September 2000 erzielte<br />
die Kolbenschmidt-Pierburg-<br />
Gruppe einen Umsatz von 1,315 Milliarden<br />
€, was einer Steigerung von<br />
18,6 Prozent bzw. 206 Millionen € gegenüber<br />
dem Vergleichzeitraum des<br />
Vorjahres entspricht. Der bereits im ersten<br />
Halbjahr 2000 besonders hohe<br />
Auslandsanteil am Umsatz blieb auch<br />
in den ersten neun Monaten mit 66<br />
Prozent konstant.<br />
Zur Umsatzsteigerung trugen die<br />
Unternehmensakquisitionen Zollner<br />
Pistons und Magneti-Marelli-Pumpen<br />
mit insgesamt 96 Millionen € bei. Die<br />
Entwicklung der Währungsparitäten<br />
zum € erhöhte die Umsätze um 33<br />
(Fortsetzung auf Seite 2)<br />
Geschäft im Bereich der Frachtprüfung<br />
und Erfolge im hart umkämpften<br />
US-Markt sowohl für Systeme<br />
zur Gepäckprüfung als auch im Bereich<br />
der Produktinspektion (insbesondere<br />
Lebensmittelprüfung) und<br />
auf dem Gebiet der Biometrie<br />
zurückzuführen. Besonders hervorzuheben<br />
ist der Durchbruch auf<br />
dem Flughafen-Markt der USA: Erstmalig<br />
hat die US-Luftfahrtbehörde<br />
FAA Heimann Systems einen<br />
Großauftrag für Handgepäckprüfsysteme<br />
erteilt.<br />
Darüber hinaus gingen bereits positive<br />
Impulse von den ab 2003 geltenden<br />
internationalen Sicherheitsanforderungen<br />
zur hundertprozentigen<br />
Kontrolle von Check-In-Gepäck<br />
auf Flughäfen aus. So konnte Heimann<br />
Systems zum Beispiel einen<br />
Großauftrag zur Ausstattung des<br />
Düsseldorfer Flughafens mit einem<br />
Röntgenprüfsystem zur vollautomatischen<br />
Sprengstoffkontrolle gewinnen.<br />
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT: Jede Menge Informationen über Rheinmetall und die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten<br />
innerhalb der einzelnen Konzernunternehmen nahmen die Besucher des 12. Deutschen Absolventen-Kongresses<br />
in Köln (22. und 23. November 2000) mit nach Hause. Kompetente Beratung war dabei selbstverständlich: Auf unserem Foto<br />
informieren Jörg Müller (2.v.r.), Leiter Zentralbereich Personal bei der Hirschmann Electronics GmbH & Co.KG, und Gaby<br />
Heimann (2.v.l.), Praktikantin im Bereich Personal bei der Rheinmetall <strong>AG</strong>, potentielle Bewerber ausführlich über die<br />
Zukunftsperspektiven für Hochschulabsolventen bei Rheinmetall (siehe ausführliche Berichterstattung auf Seite 10).<br />
Rheinmetall <strong>AG</strong> gründete gemeinnützige Stiftung<br />
Nachwuchs wird gezielt gefördert<br />
cd/rds Düsseldorf. Gezieltes Engagement<br />
für hochqualifizierten beruflichen<br />
Nachwuchs: Die Rheinmetall <strong>AG</strong><br />
(Düsseldorf) hat – wie bereits in der<br />
letzten „<strong>Profil</strong>“-Ausgabe kurz angekündigt<br />
– eine gemeinnützige Stiftung<br />
zur Förderung besonders begabter<br />
Studenten und Hochschulabsolventen<br />
gegründet. Die Stiftungsurkunde erhielt<br />
Rheinmetall-Vorstandschef Klaus<br />
Eberhardt am 17. Oktober 2000 vom<br />
Düsseldorfer Regierungspräsidenten<br />
Jürgen Büssow. Die Stiftung, deren<br />
Vermögen eine Million Mark (510 000<br />
€) beträgt, konzentriert sich auf die<br />
Unterstützung der Fortbildung von<br />
Führungs- und Nachwuchskräften im<br />
Bereich der kaufmännischen und technischen<br />
Berufe. Zunächst werden<br />
40 000 Mark (20 000 €) pro Jahr für<br />
die Vergabe von maximal acht Stipendien<br />
bereitgestellt.<br />
Mit seiner Initiative engagiert sich<br />
der Düsseldorfer Konzern nach Aussagen<br />
seines Vorstandsvorsitzenden<br />
ganz gezielt und mit langfristiger Perspektive<br />
auf dem – gesellschaftspolitisch<br />
außerordentlich wichtigen – Parkett<br />
der Förderung des beruflichen<br />
Nachwuchses. Eberhardt: „Im Mittelpunkt<br />
unserer Initiative steht ein Thema,<br />
das Rheinmetall, aber auch die<br />
gesamte deutsche Wirtschaft, zunehmend<br />
mit Sorge erfüllt: Deutschland<br />
droht in den für das Wirtschaftswachstum<br />
entscheidenden Ausbildungsbereichen<br />
in die Zweitklassigkeit abzusinken.<br />
Wir wollen hier ganz gezielt etwas<br />
tun und damit auch dem zunehmenden<br />
Fachkräftemangel in unserem<br />
Land entgegenwirken.“<br />
Vergleiche im internationalen Maßstab<br />
lassen in der Tat nicht gerade erfreuliche<br />
Zukunftsaussichten erken-<br />
Offizieller Startschuß: Am 17. Oktober diesen Jahres überreichte der Düsseldorfer<br />
Regierungspräsident Jürgen Büssow (l.) Rheinmetall-Vorstandschef Dipl.-Math.<br />
Klaus Eberhardt die Stiftungsurkunde. Mit ihrer gemeinnützigen Stiftung will die<br />
in den Geschäftsfeldern „Automotive“, „Electronics“ und „Defence“ international<br />
operierende Unternehmensgruppe die berufliche Ausbildung und Qualifizierung<br />
von Nachwuchskräften gezielt fördern.<br />
nen. Besonders alarmierend ist in diesem<br />
Zusammenhang eine aktuelle<br />
Studie der „Organisation für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung“:<br />
Danach kommen in den 29<br />
OECD-Staaten auf 100 000 Beschäftigte<br />
im Schnitt 1500 graduierte Ingenieure,<br />
Mathematiker sowie Natur- und<br />
Biowissenschaftler, während es in<br />
Deutschland nur 1040 sind – mithin<br />
also knapp ein Drittel weniger.<br />
Als global ausgerichteter Technologiekonzern<br />
möchte Rheinmetall mit<br />
der neuen Stiftung denn auch in erster<br />
Linie einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit<br />
des Standortes Deutschland leisten.<br />
Eberhardt: „Viele Unternehmen<br />
klagen über Nachwuchsmangel in<br />
Deutschland. Auch wir finden auf dem<br />
deutschen Arbeitsmarkt mitunter<br />
nicht die jungen Leute, die wir uns als<br />
(Fortsetzung auf Seite 9)<br />
Berlin: Allianzen in<br />
der Wehrtechnik<br />
rds Berlin/Ratingen. Unternehmen<br />
der wehrtechnischen Industrie<br />
in Deutschland werden strategische<br />
Allianzen in der Heerestechnik<br />
und im Marineschiffbau bilden<br />
und dabei auch gegenseitige Kapitalbeteiligungen<br />
prüfen. Dies geht<br />
aus einer – mit Blick auf die<br />
europäische Zusammenarbeit im<br />
Rüstungsbereich formulierten –<br />
gemeinsamen Erklärung hervor,<br />
die Ende Oktober diesen Jahres<br />
nach einem Gespräch zwischen<br />
Bundeskanzler Gerhard Schröder,<br />
Verteidigungsminister Rudolf<br />
Scharping sowie hochrangigen Vertretern<br />
der Firmen Diehl, Krauss-<br />
Maffei-Wegmann, Rheinmetall <strong>AG</strong>,<br />
Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong>, Babcock<br />
Borsig und Thyssen-Krupp veröffentlicht<br />
wurde (siehe dazu auch<br />
ausführlichen Beitrag auf Seite 3).
Seite 2 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Aktionärsbrief der Kolbenschmidt Pierburg <strong>AG</strong><br />
„Automotive“ ist auch<br />
weiterhin ertragsstark<br />
(Fortsetzung von Seite 1 )<br />
Millionen € im Vergleich zum Vorjahr.<br />
Mit dem verbleibenden originären internen<br />
Wachstum von 77 Millionen €<br />
(+7%) erreicht Kolbenschmidt-Pierburg<br />
eine Umsatzsteigerung, die das<br />
Wachstum der weltweiten Automobilproduktion<br />
von 5,5 Prozent übertrifft.<br />
Alle Geschäftsbereiche konnten hohes<br />
internes Wachstum erreichen.<br />
Nach Bereinigung um externe Wachstumserfolge,<br />
Verbesserungen durch<br />
Wechselkurseinflüsse und geänderte<br />
Geschäftsbereichszuordnungen haben<br />
die Geschäftsbereiche Luftversorgung/Pumpen<br />
mit +14 Millionen €,<br />
Kolben mit +26 Millionen €, Gleitlager<br />
mit +14 Millionen €, Aluminium<br />
Technologie mit +14 Millionen € und<br />
MotorService mit plus acht Millionen<br />
€ zum Wachstum der Gruppe beigetragen.<br />
Das hohe interne Wachstum in den<br />
ersten neun Monaten des Jahres<br />
2000 wurde sowohl durch erfolgreiche<br />
Produkt-Neuanläufe als auch<br />
durch wesentliche Stückzahlsteigerungen<br />
in vorhandenen Projekten erreicht.<br />
Schließlich haben unverändert<br />
hohe Dispositionen der Kunden bei<br />
Produkten, die zum Auslauf vorgesehen<br />
waren, zusätzliche Impulse gegeben.<br />
Die „Automotive“-Firmengruppe<br />
hat von Januar bis September 2000<br />
insgesamt 121 Millionen € in Sachanlagen<br />
(einschl. Leasing-Objektwerte)<br />
investiert und damit das Niveau der<br />
Abschreibungen (plus Leasing-Aufwendungen)<br />
um rund sechs Prozent<br />
überschritten. Die Investitionen (einschließlich<br />
Leasing) im dritten Quartal<br />
2000 von 45 Millionen € wurden wiederum<br />
vor allem durch neue Kundenprojekte<br />
notwendig, die in den Folgejahren<br />
eine wesentliche Basis für weiteres<br />
ertragsstarkes Wachstum sind:<br />
Neue Aufträge für Magnesium-Saugrohre,<br />
elektropneumatische Ventile,<br />
elektronische Abgasrückführsysteme<br />
sowie neuartige Kolben für Direkteinspritzer-Diesel<br />
waren ebenso Schwerpunkte<br />
der Investitionstätigkeit wie<br />
die Fortsetzung der Investitionen für<br />
Niederdruckguß-Motorblock-Projekte,<br />
deren Serienanlauf im Jahr 2001 erfolgt.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen<br />
lag auf der Rationalisierung<br />
und der Verbesserung der Fertigungsprozesse.<br />
Das hohe Niveau der im 4. Quartal<br />
2000 zugehenden Anlagen wird dazu<br />
führen, daß die Investitionen bei Kolbenschmidt-Pierburg<br />
im Gesamtjahr<br />
2000 wiederum die Größenordnung<br />
des Vorjahres erreichen werden. In<br />
Relation zum stark gestiegenen Umsatz<br />
konnte der Investitionsbedarf<br />
2000 jedoch reduziert werden. Die<br />
deutliche Steigerung der Abschreibungen<br />
ist auf das umsatzbedingt hohe<br />
Investitionsniveau der Jahre 1999<br />
und 2000 zurückzuführen. In Relation<br />
zum Umsatz haben sich die Abschreibungen<br />
nur geringfügig erhöht.<br />
Zum 30. September 2000 waren in<br />
der Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe<br />
12 315 Mitarbeiter beschäftigt. Das<br />
waren aufgrund erfolgreicher Rationalisierung<br />
– trotz der Umsatzsteigerungen<br />
– rund 100 Mitarbeiter weniger<br />
als zum Ende des 1. und 2. Quartals<br />
2000. Im Vergleich zum 30. September<br />
1999 wurden im laufenden Geschäftsjahr<br />
nur 527 Mitarbeiter mehr<br />
beschäftigt, davon 457 am Standort<br />
Livorno/Italien. Die Mitarbeiterzahl ist<br />
also fast ausschließlich durch die UnternehmensakquisitionMagneti-Marelli-Pumpen<br />
angestiegen: Das originäre<br />
interne Umsatzwachstum um<br />
rund sieben Prozent konnte ohne<br />
nennenswerte Erhöhung der Mitarbeiterzahl<br />
bewältigt werden. Zu dieser<br />
Entwicklung haben sowohl erfolgreiche<br />
Restrukturierungsprojekte, z. B.<br />
am Zollner-Standort Fort Wayne/USA,<br />
als auch ein verändertes Produkt-Mix<br />
beigetragen, das einen höheren An-<br />
teil extern zugekaufter Wertschöpfung<br />
beinhaltet. Der Personalaufwand ist<br />
nur aufgrund der Einbeziehung von<br />
Zollner und der Pumpenaktivitäten<br />
von Magneti Marelli sowie des veränderten<br />
US-Dollar/€-Verhältnisses<br />
deutlich gestiegen; in Relation zum<br />
Umsatz wurde eine Reduzierung des<br />
Personalaufwands erreicht.<br />
Zur Ertragslage: Kolbenschmidt-<br />
Pierburg konnte in den ersten neun<br />
Monaten des Jahres 2000 ein EBIT<br />
von 38,8 Millionen € erreichen. Das<br />
entspricht nahezu genau dem im<br />
1. bis 3. Quartal 1999 erreichten Wert<br />
(39,2 Mio €). Das EBT lag bei 31,1<br />
Millionen € gegenüber 32,4 Millionen<br />
€ im gleichen Vorjahreszeitraum.<br />
Das Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen<br />
und Abschreibungen (EBDIT)<br />
konnte mit 141,6 Millionen € gegenüber<br />
dem Vorjahresniveau deutlich um<br />
18,7 Millionen € (+15,2%) gesteigert<br />
werden.<br />
Basis für die Ertragskonstanz gegenüber<br />
dem Vorjahr waren deutliche<br />
Ergebnisverbesserungen in vier der<br />
sechs Geschäftsbereiche. Der Bereich<br />
Kolben konnte trotz der Ertragsbelastung<br />
aus der notwendigen Restrukturierung<br />
bei Zollner sein Ergebnis ausbauen.<br />
Dazu haben vor allem die Gesellschaften<br />
in Deutschland und Brasilien<br />
beigetragen. Der Geschäftsbereich<br />
Gleitlager steigerte aufgrund der<br />
Erfolge im europäischen Markt sein<br />
Ergebnis über das bereits im Vorjahr<br />
erreichte hohe Niveau hinaus. Der Geschäftsbereich<br />
Aluminium Technologie<br />
konnte seinen Vorjahresverlust<br />
durch wesentliche Steigerungen des<br />
Serienumsatzes im laufenden Jahr<br />
deutlich reduzieren; die Erreichung<br />
des „Break Even“ in diesem Geschäftsgebiet<br />
ist für das Jahr 2001 eingeplant.<br />
Der „Aftermarket“-Geschäftsbereich<br />
Motor Service konnte sein<br />
Ergebnis in den ersten neun Monaten<br />
2000 gegenüber dem Vorjahreszeitraum<br />
mehr als verdoppeln. Der Geschäftsbereich<br />
Luftversorgung und<br />
Pumpen konnte mit einem Ertragsrückgang<br />
auf 5,1 Millionen € die<br />
Erwartungen nicht erfüllen. Maßgeblich<br />
für den Ertragsrückgang ist neben<br />
der Auflösung einer dem Grunde nach<br />
entfallenen Rückstellung im Vorjahr<br />
(4,2 Mio €) vor allem der Auslauf von<br />
Produkten mit guter Ertragslage,<br />
während Produkte mit schwachem Ergebnisbeitrag<br />
in hohen Stückzahlen<br />
disponiert wurden. Der Geschäftsbereich<br />
MotorEngineering liegt abrechnungsbedingt<br />
nicht auf Vorjahresniveau.<br />
Wechselkurseinflüsse wirkten in der<br />
Umrechnung der Ergebnisse der US-<br />
Gesellschaften in € nicht positiv auf<br />
die Ertragslage der Kolbenschmidt-<br />
Pierburg-Gruppe ein. Das Unternehmen<br />
hat das erhebliche interne<br />
Wachstum dazu genutzt, die ertragsbelastenden<br />
Faktoren aus Kostensteigerungen<br />
und Preisdruck insgesamt<br />
vollständig zu kompensieren. Die Eigenkapitalrendite<br />
in den ersten drei<br />
Quartalen 2000 lag bei 17,3 Prozent,<br />
die Gesamtkapitalrendite erreichte<br />
11,3 Prozent.<br />
Zur Perspektive: Die „Automotive“-<br />
Gruppe rechnet mit einem positiven<br />
Geschäftsverlauf im verbleibenden<br />
Teil des Jahres 2000; im 4. Quartal<br />
2000 wird der Umsatz voraussichtlich<br />
das Vorjahresniveau ebenso deutlich<br />
übertreffen wie in den Quartalen zuvor.<br />
Der Umsatz der Kolbenschmidt-<br />
Pierburg-Gruppe wird im gesamten<br />
Geschäftsjahr 2000 deshalb voraussichtlich<br />
deutlich über 1,7 Milliarden<br />
€ liegen. Der Ertrag im vierten Quartal<br />
2000 wird das ungewöhnlich hohe Niveau<br />
des vierten Quartals 1999 nicht<br />
ganz erreichen können. Die vorliegenden<br />
Dispositionen der Kunden ermöglichen<br />
für das Jahr 2001 einen Start<br />
auf einem nochmals erhöhten Umsatzniveau.<br />
Euro-Betriebsrat nahm seine Arbeit auf<br />
rds Düsseldorf. Konstituierung: Vor<br />
wenigen Wochen nahm der neugebildete<br />
europäische Betriebsrat (EBR) für<br />
die Rheinmetall-Gesellschaften in den<br />
EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz<br />
seine Arbeit offiziell auf. Dem Gremium,<br />
dessen konstituierende Sitzung<br />
am 15. November diesen Jahres im Relaxa-Hotel<br />
in Ratingen stattfand,<br />
gehören derzeit 13 Mitglieder aus sieben<br />
Ländern an: Erik Merks (6.v.r./<br />
EBR-Vorsitz – STN Atlas Marine Electronics/Hamburg),<br />
Manfred Solmersitz (r.<br />
– STN Atlas Elektronik/Bremen), Leopold<br />
Degyse (2.v.r. – SAIT/ Zeebrugge),<br />
Gerhard Wille (3.v.r. – Richard Hirschmann<br />
Austria/Rankweil), Gerhard<br />
Grasmeier (4.v.r. – KS Gleitlager/St.<br />
Leon-Roth), Dietrich Moh (5.v.r. – Pier-<br />
burg/Neuss), Peter Winter (2.v.l. – STN<br />
Atlas Elektronik/Bremen), Friedhelm<br />
Henzel (4.v.l. – Heimann Systems/<br />
Wiesbaden), António Reis Vilaca (5.v.l.<br />
– Electromecânica Portogesa/Trofa),<br />
Fabrice Rossi (7.v.l. – Société Mosellane<br />
de Pistons/Thionville), Cor von der<br />
Ploeg (8.v.l. – Radio Holland Marine/<br />
Rotterdam) sowie Michael Ahlmann<br />
(3.v.l. – STN Atlas Elektronik/Bremen).<br />
Ahlmann nahm als Ersatzmitglied für<br />
Karl Fuchs (Jagenberg Maschinenbau/<br />
Neuss) teil, der ebenso wie sein spanischer<br />
EBR-Kollege Jose Luis Navarro<br />
(Carbureibar/Abadiano) terminbedingt<br />
verhindert war. Beim offiziellen<br />
Fototermin vor dem Tagungshotel<br />
ebenfalls dabei waren Heike Wiemer<br />
(7.v.r. – Sekretariat EBR bzw. Konzern-<br />
INFORMATIONSAUSTAUSCH: Zu einem Tischgespräch trafen sich am<br />
13. November 2000 Michael Deaver (l.), ehedem stellvertretender Stabschef im<br />
Weißen Haus beim früheren US-Präsidenten Ronald Reagan (1981 – 1989) und<br />
heute Vice Chairman der Edelmann Public Relations Worldwide, und der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende<br />
Dipl.-Math. Klaus Eberhardt. Gesprächsstoff bildeten<br />
vor allem der – zum Zeitpunkt der Deaver-Visite noch offene – Ausgang der<br />
Präsidentenwahl in den USA sowie deren mögliche Auswirkungen auf Politik<br />
und Wirtschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch im transatlantischen<br />
Verhältnis. Eberhardt betonte in diesem Kontext einmal mehr, daß der<br />
amerikanische Markt für die Produkte und Systeme des Rheinmetall-Konzerns<br />
als „Key-Market“ anzusehen sei und daß man dort zukünftig verstärkt investieren<br />
werde. Übrigens: Deaver war bereits im Januar diesen Jahres Gastreferent<br />
der zweiten Rheinmetall-Führungssitzung („Das <strong>Profil</strong>“ 1/2000).<br />
Reduziert das Fahrzeuggewicht: Jaguar-V8-Zylinder-Kurbelgehäuse aus Aluminium.<br />
betriebsrat der Rheinmetall <strong>AG</strong>/<br />
Neuss), Joachim Stöber (6.v.l. – IG-Metall-Vorstand/Frankfurt<br />
am Main und<br />
zuständiger Sekretär des europäischen<br />
Metallarbeiterbundes) sowie<br />
Dieter Niederste-Werbeck (l.), Vorstandsmitglied<br />
und Arbeitsdirektor<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong>. Niederste-Werbeck<br />
war Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite<br />
bei den im Vorfeld der<br />
Konstituierung geführten Verhandlungen<br />
über die entsprechende Konzernbetriebsvereinbarung<br />
zur Arbeit des<br />
EBR (siehe auch „<strong>Profil</strong>“-Ausgaben<br />
1999/2000 und 2/2000). Übrigens:<br />
Merks, Rossi, Vilaca und von der Ploeg<br />
bilden gleichzeitig den geschäftsführenden<br />
Ausschuß des europäischen<br />
Betriebsrates.<br />
Meßtechnik jetzt<br />
unter einem Dach<br />
he Neuss. Die Kolbenschmidt-<br />
Pierburg-Gruppe hat ihre im Bereich<br />
Meßtechnik operierenden<br />
Tochtergesellschaften konsequent<br />
zusammengefaßt. Nach der zum 1.<br />
Oktober 2000 erfolgten Eingliederung<br />
des Geschäftsbereiches Abgasmeßtechnik<br />
in die Pierburg Instruments<br />
GmbH (Neuss) sind jetzt<br />
alle Meßtechnik-Aktivitäten der<br />
Gruppe in einem Unternehmen zusammengeführt.<br />
Zur Pierburg Instruments GmbH<br />
gehören damit die Geschäftsbereiche<br />
Abgas-, Durchfluß- sowie Werkstatt-Meßtechnik.<br />
Damit bietet Pierburg<br />
Instruments innovative Produkte<br />
und Lösungen aus einer<br />
Hand für die verschiedensten Meßaufgaben<br />
bei Verbrennungsmotoren<br />
als auch bei künftigen Entwicklungen,<br />
wie beispielsweise der<br />
Brennstoffzelle. Das Unternehmen<br />
wird im Jahr 2000 einen voraussichtlichen<br />
Umsatz von 35 Millionen<br />
€ erzielen und beschäftigt<br />
weltweit rund 235 Mitarbeiter. Pierburg<br />
Instruments ist an den Standorten<br />
Fürth (vormals Hermann Electronic)<br />
und Neuss (Abgasmeßtechnik<br />
und Industrie-Meßgeräte) sowie<br />
über die Pierburg Instruments Inc.<br />
(Auburn Hills, US-Bundesstaat Michigan)<br />
auch in den USA vertreten.<br />
Das<strong>Profil</strong><br />
Herausgeber: Rheinmetall <strong>AG</strong><br />
Verantwortlich: Dr. Klaus Germann<br />
Chefredaktion: Rolf D. Schneider<br />
Anschrift: Redaktion „Das <strong>Profil</strong>“,<br />
Postfach 104261, 40033 Düsseldorf<br />
Satz: Strack + Storch,<br />
Gladbacher Straße 15, 40219 Düsseldorf<br />
Druck: DAMO Digitaltechnik GmbH,<br />
Falkstraße 73-77, 47058 Duisburg<br />
Erscheinungsweise: 5 Ausgaben/Jahr<br />
Drucktermin dieser Ausgabe:<br />
11./12. 12. 2000<br />
Nachdruck gestattet, Belegexemplar erbeten.
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Investor Relations<br />
Seite 3<br />
Rheinmetall mit internationaler Rechnungslegung<br />
Bilanzen des Konzerns<br />
von 2001 an nach IAS<br />
Düsseldorf. Der Vorstand der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong> hat im Oktober diesen Jahres<br />
die Einführung von „International<br />
Accounting Standards“ (IAS) für den<br />
Konzernabschluß der Rheinmetall <strong>AG</strong><br />
beschlossen. Auch die Unternehmensbereiche<br />
werden zukünftig Konzernabschlüsse<br />
nach IAS aufstellen.<br />
Bislang sind Bilanzen in der Rheinmetall-Gruppe<br />
nach den Vorschriften des<br />
Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt<br />
worden. IAS sind weltweit anerkannte<br />
Standards zur Rechnungslegung,<br />
die von zahlreichen DAX-Unternehmen<br />
(z.B. Bayer, Henkel, Lufthansa<br />
und RWE) bereits angewendet werden;<br />
weitere namhafte Großkonzerne<br />
– zum Beispiel die Volkswagen <strong>AG</strong> –<br />
stellen zur Zeit auf IAS um.<br />
„International Accounting Standards“<br />
gewährleisten eine transparente<br />
und international vergleichbare Berichterstattung.<br />
Im Gegensatz zu den<br />
derzeit noch verwendeten Vorschriften<br />
des HGB, die stark Gläubigerschutzorientiert<br />
(Betonung des Vorsichtsprinzips)<br />
sowie durch steuerliche Vorschriften<br />
geprägt sind, stellen die IAS<br />
die Informationsbedürfnisse der Investoren<br />
in den Vordergrund. Oberster<br />
Grundsatz ist dabei die angemessene<br />
Darstellung der Vermögens-, Finanzund<br />
Ertragslage. Mit der Einführung einer<br />
IAS-Rechnungslegung entspricht<br />
Rheinmetall somit den Erwartungen<br />
der Kapitalmärkte und Banken. Weiterhin<br />
gewinnt die unterjährige Berichterstattung<br />
(Quartalsberichte) der<br />
Rheinmetall-Gruppe durch die Einführung<br />
von IAS<br />
wesentlich an<br />
Aussagekraft, was<br />
von großer Bedeutung<br />
für die<br />
Darstellung der internationaltätigenUnternehmensgruppe<br />
nach<br />
außen ist.<br />
Die Umstellung<br />
des Rechnungs-<br />
Dr. Ulrich Hauck<br />
wesens bei Rheinmetall betrifft sowohl<br />
das externe Rechnungswesen als<br />
auch das interne Berichtswesen und<br />
erstreckt sich über alle Unternehmensstufen.<br />
Da die Tochtergesellschaften<br />
auch zukünftig aus rechtlichen Gründen<br />
nicht auf die Erstellung eines Einzelabschlusses<br />
nach HGB verzichten<br />
können, werden diese eine Überleitung<br />
der HGB-Buchführung auf IAS in<br />
Form einer sogenannten „HB II“ erstellen.<br />
In die konsolidierten Abschlüsse<br />
der Geschäftsbereiche, der Unternehmensbereiche<br />
sowie des Rheinmetall-<br />
Konzerns werden zukünftig ausschließlich<br />
IAS-Abschlüsse (HB II) der<br />
Konzernunternehmen einfließen.<br />
HGB-Konzernabschlüsse werden in<br />
der Rheinmetall-Gruppe somit letztmalig<br />
zum 31. Dezember 2000 erstellt.<br />
Der Umstellung liegt ein ehrgeiziger<br />
Zeitplan zugrunde, dessen Umsetzung<br />
höchste Anforderungen an die Mitarbeiter<br />
des Rechnungswesens im ge-<br />
Angebot zur<br />
Aktienübernahme<br />
dp Düsseldorf/Neuss. Die Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong> (Düsseldorf) wird den<br />
Aktionären der Jagenberg <strong>AG</strong> (Neuss)<br />
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot<br />
für alle ausstehenden<br />
Vorzugsaktien machen. Ein entsprechender<br />
Beschluß wurde am 1. Dezember<br />
2000 vom Aufsichtsrat der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong> genehmigt. Rheinmetall bietet<br />
für eine Vorzugsaktie der Jagenberg<br />
<strong>AG</strong> 2,30 €. Weitere Einzelheiten des<br />
Kaufangebots (z. B. den Zeitpunkt der<br />
Übernahme und die Übernahmefrist)<br />
wird die Rheinmetall <strong>AG</strong> zu gegebener<br />
Zeit veröffentlichen. Damit drückt<br />
Rheinmetall seine besondere Verantwortung<br />
gegenüber den Vorzugsaktionären<br />
der Jagenberg <strong>AG</strong> aus.<br />
samten Konzern stellt. Die vorgesehene<br />
erstmalige Veröffentlichung eines IAS-<br />
Abschlusses zum 31. Dezember 2001<br />
erfordert die Ermittlung von vergleichbaren<br />
Vorjahreszahlen. Somit ist – nach<br />
Erstellung des diesjährigen HGB-Konzernabschlusses<br />
(Stichtag: 31. 12.<br />
2000) – ein paralleler Konzernabschluß<br />
nach IAS zum 31. Dezember 2000 aufzustellen.<br />
Für die Unternehmen des<br />
Rheinmetall-Konzerns bedeutet dies,<br />
daß im Anschluß an den Jahresabschluß<br />
2000 eine Überleitung dieses<br />
Abschlusses auf IAS vorzunehmen ist.<br />
Die vorbereitenden Arbeiten für die<br />
Umstellung sind bereits in vollem<br />
Gange. Seit Anfang Oktober 2000 erarbeiten<br />
acht Projektgruppen unter Leitung<br />
des Konzernrechnungswesens<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong> (Dr. Ulrich Hauck,<br />
Karin Crombach) in enger Abstimmung<br />
mit den Konzernprüfern PwC Deutsche<br />
Revision (Düsseldorf) neue IAS-Bilanzierungsrichtlinien<br />
einschließlich der<br />
entsprechenden Berichtspakete. Wesentliche<br />
Entscheidungen hinsichtlich<br />
der Bilanzierung und Bewertung nach<br />
IAS sollen durch das „Steering Committee“,<br />
das sich aus den Finanzvorständen<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong> sowie der<br />
Unternehmensbereiche zusammensetzt,<br />
bis Ende diesen Jahres getroffen<br />
werden. Voraussetzung für die Einführung<br />
von IAS sind gewisse Anpassungen<br />
bestehender EDV-Systeme.<br />
Entscheidend für den Erfolg des Umstellungsprojekts<br />
ist insbesondere<br />
auch die engagierte Beteiligung der<br />
Mitarbeiter im Rheinmetall-Rechnungswesen.<br />
Diesen bietet sich über das<br />
konzernweite IAS-Projekt die Chance,<br />
an einer umwälzenden Erneuerung<br />
und Modernisierung der Rechnungslegung<br />
aktiv mitzuwirken. Von großer<br />
Bedeutung ist außerdem die effiziente<br />
und zielgerichtete Schulung der Mitarbeiter<br />
im Rechnungswesen und im<br />
Controlling. Nach Beendigung der<br />
Jahresabschlußarbeiten für das Geschäftsjahr<br />
2000 wird für diesen Personenkreis<br />
ein umfangreiches Schulungsprojekt<br />
gestartet. Die Schulungen<br />
beginnen in der zweiten März-<br />
Hälfte 2001, zunächst unter Teilnahme<br />
von Mitarbeitern des Rechnungswesens<br />
der Gesellschaften der Rheinmetall-Gruppe<br />
(die weitere Zeitplanung<br />
des Umstellungsprojekts geht<br />
aus der Grafik auf dieser „<strong>Profil</strong>“-Seite<br />
hervor).<br />
Ansprechpartner beim IAS-Projekt ist<br />
zum einen das bereits genannte Projektleitungsteam<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong><br />
(Hauck/ Crombach); zum anderen stehen<br />
in den einzelnen Unternehmensbereichen<br />
mit Ulrike Renner („Automotive“),<br />
Roland Müsse („Electronics“)<br />
und Sven Gronemeyer („Defence“)<br />
kompetente Experten zur Verfügung.<br />
Fachmann bei Jagenberg ist<br />
Rolf Jensen. Dr. Ulrich Hauck*<br />
*Dr. Ulrich Hauck (36) ist Leiter des Konzernrechnungswesens<br />
bei der Rheinmetall <strong>AG</strong> und in dieser<br />
Funktion verantwortlich für die konzernweite Umstellung<br />
der Bilanzen auf „International Accounting<br />
Standards“.<br />
Rheinmetall hält als Mehrheitsaktionär<br />
rund 86 Prozent des Stimmrechtsanteils<br />
an der Jagenberg <strong>AG</strong><br />
oder 52 Prozent des Grundkapitals<br />
von 51,2 Millionen €. (Das Grundkapital<br />
ist eingeteilt in 20 000 000<br />
Stückaktien und zwar in 12 000 000<br />
Stammaktien und 8 000 000 Vorzugsaktien<br />
ohne Stimmrecht).<br />
Rheinmetall unterstreicht damit sein<br />
Ziel, Jagenberg zu verkaufen. Dabei<br />
wird seitens des Rheinmetall-Vorstandes<br />
eine Lösung präferiert, in<br />
der Jagenberg als vollständige Einheit<br />
an einen Finanzinvestor veräußert<br />
wird.<br />
Rheinmetall hat sich zu einem freiwilligen<br />
Übernahmeangebot entschlossen,<br />
weil potentielle Finanzinvestoren<br />
vor allem Interesse an<br />
einer 100-prozentigen Übernahme<br />
haben.<br />
Maßnahmen 2000/2001 Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />
Umstellungskonzept<br />
erarbeiten und vorstellen<br />
Projektarbeit:<br />
(Projektteams und<br />
Steering Committee)<br />
Berichtsformulare und<br />
Bilanzierungsrichtlinie<br />
Schulungen<br />
Erstellung d. Abschlusses<br />
zum 31. Dezember 2000<br />
Prüfung der Abschlüsse<br />
bei den Gesellschaften<br />
Unternehmens-Planung<br />
nach IAS<br />
Gemeinsame Erklärung von Bundesregierung und Industrie<br />
Allianzen in der Wehrtechnik bilden<br />
rds Berlin/Ratingen. Unternehmen<br />
der wehrtechnischen Industrie in<br />
Deutschland werden strategische Allianzen<br />
in der Heerestechnik und im Marineschiffbau<br />
bilden und dabei auch gegenseitige<br />
Kapitalbeteiligungen prüfen.<br />
Dies geht aus einer – mit Blick auf die<br />
europäische Zusammenarbeit im Rüstungsbereich<br />
formulierten – gemeinsamen<br />
Erklärung hervor, die Ende Oktober<br />
diesen Jahres nach einem Gespräch<br />
zwischen Bundeskanzler Gerhard<br />
Schröder, Verteidigungsminister Rudolf<br />
Scharping sowie hochrangigen Vertretern<br />
der Firmen Diehl, Krauss-Maffei-<br />
Wegmann, Rheinmetall <strong>AG</strong>, Rheinmetall<br />
DeTec <strong>AG</strong>, Babcock Borsig und Thyssen-<br />
Krupp veröffentlicht wurde.<br />
Ziel dieser strategischen Allianzen ist<br />
der Erhalt der Spitzenstellung sowie<br />
der Kernkompetenzen und Systemfähigkeit<br />
der deutschen Unternehmen<br />
in den Bereichen der Heerestechnik<br />
Jagenberg meldet<br />
hohes Auftragsplus<br />
he Neuss. Die als Ausrüster der internationalen<br />
Hersteller und Verarbeiter<br />
von Papier und Folien tätige Jagenberg<br />
<strong>AG</strong> hat ihre Auftragslage im<br />
laufenden Geschäftsjahr 2000 deutlich<br />
steigern können. So erzielte das<br />
Neusser Unternehmen zum 30. September<br />
diesen Jahres mit 299,6 Millionen<br />
€ einen Zuwachs im Auftragseingang<br />
von 15,8 Prozent gegenüber<br />
dem Vorjahreswert (258,8 Mio €).<br />
Damit entwickelte sich auch der Auftragsbestand,<br />
der zum 30. September<br />
2000 um 15,6 Prozent auf 222<br />
Millionen € stieg, sehr positiv. Der<br />
Umsatz der Jagenberg-Gruppe wuchs<br />
in den ersten neun Monaten auf 211,1<br />
Millionen € und lag damit um 5,8<br />
und des Marineschiffbaus. Die Allianzen<br />
werden als entscheidendes Element<br />
für die Restrukturierung der<br />
europäischen Rüstungsindustrien angesehen.<br />
Sie sind offen für den Beitritt<br />
weiterer deutscher und anderer europäischer<br />
Partner und schaffen dadurch<br />
auch die Voraussetzung für den<br />
Beitritt transatlantischer Partner.<br />
Um den Konsolidierungsprozeß speziell<br />
in der Heerestechnik zu fördern,<br />
streben die Firmen Krauss-Maffei-Wegmann<br />
GmbH & Co. KG, Rheinmetall De-<br />
Tec <strong>AG</strong> und Diehl Stiftung & Co. eine Intensivierung<br />
der bisherigen Zusammenarbeit<br />
an. Dabei sollen die genannten<br />
Unternehmen, so die Erklärung<br />
weiter, auf eine Harmonisierung<br />
und Bündelung ihrer technologischen<br />
Fähigkeiten hinarbeiten und<br />
gleichzeitig auch die Möglichkeit einer<br />
gegenseitigen Kapitalverflechtung prüfen.<br />
Ähnliches gilt für die Babcock Bor-<br />
Prozent über dem Vergleichswert des<br />
Vorjahres.<br />
Zu dieser Entwicklung trugen die beiden<br />
Hauptgeschäftsfelder Papier- und<br />
Folientechnik gleichermaßen bei. Dank<br />
guter Auftragseingänge bei Rollenschneidern<br />
und Streichanlagen sowie<br />
durch internationale Großprojekte, zu<br />
denen auch wieder namhafte Aufträge<br />
aus Nordamerika zählen, stieg der Auftragseingang<br />
in der Papiertechnik um<br />
rund zehn Prozent. Der Geschäftsbereich<br />
Folientechnik konnte aufgrund<br />
einer regen Ordertätigkeit aus den USA<br />
und den sich wieder belebenden asiatischen<br />
Märkten sogar einen Auftragszuwachs<br />
von 18 Prozent gegenüber<br />
1999 verbuchen. Für das gesamte Jahr<br />
2000 rechnet Jagenberg mit einem<br />
Auftragsplus von mehr als 20 Prozent<br />
gegenüber 1999. Die Jagenberg <strong>AG</strong><br />
wird daher angesichts sich weiter<br />
Holding<br />
Teilbereiche<br />
Einzelgesellschaften<br />
Der Umstellung der Bilanzen auf „International Accounting Standards“ (IAS) liegt ein ehrgeiziger Zeitplan zugrunde, dessen<br />
Umsetzung höchste Anforderungen an die Mitarbeiter des Rechnungswesens im gesamten Rheinmetall-Konzern stellt. Was<br />
im Rahmen des IAS-Großprojektes bis November kommenden Jahres im Detail geschieht, zeigt diese „<strong>Profil</strong>“-Grafik.<br />
Das geplante trilaterale „gepanzerte Transportfahrzeug“ (GTK), an dessen Realisierung<br />
unter anderem die Rheinmetall-DeTec-Gruppe und die Krauss-Maffei-<br />
Wegmann GmbH & Co. KG beteiligt sind, ist ein ebenso aktuelles wie zukunftsgerichtetes<br />
Beispiel für strategische Allianzen in der Wehrtechnik.<br />
sig <strong>AG</strong> und die Thyssen Krupp Industries<br />
<strong>AG</strong> auf dem Sektor des Marineschiffbaus.<br />
In der in Berlin verabschiedeten Erklärung<br />
betont die Bundesregierung<br />
zudem, daß sie der kontinuierlichen<br />
Investitionstätigkeit der Bundeswehr<br />
eine wesentliche Bedeutung beimißt.<br />
Wörtlich heißt es: Sie verfolgt – unter<br />
Wahrung der wettbewerbsrechtlichen<br />
Voraussetzungen – gemeinsam mit der<br />
deutschen Industrie das Ziel, die Spitzenstellung<br />
sowie die Kernkompetenzen<br />
und damit die Systemfähigkeit der<br />
Unternehmen der Heerestechnik und<br />
des Marineschiffbaus zu erhalten.<br />
Gleichzeitig will die Regierung in Berlin<br />
in der deutschen Rüstungsindustrie<br />
eine Kräftebündelung fördern, die in<br />
der Luft- und Raumfahrtindustrie auf<br />
nationaler Ebene bereits abgeschlossen<br />
ist und die im vergangenen Sommer<br />
zur Gründung des größten europäischen<br />
Luftfahrtkonzerns EADS geführt<br />
hatte.<br />
Für den Rheinmetall-Unternehmensbereich<br />
„Defence“, der sich insbesondere<br />
in jüngster Vergangenheit durch<br />
interne und externe Konsolidierungen<br />
zu einem europäischen Kompetenzzentrum<br />
für Heerestechnik formiert hat<br />
und dessen in diesen Wochen anlaufendes„Diana“-Integrationsprogramm<br />
angesichts der dazugewonnenen<br />
Technologie- und Systemfähigkeit<br />
die globale Wettbewerbsfähigkeit sichern<br />
wird, sind strategische Allianzen<br />
auf dem Sektor der Wehrtechnik schon<br />
seit langem keine „unbekannte<br />
Größe“. Ein gleichermaßen aktuelles<br />
wie zukunftsgerichtetes Beispiel ist in<br />
diesem Kontext das geplante trilaterale<br />
„gepanzerte Transportfahrzeug“ (GTK),<br />
an dessen Realisierung unter anderem<br />
die Rheinmetall-DeTec-Gruppe sowie<br />
die Krauss-Maffei-Wegmann GmbH &<br />
Co. KG beteiligt sind.<br />
Blick in die Produktion von StoraEnso<br />
Packaging Boards im schwedischen<br />
Fors: Jagenberg-Streichanlage mit<br />
vier „Modular Combi Blade“-Streichköpfen.<br />
belebender internationaler Märkte bei<br />
Spezialmaschinen für die Papier- und<br />
Folienindustrie mit einem guten Auftragspolster<br />
in das Geschäftsjahr 2001<br />
starten.
Seite 4 Investor Relations<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Anfang November diesen Jahres veröffentlichte die Financial<br />
Times Deutschland (Hamburg) einen Beitrag<br />
über die Rheinmetall <strong>AG</strong>, in dem unter anderem von einer<br />
„ernsten Finanzkrise“ die Rede war. Mit aller Schärfe<br />
wies der Vorstandsvorsitzende der Düsseldorfer Unternehmensgruppe,<br />
Dipl.-Math. Klaus Eberhardt, diese „unhaltbare<br />
Behauptung“ zurück und unterstrich dabei gleichzeitig<br />
die finanzielle Solidität des Konzerns, der in seinen drei<br />
Geschäftsfeldern „Automotive“, „Electronics“ und „Defence“<br />
weltweit erfolgreich am Markt plaziert ist. Eberhardts<br />
Börsen-Zeitung: Gespräch mit Rheinmetall-Vorstandschef Klaus Eberhardt<br />
Konsolidierungspause eingelegt<br />
Ertrag, Ertrag, Ertrag und Liquididät.“<br />
Mit dieser prägnanten Formel<br />
umreißt Klaus Eberhardt, der<br />
seit dem 1. Januar 2000 amtierende<br />
Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong>, in welche Richtung er den<br />
Konzern bewegen will. Seit Anfang<br />
der neunziger Jahre hat Rheinmetall<br />
zehn Wehrtechnik-Unternehmen für<br />
fast 1 Mrd. DM gekauft. Im letzten und<br />
in diesem Jahr wurde ein Umsatzvolumen<br />
von 938 Mill. € erworben, und<br />
285 Mill. € wurden abgegeben. Der<br />
Konzern ist massiv auf Wachstum<br />
geprägt worden, und das hat bei der<br />
Finanzausstattung deutliche Spuren<br />
hinterlassen. Der Konzernumsatz<br />
wurde innerhalb von zehn Jahren auf<br />
8,8 Mrd. DM nahezu verdreifacht,<br />
und die Bilanzsumme wurde bis 1999<br />
um den Faktor 2,5 auf 6,8 Mrd. DM<br />
verlängert.<br />
Mit dieser mächtigen Expansion hat<br />
das Eigenkapital trotz der Kapitalerhöhungen<br />
1996, 1997 und 1998 bei<br />
weitem nicht Schritt gehalten. Es ist<br />
gerade mal um ein Drittel auf 1,1 Mrd.<br />
DM angereichert worden. Dagegen<br />
wurde die Gesamtverschuldung von<br />
knapp 670 Mill. DM auf 3,1 Mrd. DM<br />
hochgezogen. Rheinmetall lebt in einer<br />
gewiß nicht übertrieben komfortablen<br />
finanziellen Situation, doch von<br />
einer „ernsten Finanzkrise“, wie<br />
Anfang November 2000 von der<br />
„Financial Times Deutschland“ behauptet,<br />
kann bei weitem keine Rede<br />
sein, auch wenn die Brutto-Finanzschulden<br />
von 1998 bis Ende 1999<br />
einen Sprung von 450 auf dicht unter<br />
1,4 Mrd. DM gemacht haben werden.<br />
Die Netto-Finanzschulden werden für<br />
Ende 2000 bei 600 (584) Mill. € erwartet.<br />
Seit Eberhardt den langjährigen<br />
Rheinmetall-Chef Hans U. Brauner abgelöst<br />
hat, wurde ein Paradigmenwechsel<br />
vollzogen. Die Jahre der Quantensprünge,<br />
gekennzeichnet durch<br />
Akquisititionen zur starken strategischen<br />
Positionierung vor allem in<br />
der Wehrtechnik und durch die Abgabe<br />
von Randaktivitäten, gehören der<br />
Odeon im Qualitätstest<br />
Vergangenheit an. Er verfolgt eine<br />
Strategie „der klaren Linie“, die sich<br />
primär an der wirtschaftlichen Performance<br />
orientiert. Für ihn ist Wachstum<br />
zwar wichtig, doch die Größe<br />
allein läßt er als Kriterium nicht gelten.<br />
„Das Management will zeigen, was in<br />
Rheinmetall steckt: nicht mit Visionen,<br />
sondern mit realen, nachvollziehbaren<br />
Fakten.“<br />
Kompetenz ohne<br />
Kommando-Ton<br />
Seite 9<br />
Deshalb braucht der Konzern nach<br />
den stürmischen und von Visionen geprägten<br />
Zeiten dringend eine Konsolidierungspause.<br />
Wie Eberhardt im Gespräch<br />
mit der Börsen-Zeitung sagte,<br />
wird er das aktive Portfoliomanagement<br />
zumindest in den nächsten zwei<br />
Jahren unter umgekehrten Vorzeichen<br />
betreiben. Er will aus der großen Fülle<br />
der ins Netz gegangenen Fische jene<br />
Fänge ausmustern, die außerhalb der<br />
Kernkompetenz der drei Säulen Automotive,<br />
Electronics und Defence leben.<br />
Den Liquiditätszufluß daraus (Verkaufspreis<br />
plus Abbau der Finanzschulden)<br />
veranschlagt er auf deutlich<br />
über 100 Mill. €. Daß den Vorzugsaktionären<br />
der Jagenberg <strong>AG</strong> ein freiwilliges<br />
Kaufangebot unterbreitet wird, widerspricht<br />
seiner Politik nur scheinbar,<br />
denn tatsächlich soll damit die komplette<br />
Veräußerung an einen Finanzinvestor<br />
vorbereitet werden. Jagenberg<br />
wird im Geschäftsjahr 2000 einschließlich<br />
der Erträge aus Immobilienverkäufen<br />
eine schwarze Null erreichen,<br />
nachdem sich das operative Ergebnis<br />
deutlich zweistellig verbessert<br />
Premium-Produkt: Das Heizungs- und<br />
Klimabediensystem für den BMW Z8<br />
stammt von der Firma Preh.<br />
hat. Der operative Turnaround soll im<br />
nächsten Jahr vollzogen werden.<br />
Auch wenn derzeit weitere Zukäufe<br />
nicht das vorrangige Thema sind, will<br />
Rheinmetall doch das Pulver trocken<br />
halten und den finanziellen Spielraum<br />
für Akquisitionsgelegenheiten haben.<br />
Diesen Spielraum sieht Finanzvorstand<br />
Herbert Müller gesichert („Wir<br />
fühlen uns komfortabel“), auch nach<br />
der verschobenen Anleihe über 300<br />
Mill. €. Diese Anleihe, die nun zunächst<br />
für das Frühjahr 2001 vorgesehen<br />
ist, sollte der Umfinanzierung eines<br />
bis Ende 2002 laufenden syndizierten<br />
Kredits dienen. Daß hier Rheinmetall<br />
der Schuh nicht drückt, hat<br />
nicht allein mit dem Termin zu tun,<br />
sondern auch mit den Konditionen.<br />
Denn die seit 1998 laufende Kreditfazilität<br />
über 700 Mill. DM stellt sich für<br />
Rheinmetall deutlich günstiger als die<br />
geplante Anleihe, zumal zur Nutzung<br />
Darstellung der aktuellen Situation sowie der strategischen<br />
Positionierung des Konzerns fand ein breites Echo in<br />
renommierten deutschsprachigen bzw. internationalen Tages-<br />
und Wirtschaftszeitungen. „Das <strong>Profil</strong>“ veröffentlicht<br />
stellvertretend einen Beitrag der Börsen-Zeitung (BZ/Frankfurt<br />
am Main) vom 2. Dezember des Jahres. Darin geben BZ-<br />
Chefredakteur Claus Döring und Brunfrid Rudnick, Leiter der<br />
Rhein-Ruhr-Redaktion der BZ, ein Gespräch wieder, das sie<br />
wenige Tage zuvor mit Eberhardt über die aktuellen und<br />
zukünftigen Perspektiven von Rheinmetall führten. dp<br />
der niedrigeren Zinsen am kurzen Ende<br />
auf Basis der Kreditfazilität kurzfristige<br />
Gelder rollierend aufgenommen<br />
wurden. Insofern führt die in der<br />
1999er Bilanz ausgewiesene und auch<br />
im Credit Research von Dresdner KB<br />
erwähnte Fristigkeit der Verbindlichkeiten<br />
den externen Betrachter leicht in<br />
die Irre. Dort werden 82% der 757 Mill.<br />
€ Bruttofinanzschulden als innerhalb<br />
von zwölf Monaten fällig beschrieben.<br />
Vor allem die Spread-Ausweitung<br />
während der Roadshow von ursprünglich<br />
90 auf dann 130 bis 140 Basispunkte<br />
über Euribor, von der auch andere<br />
mit Triple-B geratete Gesellschaften<br />
betroffen waren, hätten zur Absage<br />
der Anleihe bewogen, so der Finanzvorstand.<br />
Sicher sei es nicht einfach,<br />
nach halbjähriger Vorbereitung auf<br />
die Emission zu verzichten. Am Markt<br />
sei die Verschiebung allerdings gut<br />
aufgenommen und als Zeichen von<br />
Professionalität gewertet worden.<br />
Müllers Ziel ist es, im Abschluß für<br />
2000 die Netto-Finanzschulden auf<br />
600 Mill. € zu begrenzen. Dies wären<br />
zwar mehr als im Jahr zuvor (584 Mill.<br />
€), doch muß dies vor dem Hintergrund<br />
der Akquisitionen gesehen werden.<br />
So dürften sich die liquiden Mittel<br />
per Ende 2000 gegenüber Ultimo<br />
1999 von 173 auf 105 Mill. € verringern,<br />
die Finanzverbindlichkeiten aber<br />
ebenfalls, und zwar von 757 auf 705<br />
Mill. €. Die sich bei 3 Mrd. € Bilanzsumme<br />
daraus abzuleitende (jedoch<br />
mehr statische und in ihrer Aussagefähigkeit<br />
für die finanzielle Verfassung<br />
begrenzte) Verschuldungsquote von<br />
18% ist deshalb um weitere Finanzkennziffern<br />
zu ergänzen. So wird für<br />
2000 ein Cash-flow von 360 Mill. € erwartet,<br />
womit der dynamische Verschuldungsgrad<br />
bei 2 liegt. Bei einem<br />
für 2000 in Aussicht gestellten Ergebnis<br />
vor Steuern und Zinsen (Ebit) von<br />
145 Mill. € errechnet sich ein Zinsdeckungsgrad<br />
(Ebit in Relation zum<br />
Nettozinsaufwand) von 2,6; auf Basis<br />
des Ergebnisses vor Steuern, Zinsen<br />
und Abschreibungen (Ebitda) wären<br />
es sogar 7,3.<br />
Freilich wird bei Rheinmetall derzeit<br />
eine andere Kennziffer besondere Beachtung<br />
finden, nämlich das Verhältnis<br />
der Gesamtverbindlichkeiten zum<br />
Cash-flow. Denn hier hatte sich der<br />
Konzern in den sogenannten Financial<br />
Covenants des syndizierten Kredits<br />
auf eine Obergrenze von 3,5 verpflichtet.<br />
Sie war infolge des verzögerten Jagenberg-Verkaufs<br />
vorübergehend<br />
überschritten worden, und dies hatte<br />
letztlich die irreführenden Schlagzeilen<br />
von der Finanzkrise ausgelöst.<br />
Stuttgart anfing. Als Vorstandsassimetall Elektronik <strong>AG</strong> (heutige Adistent<br />
und Leiter der Fertigungssteuetron <strong>AG</strong>) übernahm. Dieses Amt berung<br />
in der Nachrichtentechnik samhielt er, als er zum 1. Januar 2000 als<br />
Wenn Klaus Eberhardt Rheinmetall<br />
als „eines der faszinierendsten<br />
Unternehmen“ bemelte<br />
er das Know-how, um später<br />
bei MBB das Werk Nabern zu leiten<br />
und anschließend den Geschäftsbereich<br />
Fertigung.<br />
Nachfolger von Hans U. Brauner die<br />
Konzernführung übernahm. Die Turbulenzen<br />
um seinen Vorgänger Brauner<br />
will Eberhardt schnell vergessen<br />
schreibt, klingt dies glaubwürdig. Dann folgte das Thema „Defence“, machen, die Zeit der Selbstherrlich-<br />
Denn in der jetzigen Aufgabe fließt er wurde Mitglied der Unternehkeit an der Rheinmetall-Spitze<br />
zusammen, was der 52-jährige MamensbereichsleitungVerteidigungs- scheint vorüber. Mit dem Großnager<br />
auf verschiedenen Stufen seisysteme. Als die zivile Mikroelektroaktionär Röchling pflegt er eine<br />
ner Karriereleiter in unterschiednik aus der Dasa ausgegründet und „sehr gute und vertrauensvolle“ Zulichen<br />
Firmen kennengelernt hat: in die Temic eingebracht wurde, bot sammenarbeit. Auch im Vorstand<br />
„Electronics“, „Automotive“ und sich die nächste Chance. Als stell- legt Eberhardt Wert auf klare Verhält-<br />
„Defence“. Dies sind heute die drei vertretender Vorsitzender der Genisse: Der angelsächsische CEO<br />
Säulen der „strategischen Holding“ schäftsführung der Temic Telefunken liegt ihm näher als ein Primus inter<br />
Rheinmetall, an deren Spitze er seit microelectronic GmbH verantwor- pares. Doch die Vorliebe für klare<br />
Jahresanfang 2000 steht. Begonnen tete er die Kfz-Elektronik, Airbag-Sy- Kommandostrukturen heißt nicht<br />
hat Eberhardts Laufbahn mit Electrosteme und Mikrosysteme. Nach die- Kommandoton. Entscheidungen im<br />
nics, als er nach dem Studium der sen „Automotive“-Jahren wechselte Vorstand werden erst getroffen,<br />
Mathematik und Physik 1972 bei der Eberhardt 1997 zu Rheinmetall, wo wenn Einstimmigkeit erreicht ist.<br />
Standard Electric Lorenz <strong>AG</strong> (SEL) in er den Vorstandsvorsitz der Rhein-<br />
(Börsen-Zeitung, 2. 12. 2000)<br />
„Automotive inside“: Für den 6-Zylinder-Boxter-Motor (Porsche) liefert die zum<br />
Rheinmetall-Konzern gehörende Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe den kompletten<br />
Aluminium-Motorblock, Kolben, Gleitlager sowie Öl- und Wasserpumpen.<br />
Vorstandschef Eberhardt wertet es als<br />
klaren Vertrauensbeweis, daß trotz<br />
dieses Verstoßes gegen die Covenants<br />
alle 21 Institute des international<br />
zusammengesetzten Konsortiums<br />
die dinglich nicht gesicherte Kreditfazilität<br />
ohne Abstriche aufrechterhalten<br />
haben.<br />
Entgegen allen anders lautenden<br />
Spekulationen ist sich der Rheinmetall-Chef<br />
des Rückhalts des Mehrheitsaktionärs<br />
Röchling sicher, seit der<br />
neue Aufsichtsratsvorsitzende Werner<br />
Engelhardt, der Vorsitzende der Geschäftsführung<br />
der Gebr. Röchling und<br />
Räumt Minen: der „Keiler“ von Rheinmetall-“Defence“.<br />
der Röchling Industrie Verwaltung<br />
GmbH, vor den Aktionären klipp und<br />
klar erklärte, daß der Familienverband<br />
nach wie vor fest zu Rheinmetall steht<br />
und seine Mehrheit von rund 66% der<br />
Stammaktien als ein maßgebliches industrielles<br />
Engagement betrachtet.<br />
Röchling erwarte allerdings eine angemessene<br />
Dividende sowie eine dauerhafte<br />
Wertsteigerung des Unternehmens,<br />
„die sich dann auch im Aktienkurs<br />
niederschlagen muß“.<br />
Der Forderung nach einer angemessenen<br />
Dividende ist Rheinmetall in<br />
der Vergangenheit stets nachgekommen,<br />
auch dann, wenn – wie zuletzt<br />
für 1999 – das operative Ergebnis<br />
nicht ausreichte. Die Ansprüche an die<br />
Wertsteigerung und den Aktienkurs<br />
hingegen blieben seit dem Sommer<br />
1998 unerfüllt, denn seit dem damaligen<br />
Gipfel von 32 € befand sich das<br />
Papier auf Talfahrt. Als sich der Staub<br />
nach der angeblichen Finanzkrise zu<br />
legen begann, kam der nächste<br />
Nackenschlag, als Rheinmetall am 16.<br />
November aus dem Index MSCI flog.<br />
Dem folgte ein Absturz auf die bisherige<br />
Talsohle von 6,41 €. Der<br />
Großaktionär könnte sicherlich selbst<br />
etwas für Wertsteigerung und Aktienkurs<br />
tun, wenn er dem Gedanken<br />
näher träte, durch Abschaffung der<br />
stimmrechtslosen Vorzugsaktien den<br />
Free Float nennenswert zu verbreitern,<br />
um möglicherweise wieder Gnade<br />
beim MSCI zu finden . . .<br />
Um den ersten Beweis anzutreten,<br />
daß sein Weg der richtige ist, kämpft<br />
Eberhardt darum, seine Prognose für<br />
das zu Ende gehende Jahr zu erfüllen.<br />
Mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern<br />
und Abschreibungen will er bei 400<br />
(305) Mill. € landen und damit das<br />
Niveau von 378 Mill. € aus dem Jahr<br />
1998 übertreffen. Das Ergebnis vor<br />
Steuern, ursprünglich mit 100 Mill. €<br />
angesetzt, wurde mit 90 Mill. € korrigiert,<br />
weil der Verkauf der Büromöbelsparte<br />
Mauser Waldeck mit einem<br />
Buchverlust einherging.<br />
Daß im<br />
ersten Halbjahr<br />
ein Verlust von 25<br />
Mill. € gezeigt<br />
werden mußte, ist<br />
bei Rheinmetall<br />
üblich. Die Aufholjagd<br />
in der zweiten<br />
Jahreshälfte wird<br />
115 Mill. € einfahren.<br />
Darin enthalten<br />
ist der Turnaround<br />
bei STN<br />
Atlas Elektronik, wo aus einem Verlust<br />
der zweiten Jahreshälfte von 25 Mill. €<br />
in diesem Jahr ein Gewinn von 7 Mill.<br />
€ werden soll.<br />
Die Umsatzrendite diesen Jahres von<br />
voraussichtlich 2,0% liegt noch weit<br />
von Eberhardts Ansprüchen entfernt.<br />
Als Vorgabe für das Jahr 2003 nennt er<br />
5%. Die Eigenkapitalrentabilität will er<br />
auf 20% (2000 voraussichtlich 16,7%)<br />
hochziehen und die Gesamtkapitalrentabilität<br />
bei 12% ansiedeln. Diese<br />
Kennzahl hatte 1999 bei 6,2% gelegen,<br />
und sie wird dieses Jahr auf<br />
10,0% anziehen.<br />
Eberhardt zeigt zwar ausgeprägte<br />
Ambitionen, bei dem von der Bundesregierung<br />
gewünschten Schulterschluß<br />
in der deutschen und später in<br />
der europäischen Heerestechnik mit<br />
Rheinmetall in der ersten Reihe zu stehen.<br />
Gleichwohl soll der Konzern nicht<br />
wieder wehrtechniklastig werden, sondern<br />
eines Tages ausgewogen auf drei<br />
Säulen stehen: In zehn Jahren, so seine<br />
Vorstellung, wird auf Automotive,<br />
Electronics und Defence jeweils ein<br />
Drittel des Umsatzes entfallen. Um dieses<br />
Gleichgewicht zu finden, wird der<br />
Elektronik-Bereich mit seinem aktuellen<br />
Gewicht von 16% am stärksten<br />
wachsen müssen. Das bedeutet, daß<br />
sich an die Konsolidierungspause alsbald<br />
eine offensive Phase anschließen<br />
muß.
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Seite 5<br />
„Avior“-Laserprojektionssystem von STN Atlas<br />
Neue Perspektiven<br />
durch Laserprojektion<br />
jhh/fk Orlando/Bremen. Weltpremiere:<br />
Die STN Atlas Elektronik GmbH<br />
(Bremen) hat ihr neuartiges Laserprojektionssystem<br />
namens „Avior“ Ende<br />
November 2000 in Orlando im US-<br />
Bundesstaat Florida auf der „I/ITSEC“,<br />
der weltweit größten Simulations-<br />
Fachmesse, erstmals einem internationalen<br />
Fachpublikum vorgestellt. So<br />
erfreulich dessen Resonanz, so erfolgreich<br />
auch die bisherigen Vermarktungsaktivitäten<br />
für das System, das<br />
sich unter anderem durch unbegrenzte<br />
Tiefenschärfe, hohe Farbvielfalt<br />
und Helligkeit, absolute Farbstabilität<br />
und konstante Farbkonvergenz auszeichnet:<br />
Mit der Lufthansa und der<br />
Luftwaffe der Bundeswehr kann der<br />
Bremer Elektronikspezialist bereits<br />
zwei prominente Referenzen in der<br />
zivilen bzw. militärischen Luftfahrt<br />
vorweisen.<br />
Der Mensch als ein – in bezug auf<br />
Wahrnehmung und Verarbeitung von<br />
Eindrücken – stark visuell geprägtes<br />
Wesen benötigt optische Informationen.<br />
Wenn man den Bereich Flugsimulation<br />
vom Standpunkt einer immer<br />
leistungs- und anforderungsintensiveren<br />
Aus- und Fortbildung näher betrachtet,<br />
wird klar, daß moderne Sichtsysteme<br />
unentbehrlich sind, die die<br />
Umwelt und Umgebung möglichst realitätsnah<br />
erzeugen.<br />
Mit „Avior“, einem neuartigen, hochleistungsfähigenLaserprojektionssystem,<br />
bietet die STN Atlas Elektronik<br />
GmbH jetzt in der Darstellung bisher<br />
nicht realisierbare Vorteile: unbegrenzte<br />
Tiefenschärfe, hohe Farbvielfalt<br />
und Helligkeit, absolute Farbstabilität<br />
und konstante Farbkonvergenz.<br />
Auf Basis dieser neuen Technologie<br />
stehen nunmehr Sichtsysteme für Simulatoren<br />
zur Verfügung, die jedem<br />
konventionellen Projektionssystem<br />
deutlich überlegen sind und die einen<br />
bisher unbekannten Realitätsgrad erreichen.<br />
Der Bremer Elektronikspezialist hat<br />
auch bereits erste Interessenten, die<br />
„Avior“ im Bereich der Flugsimulation<br />
einsetzen wollen. Die Lufthansa Flight<br />
Training GmbH will das neuartige Laserprojektionssystem<br />
verwenden, um bereits<br />
im Ausbildungsbetrieb befindliche<br />
Flugsimulatoren aufzuwerten. Unter<br />
dem Stichwort „Daylight Cockpit“ sollen<br />
die Simulatoren im Bereich der Projektion<br />
an die Bedürfnisse der Aus- und<br />
Fortbildung hochqualifizierten fliegenden<br />
Personals angepaßt werden. Mit<br />
„Avior“ lassen sich künstlich Tageslichtverhältnisse<br />
schaffen, was bislang<br />
nicht möglich war. Außerdem können<br />
kalligraphische Lichter (beispielsweise<br />
Landebahnbefeuerung) verblüffend<br />
Flugsimulation: Mit Hilfe eines Doms mit Laserprojektionsköpfen und vier Zieldarstellungsprojektoren<br />
werden realitätsnahe, visuelle Eindrücke geschaffen, die<br />
wiederum gewährleisten, daß hochqualifiziertes fliegendes Personal – hier am<br />
Beispiel des Kampfflugzeugs „Tornado“ der deutschen Luftwaffe – adäquat ausund<br />
fortgebildet werden kann.<br />
realitätsnah projiziert werden. Die Entwicklung<br />
des „Daylight Cockpit“-Konzeptes<br />
wird durch den Bremer Senat gefördert.<br />
Ein weiterer Sektor, der sich im Bereich<br />
der Flugsimulation für „Avior“ interessiert,<br />
ist die Bundeswehr. Die<br />
Luftwaffe will acht „Full Mission“-Simulatoren<br />
für „Tornado“-Kampfflugzeuge<br />
mit der neuartigen Laserprojektionstechnik<br />
bestücken.<br />
Die Simulatoren mit Dom-Projektionstechnik<br />
(300 0 x120 0 Sichtfeld)<br />
sollen jeweils mit einem 13kanaligen<br />
„Laser Display“-System vom Typ<br />
„Avior“ ausgestattet werden. Als digitales<br />
System erreicht „Avior“ extrem<br />
Darstellung eines „Full Flight“-Simulators (FFS) mit Dreikanal-Laserprojektionssystem:<br />
Die Projektion per Laser bietet unbegrenzte Tiefenschärfe, hohe Farbvielfalt<br />
und Helligkeit bei absoluter Farbstabilität und konstanter Farbkonvergenz.<br />
Mit recht kompakten Abmessungen und einem Gewicht von nur rund acht Kilogramm bringt der „Avior“-Projektionskopf<br />
zahlreiche Vorteile beim Einbau in Flugsimulatoren mit sich – Vorteile, die z. B. die Lufthansa und die Luftwaffe nutzen wollen.<br />
hohe Ausfallsicherheit bei geringstem<br />
Wartungsaufwand.<br />
Der „Tornado“-Simulator wird von einem<br />
der vielen Vorteile des neuen Systems<br />
besonders profitieren: Das System<br />
ist recht kompakt (der Projektionskopf<br />
wiegt rund acht Kilogramm)<br />
und verfügt, bedingt durch Trennung<br />
von Projektionskopf und Laserquelle,<br />
über geringe Einbaumaße. Dies ermöglicht<br />
den Bau von wesentlich leichteren<br />
und kompakteren „Full Flight“-Simulatoren<br />
(FFS) mit beispielsweise elektrischem<br />
Bewegungssystem, also ohne<br />
Hydraulikraum. Der erste Simulator für<br />
das Kampfflugzeug „Tornado“, der<br />
sichtsystemtechnisch mit „Avior“-Technologie<br />
zur Ausrüstung ansteht, soll in<br />
Holloman/USA installiert werden.<br />
Dank zahlreicher verwirklichter, bislang<br />
als nicht erreichbar geltender<br />
Fähigkeiten wird „Avior“ für D-Level-Simulatoren<br />
– das sind zertifizierte und<br />
damit offiziell zugelassene Ausbildungs-<br />
und Trainingssimulatoren in<br />
der Fliegerei, basierend auf Richtwerten<br />
der „Joint Aviation Authorities and<br />
Kooperation mit<br />
Atlantis Systems<br />
dp Brampton/Bremen. Die STN Atlas<br />
Elektronik GmbH (Bremen) und<br />
die Atlantis Systems International<br />
Inc. in Brampton (Kanada) bilden eine<br />
strategische Allianz zur Entwicklung<br />
und Vermarktung der taktischen<br />
Marine-Trainer von Atlantis. Der Bremer<br />
Systemspezialist übernimmt dabei<br />
den Verkauf und den Vertrieb des<br />
gesamten Produktsegments „Maritimes<br />
Taktisches Training“ des kanadischen<br />
Unternehmens.<br />
Mit dieser neuerlichen transatlanti-<br />
Mexiko: Zoll setzt<br />
auf „HCV-Mobile“<br />
dp Veracruz/Paris. Heimann Systems<br />
hat kürzlich einen Auftrag von<br />
der mexikanischen Zollbehörde (Administracion<br />
General de Aduanas de<br />
Mexico) über mehr als 3,7 Millionen<br />
US-Dollar erhalten. Die Order umfaßt<br />
die Lieferung des neuesten „HCV-Mobile“-Systems<br />
(„Heimann CargoVision“),<br />
das zur Bekämpfung von<br />
Schmuggel und dem Umschlag illegaler<br />
Stoffe eingesetzt wird.<br />
Ziel der Maßnahme ist die Modernisierung<br />
der gesamten Betriebsabläufe<br />
von Zollprüfungen. Im Vorfeld hatte<br />
sich die mexikanische Zollbehörde einen<br />
umfassenden Überblick über alle<br />
potentiellen Lieferanten von mobilen<br />
Prüfsystemen verschafft. Aufgrund<br />
des technologischen Vorsprungs fiel<br />
Federal Aviation Authority“ – zugelassen<br />
werden.<br />
Ein großes Problem beim Bau von Simulationsanlagen<br />
wird mit „Avior“<br />
ebenfalls gelöst: das Gewicht der Projektoren.<br />
Professionelle Projektoren –<br />
das sind die „großen Brüder“ der<br />
Video-Beamer, die in immer mehr<br />
Haushalten statt eines Fernsehers zum<br />
Einsatz kommen und die Bilder bis zu<br />
mehreren Quadratmetern Größe projizieren<br />
können – sind sehr schwer und<br />
deshalb besonders bei Simulatoren,<br />
die auf einem Bewegungssystem gelagert<br />
sind, nur mit hohem mechanischen<br />
Aufwand einzusetzen. Bei „Avior“<br />
muß nur der sehr leichte Projektionskopf<br />
in den eigentlichen Simulator<br />
integriert werden. Die Laserquelle<br />
selbst kann außerhalb des Simulators<br />
plaziert werden. Die bewegten Bilder<br />
werden per Glasfaserkabel übertragen.<br />
Darüber hinaus besteht zukünftig die<br />
Möglichkeit, mehrere Projektionsköpfe<br />
mit nur einer Laserquelle zu betreiben.<br />
Anwendungen des neuartigen Systems<br />
realisiert STN Atlas Elektronik<br />
schen Kooperation untermauert die<br />
Rheinmetall-DeTec-Gruppe ihren Anspruch<br />
als führender Anbieter der<br />
Wehrtechnik in Europa mit dem Ziel,<br />
das erfolgreiche Engagement auf<br />
dem nordamerikanischen Markt weiter<br />
zu intensivieren und den Marktanteil<br />
auszuweiten.<br />
Dipl.-Kfm. Ulrich Grillo, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der STN Atlas<br />
Elektronik GmbH: „Die Kombination<br />
ist ideal: Atlantis mit seiner exzellenten<br />
Technologie, bei Seestreitkräften<br />
weltweit bewährt, und STN Atlas Elektronik<br />
mit jahrzehntelanger Erfahrung<br />
und Tradition bei hochentwickelten<br />
Sensoren, Systemen und Simulatoren<br />
die Wahl auf das „HCV-Mobile“-System<br />
des Wiesbadener Spezialisten.<br />
Das neue System wird Ende des Jahres<br />
2000 im Hafen von Veracruz, dem<br />
wichtigsten mexikanischen Seehafen<br />
mit dem höchsten Frachtumschlag, in<br />
Betrieb genommen und von geschulten<br />
Mitarbeitern der Zollbehörde bedient.<br />
Es besteht aus einem integrierten<br />
Transportfahrzeug und einem<br />
ausschwenkbaren „Röntgenarm“, an<br />
dem Röntgenquelle und Detektorzeile<br />
befestigt sind. Das System ist in weniger<br />
als 30 Minuten nach Eintreffen am<br />
Einsatzort funktionsbereit. „HCV-Mobile“<br />
durchleuchtet einen beladenen<br />
Lkw in weniger als zwei Minuten bzw.<br />
ca. 25 Lkw pro Stunde. Dank seiner<br />
vollen Mobilität ist dieses System fast<br />
überall einsetzbar.<br />
Die hohe Durchdringungsleistung<br />
und das leistungsfähige Sensorsystem<br />
ermöglichen, vollbeladene Con-<br />
derzeit im Bereich der Flugsimulation.<br />
Durch Einsatz von „Avior“ in einem<br />
„Full Flight“-Simulator bieten sich die<br />
genannten fundamentalen Vorteile gegenüber<br />
herkömmlichen Systemen. Eine<br />
nahezu unschlagbare Schwerpunktverbesserung<br />
aufgrund des geringen<br />
Gewichtes ermöglicht den Bau<br />
eines insgesamt leichteren und kompakteren<br />
FFS mit elektrischem Bewegungssystem.<br />
„Avior“ bietet als digitales System<br />
zudem eine sehr hohe Ausfallsicherheit<br />
bei geringstem Wartungsaufwand.<br />
Alle Einzelkomponenten des<br />
Systems sind reparierbar und senken<br />
die Lebensdauerkosten weiter. Mit<br />
„Avior“ können auch bereits bestehende<br />
Simulatoren problemlos aufgerüstet<br />
werden. Hauptmerkmale sind<br />
das geringe Gewicht, die geringen Einbaumaße<br />
und die Trennung von Laserquelle<br />
und Projektionskopf. Aufgrund<br />
seines modularen Aufbaus kann<br />
„Avior“ deshalb problemlos in vorhandene<br />
Systemlandschaften eingebunden<br />
werden.<br />
für Marineanwendungen. Die Kooperation<br />
versetzt uns in die Lage, auf<br />
dem wachsenden Weltmarkt für Ausbildungs-<br />
und Schulungssysteme im<br />
Marinebereich künftig eine entscheidende<br />
Rolle zu spielen.“<br />
Im Rahmen der neuen Allianz hat<br />
STN Atlas Elektronik die alleinige Verantwortung<br />
für den Verkauf und Vertrieb<br />
bei neuen Abschlüssen,<br />
während die Zuständigkeiten bei Entwicklung<br />
und Dienstleistungen aufgeteilt<br />
werden. Aus Sicht der Bestandskunden<br />
gibt es keine Änderungen<br />
hinsichtlich der vertraglich vereinbarten<br />
Betreuung und im Falle von Gewährleistungen. <br />
tainer zu durchleuchten und dabei<br />
ein hochauflösendes Röntgenbild zu<br />
erstellen, das durchaus mit den<br />
größeren und leistungsfähigeren stationären<br />
Systemen von Heimann Systems<br />
vergleichbar ist. „HCV-Mobile“<br />
ist zur Zeit weltweit das einzige System,<br />
das Mobilität mit außergewöhnlicher<br />
Leistungsfähigkeit vereint.<br />
Als Teil der Produktpalette von Heimann<br />
Systems ist „Heimann CargoVision“<br />
das Resultat jahrzehntelanger<br />
Erfahrung in Entwicklung und Produktion<br />
von Röntgenprüfsystemen.<br />
„HCV“-Systeme tragen zur Erhöhung<br />
der Sicherheit bei, indem sie illegale<br />
Waffen- oder Drogenimporte verhindern<br />
helfen, Zolleinkünfte durch Auffinden<br />
von Schmuggelware erhöhen<br />
und Handelsbewegungen durch verkürzte<br />
Zeiten bei der Verschiffung und<br />
Verzollung von Ware beschleunigen.
Seite 6 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Die BKK des Rheinmetall-Konzerns bietet optimalen Versicherungsschutz –<br />
im Krankenhaus ebenso wie beim Thema „Gesundheitsvorsorge im Alter“.<br />
Heimann Systems auf „Security 2000“ in Essen<br />
Kundenkontakte lagen<br />
auf sehr hohem Niveau<br />
sm/cd Essen/Wiesbaden. Die Erfolgsmeldung<br />
kam pünktlich zum Auftakt<br />
der „Security 2000“ in Essen, der<br />
führenden Messe im Bereich der<br />
Sicherheitstechnik: Heimann Systems<br />
wird bis Mitte 2001 den Rhein-Ruhr-<br />
Flughafen in Düsseldorf mit vollautomatischen<br />
Röntgenprüfsystemen zur<br />
hundertprozentigen Kontrolle von<br />
„Check-In“-Gepäck ausstatten. Damit<br />
wird Düsseldorf mit innovativer Technik<br />
von Heimann Systems zum Vorreiter<br />
unter den deutschen Großflughäfen bei<br />
der lückenlosen automatischen<br />
Gepäckkontrolle (siehe auch Beitrag an<br />
anderer Stelle dieser „<strong>Profil</strong>“-Ausgabe).<br />
Nach der breiten Medienberichterstattung<br />
über den Auftrag konnten<br />
sich die Besucher der „Security 2000“<br />
vom 10. bis 13. Oktober auf dem über<br />
100 Quadratmeter großen Messestand<br />
ausführlich über das mehrstufige<br />
Kontrollsystem informieren. Das<br />
Auftragsvolumen für den Flughafen<br />
Düsseldorf beträgt insgesamt 7,2 Millionen<br />
€ und umfaßt fünf Geräte der<br />
ersten Kontrollstufe („Hi-Scan 10065<br />
EDS“) sowie vier Geräte der zweiten<br />
Stufe (HDX 10065), die nahtlos in das<br />
bestehende Gepäckfördersystem integriert<br />
werden.<br />
Als weiteres Messe-Highlight präsentierte<br />
Heimann Systems in Essen<br />
mit „HiTraX XADA“ eine neue Dimension<br />
in der Qualität von Röntgenbildern.<br />
Auf der Basis der neuen „HiTraX“-Elek-<br />
tronik verfügt das Wiesbadener Unternehmen<br />
damit über ein völlig neuartiges,<br />
leistungsfähiges Sensorsystem<br />
zur Erfassung von Röntgenbilddaten.<br />
Die Bedeutung liegt auf der Hand, da<br />
die Ergebnisse aller computergestützten<br />
Bildverarbeitungsprozesse vom Informationsgehalt<br />
der Rohdaten und<br />
damit von der Leistungsfähigkeit des<br />
Sensorsystems abhängen. Die neuentwickelte<br />
„XADA“-Technologie von<br />
Heimann Systems läßt hier alle bislang<br />
existierenden Sensorsysteme in<br />
den drei entscheidenden Leistungskategorien<br />
Durchdringung, Drahterkennbarkeit<br />
und Materialklassifikation weit<br />
hinter sich.<br />
Großen Zuspruch fand auf der „Security<br />
2000“ auch das neue „Reality<br />
Training“ für Sicherheitspersonal. Mit<br />
„OTS Xtrain“ hat Heimann Systems eine<br />
innovative Weiterentwicklung seines<br />
Schulungskonzeptes für Bedienpersonal<br />
von Röntgenprüfgeräten vorgestellt.<br />
Das neue Modul, das auf der<br />
Maßstabgetreues Modell: „HCV-Mobil“ zur Kontrolle von Containern und Fahrzeugen.<br />
Dipl.-Ing. Fereidun Alizadeh (r.), Vertriebsgebietsbeauftragter<br />
bei Heimann<br />
Systems, erläutert die Funktionsweise<br />
des innovativen Handgepäck-Röntgenprüfsystems<br />
„ProLine“.<br />
aktuellen „HiTraX“-Systemplattform<br />
aufbaut, sorgt für ein Höchstmaß an<br />
Realitätsnähe. Die besondere Stärke:<br />
Anstatt ein reales Röntgenprüfgerät<br />
durch PC-basierte Software nachzuempfinden,<br />
nutzt das Schulungsprogramm<br />
die Komponenten des realen<br />
Systems. So kann die Übungssituation<br />
die tatsächlichen Verhältnisse am<br />
Röntgenprüfgerät wirklichkeitsnah widerspiegeln.<br />
Neben den technischen Innovationen<br />
wurde in Essen auch ein Bestseller<br />
von Heimann Systems als neue Design-Studie<br />
präsentiert: Das Kompakt-<br />
Röntgenprüfgerät „Hi-Scan 5030“ lieferte<br />
den Beweis, daß zuverlässige Sicherheitstechnik<br />
nicht zwangsläufig<br />
unattraktiv und unförmig sein muß. Im<br />
Stil des Designs von „ProLine“ wurde<br />
dem bewährten System ein neues,<br />
modernes Äußeres gegeben – und das<br />
bei gleichbleibend optimalen Abmessungen.<br />
Aufgrund seines geringen<br />
Platzbedarfs und der leichten Bedien-<br />
BKK Rheinmetall<br />
erhöht Beiträge<br />
rds Düsseldorf. Die Betriebskrankenkasse<br />
(BKK) der Rheinmetall <strong>AG</strong><br />
erhöht ihren Beitragssatz zum 1. Januar<br />
2001 auf 13,2 Prozent (bisher:<br />
12,5%). Die vom BKK-Verwaltungsrat<br />
Mitte Oktober 2000 einstimmig beschlossene<br />
Anhebung geht zum einen<br />
auf die spürbare Leistungsausweitung<br />
in verschiedenen Segmenten<br />
(z.B. bei Arzneimitteln) zurück. Zum<br />
anderen führt die schrittweise Ausweitung<br />
des Risikostrukturausgleiches<br />
(RSA) – die hiermit verbundenen<br />
Ausgleichszahlungen werden von<br />
2001 an auch auf die neuen Bundesländer<br />
ausgedehnt – zu einer erheblichen<br />
Mehrbelastung der finanzstarken<br />
Krankenkassen in Westdeutschland.<br />
Davon ist in erheblichem Um-<br />
Großauftrag<br />
aus der Schweiz<br />
oho Bern/Bremen. Die zum Rheinmetall-Konzern<br />
gehörende STN Atlas<br />
Elektronik GmbH (Bremen) hat einen<br />
Großauftrag aus der Schweiz erhalten.<br />
Das Unternehmen wird 120<br />
Spezialfahrzeuge der Schweizer Armee<br />
mit Beobachtungs- und Aufklärungsausstattungen<br />
ausrüsten.<br />
Der Vertrag wurde jetzt mit der Gruppe<br />
Rüstung in Bern unterzeichnet.<br />
Die Schweizer Armee wird in den<br />
nächsten Jahren 120 Schießkommandantenfahrzeuge<br />
erhalten.<br />
Die entsprechenden Aufträge gingen<br />
an drei Unternehmen, darunter<br />
fang auch die Betriebskrankenkasse<br />
des Rheinmetall-Konzerns betroffen:<br />
20 Prozent ihrer jährlichen Gesamteinnahmen<br />
in Höhe von derzeit rund<br />
100 Millionen Mark werden in den<br />
RSA-Topf eingezahlt.<br />
BKK-Vorstand Wilfried Duile, dessen<br />
Einrichtung insgesamt rund 26 700<br />
Rheinmetall-Mitarbeiter einschließlich<br />
Familienangehörige betreut: „Mit<br />
dem neuen Satz liegen wir immer<br />
noch deutlich unter dem durchschnittlichen<br />
aktuellen Beitragssatz<br />
aller gesetzlichen Krankenkassen<br />
(13,7 Prozent) und sind gleichzeitig<br />
deutlich preiswerter als zum Beispiel<br />
die Ortskrankenkassen oder die<br />
großen Ersatzkassen (BEK, DAK) – bei<br />
einem gleichzeitig qualitativ hochwertigen<br />
Leistungsspektrum.“ Eine Bewertung,<br />
die bei der unlängst durchgeführten<br />
Mitgliederbefragung einmal<br />
mehr bestätigt wurde.<br />
STN Atlas Elektronik als Lieferant<br />
der Beobachtungsausstattungen<br />
mit Wärmebildgerät, CCD-Kamera<br />
und Laserentfernungsmesser. Der<br />
Lieferumfang umfaßt neben dem<br />
Bediengerät sowie Prüfmitteln für<br />
die Feld- und Depotinstandsetzung<br />
auch Ersatzteile. Der Auftrag<br />
schließt auch Ausbildungskurse ein.<br />
Im Herbst 2001 werden vier Systeme<br />
im Rahmen einer Vorserie ausgeliefert.<br />
Von Februar 2002 an gehen<br />
monatlich sechs weitere Einheiten<br />
an den Kunden. Die drei beteiligten<br />
Firmen (STN Atlas Elektronik,<br />
MOW<strong>AG</strong> und Honeywell) arbeiteten<br />
bei diesem Projekt als gleichwertige<br />
Partner, d.h. ohne Generalunternehmer.<br />
Großer Auftrag von<br />
der Szczecin-Werft<br />
dp Hamburg. Die STN Atlas Marine<br />
Electronics GmbH hat unlängst von<br />
der Szczecin-Werft in Polen den Auftrag<br />
zur Lieferung von Wellengenerator-/Motor-Anlagen<br />
für acht Chemieprodukte-Tanker<br />
für die Reedereien<br />
Ceres Hellenic Shipping in Griechenland<br />
und Odfjell Tankers in Norwegen<br />
erhalten. Die Lieferung erstreckt sich<br />
über einen Zeitraum bis Ende 2003.<br />
Die Anlagen sind ausgelegt für Wellengenerator-Betrieb<br />
im Drehzahlbereich<br />
von 67 bis 105 1/min mit einer<br />
Leistung von 1840kVA, im Motorbetrieb<br />
mit einer Leistung von 1500kW.<br />
Jede Anlage setzt sich u. a. aus einem<br />
im Wellenstrang eingebauten Wellengenerator,<br />
einer Blindleistungsmaschine<br />
und einem sechspulsigen Frequenz-Umrichter<br />
zusammen.<br />
Im Rahmen des offiziellen Messerundgangs am Eröffnungstag der „Security 2000“ informierte Dipl.-Ing. Hans Zirwes (r.),<br />
Prokurist und Leiter Vertrieb & Projekte bei Heimann Systems, über das neue System zur vollautomatischen Sprengstoffkontrolle.<br />
Aufmerksame Zuhörer waren u.a. der Essener Bürgermeister Norbert Kleine-Möllhoff (2.v.r.), Wolfgang Hoffmann<br />
(sitzend), Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Wirtschaft, Dr. Joachim Henneke, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der Messe Essen GmbH, sowie Uwe Glock vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie.<br />
barkeit wird das System weltweit bereits<br />
hundertfach in Poststellen, Gerichten,<br />
in der Industrie und auch in<br />
Schulen eingesetzt.<br />
Vor dem Hintergrund der weltweit<br />
wachsenden Gefahr durch Drogenund<br />
Waffenschmuggel sowie andere<br />
illegale Warentransporte stießen zudem<br />
die „CargoVision“-Röntgenprüfsysteme<br />
zur Container- und Fahrzeugkontrolle<br />
bei den „Security“-Besuchern<br />
auf großes Interesse. Auf der Basis<br />
neuester Technologie bietet Heimann<br />
Systems in diesem Bereich individuell<br />
zugeschnittene Lösungen für<br />
Häfen, Flughäfen und Grenzkontrollstellen.<br />
Das „CargoVision“-System ermöglicht<br />
Zollbehörden und Sicherheitsdiensten<br />
das zuverlässige Auffinden<br />
von Narkotika, Waffen, Sprengstoffen<br />
und Chemikalien sowie die<br />
Identifikation von Schmuggelware wie<br />
Zigaretten und Alkohol.<br />
Neues gab es in Essen auch von Heimann<br />
Biometric Systems (Jena): Vor-<br />
gestellt wurde der neuentwickelte Einzelfinger-Scanner<br />
LS2/F. Dieser sogenannte<br />
„LiveScanner“ dient zur Erfassung<br />
von abgerollten und flachen Fingern<br />
und wurde gemäß der Richtlinien<br />
des US-amerikanischen FBI konstruiert.<br />
Ein weiteres innovatives Produkt<br />
der Jenaer Experten, das die Produktpalette<br />
der leistungsstarken biometrischen<br />
LiveScanner optimal ergänzt.<br />
Sicherheit ist stark gefragt – mit diesem<br />
Tenor zog nicht nur Heimann Systems,<br />
sondern auch die Messe Essen<br />
ihre „Security“-Bilanz. Mit rund 35000<br />
Besuchern – davon fast 98 Prozent<br />
Fachbesucher – und mehr als 900<br />
Ausstellern aus 30 Ländern bestätigte<br />
die Fachschau ihre Position als international<br />
führende Fachmesse im Bereich<br />
der Sicherheitstechnik. Bundesinnenminister<br />
Otto Schily, Schirmherr<br />
der „Security 2000“, sprach von<br />
einer Messe mit „klarem <strong>Profil</strong> und<br />
kompletter Abbildung der Branche“.<br />
Für Heimann Systems ein besonders<br />
wichtiger Faktor: die hohe Internationalität<br />
der Security. Dem weltweiten<br />
Engagement der Firmengruppe entsprechend<br />
lag die Quote ausländischer<br />
Besucher am eigenen Stand erwartungsgemäß<br />
bei nahezu 50 Prozent,<br />
wobei über 30 Länder vertreten<br />
waren. Vertriebsleiter Hans Zirwes zog<br />
nach Abschluß der vier Messetage ein<br />
positives Fazit: „Besonders aufgrund<br />
der hohen Kontaktqualität stellt die<br />
‚Security‘ eine feste Größe in unserer<br />
Messeplanung dar. Wir sind in zwei<br />
Jahren auf jeden Fall wieder dabei.“<br />
Zufriedenheit auch bei zahlreichen<br />
anderen Ausstellern und Fachverbänden.<br />
92 Prozent beurteilten das Ergebnis<br />
ihrer Beteiligung an der Fachmesse<br />
mit „sehr gut“ bis „befriedigend“. 91<br />
Prozent sprachen von einer hohen<br />
Qualifikation der Fachbesucher. Aufgrund<br />
der Kundenkontakte rechnen 95<br />
Prozent mit einem guten Nachmessegeschäft<br />
– so auch die Heimann-Systems-Gruppe.<br />
Dipl.-Kfm. Ulrich Grillo, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung des Bremer<br />
Unternehmens: „Diese neue<br />
Form der Zusammenarbeit können<br />
wir nur positiv bewerten. Das Vorhaben<br />
wurde nach einer Studien-Vorphase<br />
in der ungewöhnlich kurzen<br />
Zeit von drei Jahren entwickelt, erprobt<br />
und zur Beschaffungsreife gebracht.“<br />
Bodo Wittwer, Systemführer<br />
bei der Gruppe Rüstung als Auftraggeber:<br />
„Solche Leistungen sind<br />
nur möglich, wenn in hohem Maße<br />
motiviert und zielgerichtet gearbeitet<br />
wird. Besonders anzuerkennen<br />
ist es, wenn die Industrie wie in diesem<br />
Fall Vor- und Eigenleistungen<br />
mit entsprechender Risikobereitschaft<br />
erbringt.“
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Seite 7<br />
PAT liefert dynamische Achslast-Erfassungssysteme<br />
Gezielter Kampf gegen<br />
überladene Fahrzeuge<br />
dc Ettlingen. Gezielter Kampf gegen<br />
überladene Fahrzeuge: Der Geschäftsbereich<br />
Verkehrstelematik der PAT-<br />
Gruppe hat in diesem Jahr zwei<br />
Großaufträge zur Lieferung von Achslast-Erfassungssystemen<br />
auf Autobah-<br />
Ein Bestandteil des PAT-Projektes: tragbarer<br />
PC mit Verstoß-Bilddarstellung<br />
zur effizienten Fahrzeugausschleusung.<br />
Gute Noten für<br />
„Automotive“<br />
dp Düsseldorf. Die beiden international<br />
tätigen Rating-Agenturen<br />
Moody’s und Standard & Poor’s<br />
haben bei der Kolbenschmidt Pierburg<br />
<strong>AG</strong> (Düsseldorf) erstmals Analysen<br />
vorgenommen. Dabei wurde<br />
Kolbenschmidt Pierburg von Standard<br />
& Poor’s mit „A-2“ für kurze<br />
und „BBB“ für lange Fristen beurteilt;<br />
Moody’s vergab die Einstufung<br />
„Baa2“ für das langfristige<br />
Emittenten-Rating. Beide Werte<br />
sind positiv und entsprechen dem<br />
Rating der Muttergesellschaft<br />
Rheinmetall <strong>AG</strong>.<br />
Wie die Agenturen hervorheben,<br />
tragen zu der hohen Kreditwürdigkeit<br />
wesentlich die gesunde<br />
Stellung von Kolbenschmidt Pierburg<br />
als Automobilzulieferer, sein<br />
weltweiter Kundenkreis und die<br />
Unabhängigkeit von einzelnen<br />
Automobilherstellern bei. In der<br />
Begründung für das Rating wird besonders<br />
betont, daß das Knowhow<br />
in der Fertigung erstklassig<br />
und die Produktpalette von<br />
herausragender Qualität sei. Die<br />
niedrige Gesamtverschuldung und<br />
der hohe „Cash-Flow“ ließen ausreichend<br />
Spielraum für weitere<br />
Akquisitionen. Für mögliche Risiken<br />
aus zyklischen Fluktuationen<br />
in der Automobilherstellung sowie<br />
aus dem Wettbewerbsumfeld sei<br />
die Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe<br />
durch ihre hohe Innovationskraft<br />
und umsichtige Finanzierung<br />
gut gerüstet.<br />
Nach Meinung von Standard &<br />
Poor’s dürften sich die Erträge auf<br />
mittlere Sicht weiter erhöhen, unter<br />
anderem aufgrund der verbesserten<br />
Rentabilität einer Anfang<br />
2000 erworbenen Pumpenproduktion<br />
von Magneti Marelli in Italien<br />
und der erfreulichen Entwicklung<br />
im Geschäftsbereich Aluminium-Technologie.<br />
nen in Deutschland (PAT GmbH, Ettlingen)<br />
und in den Niederlanden (PAT<br />
Krüger bv, Holland) mit einem Gesamtvolumen<br />
von über 3,5 Millionen € erhalten.<br />
Ausschlaggebend für die Auftragserteilung<br />
war die enorme Erfahrung<br />
der PAT-Experten in der dynamischen<br />
Wiegetechnik und der systemtechnischen<br />
Integrationsfähigkeit sowie<br />
ihre große Fachkompetenz in der<br />
praktischen Realisierung digitaler Videosysteme.<br />
Laurie Burns, Vorsitzender der Geschäftsleitung:<br />
„Die neue Strategie der<br />
Integration zusätzlicher Sensoren, die<br />
die eigene Produktpalette sowohl<br />
technologisch als auch anwendungsspezifisch<br />
ergänzen, trägt bereits die<br />
ersten Früchte“. Dr. Dieter Cichon, verantwortlich<br />
für den Bereich „Produktmanagement<br />
und Entwicklung“,<br />
ergänzt: „Durch konsequente Entwicklung<br />
und Applikation digitaler Videosysteme<br />
wurde eine fundierte Basis<br />
für diverse videogestützte Anwendungen<br />
in der Verkehrsüberwachung geschaffen.<br />
Diese Kompetenz wird uns<br />
bei zukünftigen Projektakquisitionen<br />
Wettbewerbsvorteile bringen.“<br />
In Deutschland wird ein bundesweites<br />
Meßstellennetz mit dynamischen<br />
Achslast-Erfassungssystemen für hohe<br />
Geschwindigkeiten errichtet. Diese<br />
erste Ausschreibung umfaßt insgesamt<br />
13 Meßstellen an Bundesautobahnen<br />
in den Ländern Bayern, Brandenburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.<br />
An diesen Meßstellen werden auf<br />
allen Fahrstreifen sämtliche Fahrzeuge<br />
vollautomatisch detektiert und nach<br />
Fahrzeugtypen klassifiziert.<br />
In mindestens dem rechten Fahrstreifen<br />
sind Achslast-Erfassungssensoren<br />
in die Fahrbahnoberfläche eben<br />
eingelassen. Cichon: „Der Autobahnverkehr<br />
wird durch die Meßsensorik<br />
nicht beeinflusst. Unser HSWIM-System<br />
(„High Speed Weigh-in-Motion“)<br />
erfaßt Achslasten von Lastkraftwagen<br />
bei Geschwindigkeiten bis 120 km/h<br />
unter Einhaltung vorgegebener Toleranzen“.<br />
Aus den einzelnen Achslastwerten<br />
ermittelt das System die Gesamtgewichte<br />
von Mehrfachachsgruppen<br />
sowie das tatsächliche Fahrzeug-<br />
Gesamtgewicht. Für jede Fahrzeugklasse<br />
gelten entsprechende Grenzwerte<br />
für maximal zulässige Achslasten<br />
und für das Gesamtgewicht. Bei<br />
Überschreitung eines Grenzwertes<br />
kann unverzüglich ein Alarmsignal<br />
vom System ausgegeben werden.<br />
An sieben der 13 bundesdeutschen<br />
Meßstellen wird zusätzlich ein digitales<br />
Videosystem integriert, mit dessen<br />
Hilfe die Polizei überladene Fahrzeuge<br />
aus dem Fließverkehr gezielt selektieren<br />
und ausschleusen kann. Das digitale<br />
Videosystem besteht aus einer<br />
Farbkamera, einer Datenübertragungsstrecke<br />
sowie einem tragbaren<br />
PC mit digitaler Bildverarbeitung. Der<br />
Polizeibeamte erhält am Ort der Ausschleusung<br />
ein Bild des als überladen<br />
gemessenen Fahrzeugs inklusive der<br />
prozentualen Höhe der Überladung.<br />
In Deutschland wird ein bundesweites Meßstellennetz mit dynamischen Achslast-Erfassungssystemen der PAT errichtet. Die<br />
erste Ausschreibung des Projektes umfaßt insgesamt 13 Meßstellen an Autobahnen in den Ländern Bayern, Brandenburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Foto: Reuters<br />
Zur Person<br />
Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH) Walter<br />
R. Kaiser (54), bisher Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung der Hirschmann<br />
Electronics GmbH & Co. KG,<br />
Neckartenzlingen, ist am 30. November<br />
2000 aus dem Unternehmen<br />
ausgeschieden.<br />
Zu seinem Nachfolger wurde Dipl.-<br />
Ing. (FH) Dipl.-Wirtschafts-Ing. (FH)<br />
Reinhard Sitzmann (52) bestellt, der<br />
sein Amt am 1. Dezember 2000 angetreten<br />
hat. Zugleich wurde Sitzmann<br />
zum Generalbevollmächtigten<br />
der Aditron <strong>AG</strong> (Düsseldorf) ernannt,<br />
der Führungsgesellschaft des<br />
Rheinmetall-Unternehmensbereiches<br />
Electronics, zu dem Hirschmann<br />
Electronics gehört.<br />
Sitzmann war seit 1998 innerhalb<br />
des Aditron-Verbundes Vorsitzender<br />
der Geschäftsleitung der PAT GmbH,<br />
Ettlingen, die auf dem Gebiet der Baumaschinen-Elektronik<br />
weltweit<br />
führend ist. Als Nachfolger von Sitzmann<br />
bei PAT wurde Laurence Burns<br />
(49) zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung<br />
bestellt. Burns gehört dem Unternehmen<br />
seit Anfang 1999 an.<br />
Dipl.-Ing. Lic. oec. Ernst Odermatt<br />
(52) ist vom Aufsichtsrat der Rheinmetall<br />
DeTec <strong>AG</strong> mit Wirkung vom 1. Januar<br />
2001 zum stellvertretenden Mitglied<br />
des Vorstandes der Gesellschaft<br />
bestellt worden. Odermatt, der 1978 in<br />
den Oerlikon-Bührle-Konzern eingetreten<br />
ist, gehört durch den Erwerb<br />
von Oerlikon Contraves durch Rheinmetall<br />
seit 21. Dezember 1999 als Leiter<br />
der Oerlikon-Contraves-Gruppe zur<br />
INFORMATION AUS ERSTER HAND erhielt General Eric Shinseki (5.v.r.), „Chief of Staff“ der US-Army, kürzlich bei<br />
seinem Besuch des AUSA-Messestandes der Rheinmetall-DeTec-Gruppe in Washington. Shinseki, der Mitte Dezember<br />
diesen Jahres auch zu Gast im europäischen Kompetenzzentrum für Heerestechnik in Unterlüß war, wurde von der<br />
„Defence“-Standbesatzung ausführlich u. a. über die 105mm-Glattrohrwaffenanlage, die dazugehörige Munitionsfamilie<br />
sowie das Programm gepanzerter Fahrzeuge informiert. Zur „Crew“ vor Ort gehörten (v.l.n.r.) Eckard Lomann (Rheinmetall<br />
Landsysteme/RLS), Klaus-Dieter Seip (Rheinmetall W&M), Alois K. Osterwalder (Oerlikon Contraves), Volney F. Warner (US-<br />
Repräsentant der Rheintech Inc./Washington), Eric Prummenbaum, Manfred Eggers, Dr. Josef Jörg und Dr. Bernhard<br />
Halstrup (alle RLS) sowie Allen Buckley (Oerlikon Contraves). Die AUSA 2000 – die „Association United States Army“ ist die<br />
bedeutendste US-Fachmesse für Heerestechnik – zählte rund 27000 Besucher; die Zahl der Aussteller lag bei 600.<br />
HALBZEIT-PERSPEKTIVEN: In einem rund dreiviertelstündigen<br />
Vortrag referierte der Vorsitzende der<br />
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz (r. + 2.v.l.),<br />
am 19. Oktober 2000 auf Einladung des Landesverbandes<br />
Nordrhein-Westfalen des CDU-Wirtschaftsrates im<br />
Kommunikationszentrum der Rheinmetall <strong>AG</strong> in Düsseldorf<br />
zum Thema „Halbzeit für Rot/Grün – Perspektiven der<br />
Union“. In der Mitte der 13. Legislaturperiode zog der<br />
45jährige Sauerländer – er gehört dem Bundestag seit<br />
1994 an – vor mehr als 500 Gästen eine Bilanz der bisherigen<br />
Arbeit von Regierung und Opposition und skizzierte<br />
gleichzeitig die Themenschwerpunkte, mit denen die<br />
CDU/CSU aus seiner Sicht politisch Kurs auf die Bundestagswahl<br />
2002 nehmen solle. Unsere beiden Fotos zeigen<br />
Merz zusammen mit dem Rheinmetall-Vorstandsvorsitzenden<br />
Dipl.-Math. Klaus Eberhardt (l. + 2.v.r.) sowie mit<br />
Dr. Klaus Germann (3.v.l.), stellvertretender Landesvorsitzender<br />
des nordrhein-westfälischen CDU-Wirtschaftsrates<br />
und Generalbevollmächtigter der Rheinmetall <strong>AG</strong>.<br />
Führungsmannschaft der Rheinmetall<br />
DeTec <strong>AG</strong>. Im Vorstand der Gesellschaft<br />
wird Odermatt künftig die operative<br />
Verantwortung für Oerlikon Contraves,<br />
das international führende Unternehmen<br />
von Flugabwehrsystemen,<br />
haben.<br />
Der Vorstand der Rheinmetall DeTec<br />
<strong>AG</strong> besteht vom 1. Januar 2001 an aus:<br />
Dr.-Ing. Ernst-Otto Krämer (Vorsitzender),<br />
Dipl.-Kfm. Ulrich Grillo (stellvertretender<br />
Vorsitzender mit dem Ressort<br />
Finanzen und Controlling sowie<br />
Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der STN Atlas Elektronik GmbH), Mario<br />
Gabrielli (Personal und Arbeitsdirektor),<br />
Dipl.-Ing. Lic. oec. Ernst Odermatt<br />
(Oerlikon Contraves <strong>AG</strong>), Dipl.-Ing.,<br />
Dipl. oec. Detlef Moog (Rheinmetall<br />
W & M GmbH) und Dipl.-Ing. Gert Winkler<br />
(Rheinmetall Landsysteme GmbH).
Seite 8 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Detailvorstellung: Vor hochkarätigem Publikum präsentierten sich die Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong> (Ratingen) und ihre Tochtergesellschaften kürzlich in der polnischen Hauptstadt Warschau und in Bristol (Großbritannien).<br />
Präsentationen der Rheinmetall-DeTec-Gruppe in Polen und Großbritannien vor hochkarätigem Publikum<br />
Zusammenarbeit auf Wehrtechnik-Sektor weiter vorantreiben<br />
ha/rds Warschau/Bristol. Detaillierte<br />
Firmenpräsentation vor hochkarätigem<br />
Fachpublikum: Auf zwei Informationsforen<br />
in Polen und Großbritannien<br />
haben Experten der Rheinmetall-<br />
DeTec-Gruppe kürzlich die unternehmerischen<br />
Rahmenbedingungen und<br />
die system- bzw. produktspezifischen<br />
Aktivitäten des zum Rheinmetall-Konzern<br />
gehörenden „Defence“-Unternehmensbereiches<br />
ausführlich vorgestellt.<br />
Die beiden Veranstaltungen, die<br />
in dieser Form erstmals durchgeführt<br />
wurden, sind im Zusammenhang mit<br />
der zunehmenden Internationalisierung<br />
des Geschäftes und der damit<br />
verknüpften Neuausrichtung der Vertriebs-<br />
und Marketing-Aktivitäten der<br />
Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong> und ihrer Tochterfirmen<br />
zu sehen („Das <strong>Profil</strong>“<br />
2/2000).<br />
Nicht erst seit dem Beitritt Polens zur<br />
Nato und den Verhandlungen zur Erweiterung<br />
der Europäischen Union hat<br />
das mittelost-europäische Land für die<br />
Rheinmetall-DeTec-Gruppe eine hohe<br />
strategische Bedeutung („Das <strong>Profil</strong>“<br />
4/2000). Vor diesem Hintergrund<br />
trafen sich Ende September diesen<br />
Jahres in Warschau Vertreter des polnischen<br />
und des deutschen Verteidigungsministeriums<br />
sowie der Deutschen<br />
Botschaft mit „Defence“-Fachleuten,<br />
um Chancen und konkrete<br />
Möglichkeiten einer zukünftig weiter<br />
vertieften Zusammenarbeit zu erörtern.<br />
Im Mittelpunkt des Meinungsaustausches<br />
unter den 120 Gästen aus Politik,<br />
Wirtschaft, den Streitkräften und<br />
dem Mediensektor standen die derzeitige<br />
sicherheitspolitische Situation<br />
in Polen, die Beziehungen beider Länder<br />
auf politischem wie wehrtechnisch-industriellem<br />
Sektor sowie die<br />
bereits eingeleitete Umgestaltung der<br />
polnischen Rüstungsindustrie; darüber<br />
hinaus wurde ein sehr detaillierter<br />
Einblick in die Unternehmensorganisation,<br />
die Kompetenzfelder sowie<br />
die Produktbereiche der Rheinmetall-<br />
DeTec-Gruppe gegeben.<br />
Prominente Teilnehmer der „Defence“-Präsentation<br />
in der polnischen<br />
Hauptstadt, die von Henning von<br />
Ondarza (Aufsichtsratsmitglied der<br />
Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong> und ehemaliger<br />
Viersterne-General der Bundeswehr)<br />
moderiert wurde, waren u.a. Oberst<br />
Dr. Piotr Zaskórski vom polnischen Generalstab<br />
(in Vertretung des stellvertretenden<br />
Verteidigungsministers Dr.<br />
Romuald Szeremietiev), der Deutsche<br />
Botschafter in Polen, Frank Elbe, sowie<br />
Dr. Horst Peters, Leiter des Referats<br />
„Internationale Rüstungsbeziehungen“<br />
beim Bundesverteidigungsministerium<br />
(BMVg).<br />
Botschafter Elbe: „Polen ist bevölkerungsreichster<br />
und wirtschaftsstärkster<br />
Kandidat für die EU-Erweiterung.<br />
Er ist unser unmittelbarer Nachbar.<br />
Diese Nachbarschaft führt wichtige<br />
Ressourcen zusammen, so daß der<br />
deutsch-polnische Verbund unter Umständen<br />
künftig zur wachstumsstärksten<br />
Region Europas werden könnte.“<br />
Der in der Globalisierung verschärfte<br />
STRATEGISCHER WETTSTREIT: Auch in diesem Jahr führte das Rheinmetall-<br />
Kolleg in Zusammenarbeit mit dem USW Schloß Gracht wieder das strategische<br />
Unternehmensplanspiel „rubikon!“ durch. Führungskräfte aus den kaufmännischen<br />
Bereichen zahlreicher Konzerngesellschaften bildeten insgesamt vier Teams, die als<br />
fiktive Unternehmen am Markt miteinander konkurrieren. Dabei wurden die Fähigkeit<br />
zur strategischen Unternehmensführung und der Umgang mit langfristigen Steuerungs-<br />
und Controllinginstrumenten trainiert. Nach zweieinhalb Veranstaltungstagen<br />
und insgesamt sieben Spielrunden standen die Gewinner fest: Hans Friedrich<br />
(Oerlikon Contraves <strong>AG</strong>/Leiter Finanzabteilung), Norbert Bareiss (KS Kolbenschmidt<br />
GmbH/Leiter Controlling), Thomas Bartels ( Pierburg <strong>AG</strong>/Werkcontroller) und Bernhard<br />
Semling (Heimann Systems GmbH/Leiter Produktmarketing). Unsere beiden<br />
Fotos zeigen die vier siegreichen „rubikon!“-Unternehmer ( Bild links – v.l.n.r.) bei<br />
der Arbeit sowie nach der Verleihung der Rheinmetall-Steele (Bild rechts) durch<br />
Harald Ehrlich (M.), Hauptabteilungsleiter Zentralbereich Personal bei der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong> und verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung im Konzern.<br />
Wettbewerb, so Elbe weiter, verlange<br />
nach einem neuen kooperativen Ansatz:<br />
„Durch eine Bündelung von Ressourcen,<br />
durch strategische Allianzen<br />
und durch die Optimierung synergetischer<br />
Effekte ist unser Leistungspotentialerheblich<br />
zu steigern... Diesgilt<br />
auch für den Bereich der Sicherheitspolitik“.<br />
BMVg-Experte Peters hob „die<br />
bisherige gute und nachbarschaftliche<br />
Zusammenarbeit auf militärpolitischer<br />
und militärischer Ebene“ hervor: „Beiderseits<br />
besteht Interesse an der Fortsetzung<br />
und Weiterentwicklung dieser<br />
Zusammenarbeit“.<br />
Nicht minder informativ und effizient<br />
verlief eine zeitgleiche „Defence“-Veranstaltung<br />
in Bristol, an der u.a. Vertreter<br />
der „Defence Procurement Agency“<br />
(DPA – britische Beschaffungsbehörde)<br />
und der DERA (verantwortliche Institution<br />
für Forschung und Entwicklung auf<br />
dem Wehrtechnik-Sektor) teilnahmen.<br />
Norbert Frank, Vice President Marketing<br />
& Sales bei der Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong>:<br />
„Wir haben vor allem die verantwortli-<br />
chen Projektleiter der – für unser Unternehmen<br />
wichtigen – Beschaffungsvorhaben<br />
mit Informationen über unser<br />
Unternehmen und seine Leistungs- und<br />
Produktpalette versorgt. Dabei wurden<br />
bereits auch konkrete Gespräche zu<br />
einzelnen Projekten geführt und ein<br />
weiterer Informationsaustausch vereinbart.<br />
Der britische Markt wird von uns<br />
als einer der internationalen Schlüsselmärkte<br />
betrachtet.“<br />
Auch die Gäste zeigten sich hochzufrieden.<br />
Stellvertretend DPA-Geschäftsführer<br />
General Major Peter Gilchrist: „Eine<br />
außerordentlich nützliche Veranstaltung.<br />
Wir haben jetzt einen viel besseren<br />
Einblick in die Struktur und das Wesen<br />
der Rheinmetall-DeTec-Gruppe.“<br />
Norbert Pippberger, wehrtechnischer<br />
Attachée der Deutschen Botschaft in<br />
London, ergänzt: „Die Präsentationen<br />
wurden von DPA und DERA mit großem<br />
Interesse aufgenommen. Die Chancen<br />
für den Einstieg (von Rheinmetall-“Defence“)<br />
bei Simulation, Sensoren, Drohnen,<br />
aber auch bei Munition, sind gut.“
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Seite 9<br />
Aditron-Gruppe auf der „electronica 2000“<br />
Gemeinsame Plattform<br />
für weltweite Märkte<br />
cd/tho/rds München. Mit Rekordzahlen<br />
unterstrich die „electronica<br />
2000“ (21. bis 24. November) erneut<br />
ihre Position als Weltleitmesse der<br />
Elektronikbranche: Auf der „19. Internationalen<br />
Fachmesse für Bauelemente<br />
und Baugruppen der Elektronik“<br />
in München stellten insgesamt<br />
3050 Aussteller und 566 zusätzlich<br />
vertretene Firmen auf rund 160 000<br />
Quadratmetern Fläche aus (1998:<br />
2836 und 630). Über die Hälfte der<br />
Aussteller kam aus dem Ausland (54<br />
Prozent). Rund 88 000 Fachbesucher<br />
(1998: 84 713) zählten die Organisatoren,<br />
davon allein 24 000 aus 73 Ländern<br />
– ein Beleg für die hohe Internationalität<br />
dieser Branchenschau in der<br />
Isar-Metropole.<br />
Aussteller wie Fachbesucher waren<br />
mit dem Verlauf der Messe hoch zufrieden:<br />
98 Prozent der Aussteller bewerteten<br />
ihre Messebeteiligung positiv,<br />
87 Prozent mit „ausgezeichnet bis<br />
gut“. Die Aussteller lobten einhellig<br />
die Internationalität sowie die hohe<br />
Qualität der Messebesucher und zeig-<br />
ten sich mit der Frequenz am Messestand<br />
sehr zufrieden. Von den Besuchern<br />
erhielt die „electronica 2000“<br />
sogar von 93 Prozent die Note „ausgezeichnet<br />
bis gut“.<br />
Unter den Unternehmen, die das<br />
Münchner Fachforum als international<br />
frequentierte Plattform für Neuheiten<br />
und Neuerungen nutzten, war auch<br />
die Aditron-Gruppe.<br />
Die Hirschmann<br />
Electronics<br />
GmbH & Co. KG,<br />
die Preh-Werke<br />
GmbH & Co. KG<br />
und die EBT<br />
Optronic GmbH & Co. KG präsentierten<br />
ihre Produktinnovationen in München<br />
erstmals auf einem gemeinsamen<br />
Messestand in Halle 5. Das ausgestellte<br />
Erzeugnisprogramm umfaßte Produkte<br />
und Systemlösungen aus den<br />
Bereichen Automatisierungs- und<br />
Netzwerksysteme (Hirschmann Electronics),<br />
Automobil- und Industrieelektronik<br />
(Preh-Werke) sowie optronische<br />
Bauelemente (EBT).<br />
Hirschmann Electronics setzte den<br />
Schwerpunkt auf die Schnellanschluß-<br />
technik für Steckverbinder und Systemkomponenten<br />
für die Industrieautomation.<br />
Die Preh-Werke zeigten Innovationen<br />
auf dem Gebiet der „Touchscreens“<br />
und „Point-Of-Sale“-Personalcomputer<br />
sowie Neuentwicklungen aus<br />
dem Bereich der Heizungs-/Klimabediensysteme<br />
und Fahrerassistenzsysteme.<br />
EBT Optronic präsentierte neue<br />
Leuchtmittel für Anzeige- und Meldesysteme,<br />
insbesondere Leuchtdioden<br />
(LED).<br />
Zur Messebilanz der Preh-Werke: Alle<br />
namhaften Automobilhersteller und<br />
–zulieferer (z.B. Audi, BMW, Daimler-<br />
Chrysler, VW, Bosch und Siemens) informierten<br />
sich über die Innovationen<br />
aus Bad Neustadt. „Die Präsenz unseres<br />
Unternehmens auf dem Gemeinschaftsstand<br />
der Aditron <strong>AG</strong> war für die<br />
Produktbereiche Automobilelektronik<br />
und Industrieelektronik ein großer Erfolg“,<br />
erklärte Rüdiger Maidhof, Mitglied<br />
der Geschäftsführung. Aufgrund<br />
der positiven Messebilanz wird Preh<br />
auch auf der „electronica 2002“ (12. bis<br />
15. November) wieder vertreten sein.<br />
„electronica“-Visite mit Tradition: Der Präsident des Bayerischen Landtages,<br />
Johann Böhm (2.v.r.), und seine Ehefrau Elke zeigten sich beeindruckt von den<br />
Heizungs-/Klimabediensystemen der Preh-Werke für BMW und Audi. Auf der<br />
Münchner Fachmesse informierten der Vorsitzende der Preh-Geschäftsführung,<br />
Dr. Michael Roesnick (2.v.l.), und Geschäftsführer Rüdiger Maidhof (r.) über die<br />
neuesten Produktinnovationen aus dem unterfränkischen Bad Neustadt a. d. Saale.<br />
Was das Ausstellungsprogramm anbelangt,<br />
so wurde zum Beispiel das<br />
vollelektronische Preh-Bediensystem<br />
zur Klimatisierung des Fahrgastraums<br />
für den BMW-Roadster Z8 der Öffentlichkeit<br />
vorgestellt („Das <strong>Profil</strong>“<br />
3/2000). Aufbauend auf der langjährigen<br />
Kompetenz in der Entwicklung<br />
und Herstellung von Heizungs-/Klimabediensystemen<br />
hat Preh mit diesem<br />
Produkt den Sprung in das prestigeträchtigeSportwagen-Premiumsegment<br />
geschafft.<br />
Neues gab es auch aus dem Bereich<br />
der Industrieelektronik: Hier haben<br />
die Preh-Werke ihr Produktportfolio<br />
um einen weiteren leistungsstarken<br />
Kassen-PC, den „Flat POS 2000“, ergänzt.<br />
Dieser kompakte PC ist aufgrund<br />
seiner geringen Abmessungen<br />
für individuelle Kundenlösungen direkt<br />
am „Point of Sale“ ideal geeignet.<br />
„Einfach schneller Anschluß gewinnen“<br />
– unter diesem Motto präsentierte<br />
die Hirschmann Electronics GmbH &<br />
Co. KG ein umfassendes Produktprogramm<br />
für die industrielle Automatisierung.<br />
Zu den Produkt-Neuheiten,<br />
die das Unternehmen auf der Münch-<br />
Olaf Zbikowski (l.), Produktmanager Aktorik- und Sensoriksteckverbinder der<br />
Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, erläutert einem japanischen Messebesucher<br />
das neue „BusQuick“-Schnellanschlußsystem für industrielle Datennetze.<br />
Dialog unter Fachleuten (v.l.n.r.): Nicola Digiovinazza und Horst Eisenmann – Vertriebsbeauftragte der Preh-Industrietechnik<br />
– im Gespräch mit Nikolaos Asteriadis, Distributeur in Griechenland. Das abgebildete kompakte Kassensystem –<br />
es besteht aus 12,1‘-TFT-LC-Display, Kompakt-PC „Flat POS 2000“, MF-Tastatur MF 112C, Teleskop-Stativ, Systemträger,<br />
Drucker und Kundendisplay – entspricht dem an die schwedische Systembolaget AB gelieferten Systemkonzept.<br />
ner Messe vorstellte, gehörte etwa der<br />
weltweit erste geschirmte M12-Steckverbinder<br />
mit Schnellanschlußtechnik,<br />
über den sich Maschinen ohne<br />
umständliches Löten oder Schrauben<br />
an das Fabrik-Datennetz anschließen<br />
lassen. Auch die neuen Miniatur-Koppelmodule<br />
für den Übertragungsstandard<br />
„DeviceNet“ sowie das ebenfalls<br />
neue Verbindungssystem für „Profibus<br />
DP“ aus der „BusQuick“-Familie von<br />
Hirschmann können nach dem „Plugand-Play“-Prinzip<br />
installiert werden.<br />
Das spart Zeit und senkt somit die Kosten<br />
für die Inbetriebnahme. Beide Systeme<br />
sind staub-, schmutz- und wasserdicht,<br />
was sie zur ersten Wahl für<br />
den sicheren Einsatz im rauhen industriellen<br />
Umfeld macht, wo unter anderem<br />
Öle, Reinigungsmittel und<br />
Emulsionen Bestandteile der Umgebungsluft<br />
sind.<br />
„Die ‚electronica‘ gehört für uns zu<br />
den bedeutendsten Messen“, erklärt<br />
Wolfgang Schenk, Vertriebsleiter Zentraleuropa<br />
der Hirschmann-Division<br />
„Automation and Network Solutions“.<br />
Sein Messefazit fällt insgesamt positiv<br />
aus: „Alle wichtigen Vertriebspartner<br />
(Fortsetzung von Seite 1)<br />
Verstärkung für den zunehmend härteren<br />
internationalen Wettbewerb wünschen.<br />
Deshalb wollen wir konkret etwas<br />
für die Förderung junger, engagierter<br />
Menschen tun.“ Selbstredend<br />
verfolge man, so der Konzernchef weiter,<br />
natürlich auch das „legitime Ziel,<br />
junge Leute für das Unternehmen<br />
Rheinmetall zu begeistern“.<br />
Ausdrücklich begrüßt wurde das zukunftsgerichtete<br />
Förderprojekt vom<br />
Düsseldorfer Regierungspräsidenten<br />
Jürgen Büssow, der auch die Stiftungsurkunde<br />
überreichte: „Sie haben richtig<br />
erkannt, daß dem Mangel an qualifiziertem<br />
Nachwuchs dadurch begegnet<br />
werden kann, daß befähigten Studierenden<br />
der Anschluß an die Wissensgesellschaft<br />
von morgen erleichtert<br />
wird . . . Als Regierungspräsident<br />
weiß ich sehr wohl, daß Stiftungen in<br />
hervorragender Weise dazu beitragen,<br />
Lücken zu füllen, die weder vom Staat<br />
noch von der Wirtschaft ausgefüllt<br />
werden bzw. ausgefüllt werden können.<br />
Ich sehe, daß sich im Stiftungswesen<br />
ein ganz wesentlicher Baustein<br />
des sog. ‚3. Sektors‘ zwischen Markt<br />
und Staat entwickelt und wünsche mir,<br />
daß die Stiftungen ihre politische und<br />
finanzielle Unabhängigkeit dazu nutzen,<br />
ein eigenständiges Kraftfeld zu<br />
entwickeln, das wir in unserer Gesellschaft<br />
benötigen und das weiterhin<br />
verstärkt werden muß.“<br />
sind unserer Einladung zum Standbesuch<br />
gefolgt. Auch die Kundengespräche<br />
verliefen sehr vielversprechend.“<br />
Zufrieden über den Messeauftritt<br />
zeigte sich auch die EBT Optronic<br />
GmbH & Co. KG in Bad Dürkheim. Das<br />
Unternehmen, dessen 195 Mitarbeiter<br />
in diesem Jahr voraussichtlich rund 26<br />
Millionen € Umsatz (199: 21,8 Mio €)<br />
erzielen werden, präsentierte Signalleuchten<br />
und gesockelteLeuchtmittel<br />
auf LED-Basis,<br />
darunter eine neuentwickelte<br />
LED-<br />
Leuchte für Warnleuchtsäulen,sowie<br />
LED- und Display-Systeme.Ausgehend<br />
von der<br />
guten Resonanz<br />
des Messepublikums<br />
– immerhin<br />
gab es rund<br />
500 dokumentierte<br />
Die Förderung ist<br />
zweckgebunden<br />
che Automobilzulieferer bzw. Repräsentanten<br />
staatlicher Einrichtungen<br />
(z.B. Bahn) –, wird mit entsprechend<br />
positiven Auswirkungen auf das Nachmessegeschäft<br />
gerechnet. EBT-Geschäftsführer<br />
Stefan Oestreicher:<br />
„Äußerst positiv aufgenommen wurde<br />
auch unser neues EBT1plus-Konzept.“<br />
Dahinter verbirgt sich ein hochmodernes<br />
Distributionssystem für Produkte<br />
der Signaltechnik.<br />
Gespräche mit<br />
Fachbesuchern, „BusQuick“ von Hirschmann Electronics: Schnellanschluß-<br />
darunter auch etli- technik für den Einsatz im rauhen industriellen Umfeld.<br />
Rheinmetall <strong>AG</strong> gründete gemeinnützige Stiftung<br />
Nachwuchs wird gezielt gefördert<br />
Im Mittelpunkt der Stiftungsinitiative<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong> stehen<br />
Stipendien für herausragende<br />
Diplomarbeiten. Hierzu schreibt die<br />
Stiftung einmal jährlich ein Themenfeld<br />
aus, das in den eingereichten Arbeiten<br />
behandelt werden soll. Über<br />
die Vergabe der Fördermittel entscheidet<br />
ein wissenschaftliches Kuratorium,<br />
das aus vier namhaften<br />
Hochschulprofessoren zusammengesetzt<br />
ist. Die Rheinmetall-Stiftung<br />
Die Stipendien der Rheinmetall-<br />
Stiftung – bis zu acht pro Jahr, Start<br />
ist im Sommer 2001 – sollen neue<br />
Perspektiven eröffnen und die Preisträger<br />
bei der Verbesserung ihrer<br />
Qualifikation unterstützen. Deshalb<br />
werden die Prämien ausschließlich<br />
zweckgebunden für Qualifizierungsmaßnahmen<br />
auf kaufmännischem<br />
oder technischem Gebiet gewährt.<br />
Beispiele hierfür sind die Teilnahme<br />
an Praktikantenprogrammen im Ausland,<br />
an internationalen Studienund<br />
Austauschprogrammen oder an<br />
Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen<br />
(z.B. „Summer Schools“).<br />
Das Stipendium kann darüber hin-<br />
wird von einem fünfköpfigen Stifaus auch für die Teilnahme an<br />
tungsvorstand verwaltet, der unter wissenschaftlichen Veranstaltungen<br />
der Aufsicht eines Stiftungsrates eingesetzt werden, die dem Zweck<br />
steht.<br />
der Stiftung dienen. dp<br />
Mit der Initiative habe sich Rheinmetall,<br />
so der Regierungspräsident weiter,<br />
im übrigen in eine jahrhundertealte<br />
Stiftertradition eingereiht. Zur Erinnerung:<br />
Die älteste, noch bestehende<br />
Stiftung im Regierungsbezirk Düsseldorf<br />
ist die 1364 gegründete Gasthausstiftung<br />
mit Sitz in Emmerich; die<br />
Namen zahlreicher bedeutender<br />
Stiftungen im Regierungsbezirk Düsseldorf<br />
sind mit den Namen großer<br />
Unternehmerpersönlichkeiten und<br />
Unternehmen wie Haniel, Klöckner,<br />
Krupp und Thyssen verbunden. Büssow,<br />
der auch auf die im vergangenen<br />
Sommer vom Deutschen Bundestag<br />
grundsätzlich verbesserten gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen für Stiftungen<br />
(hier: Reform des Stiftungssteuerrechts)<br />
hinwies: „Im Regierungsbezirk<br />
Düsseldorf gibt es derzeit<br />
520 selbständige Stiftungen; etwa ein<br />
Drittel davon wurden in den letzten<br />
zehn Jahren gegründet.“ In Nordrhein-<br />
Westfalen beläuft sich die Zahl auf<br />
rund 1600.
Seite 10 Wirtschaft/Messen/Märkte<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Rheinmetall auf 12. Deutschen Absolventen-Kongreß<br />
Viele Perspektiven<br />
für Berufseinsteiger<br />
sm Köln. Perspektiven: Die Teilnahme<br />
des Rheinmetall-Konzerns am 12.<br />
Deutschen Absolventen-Kongreß (22.<br />
und 23. November 2000) war für alle<br />
Beteiligten ein voller Erfolg. Rund 600<br />
junge Nachwuchskräfte besuchten die<br />
Rheinmetall-Präsentation in den Kölner<br />
Messehallen und nutzten die Gelegenheit,<br />
sich umfassend über das Unternehmen<br />
und die verschiedenen beruflichen<br />
Einstiegsmöglichkeiten in<br />
den Firmen der Unternehmensgruppe<br />
zu informieren.<br />
Rheinmetall präsentierte sich mit<br />
den drei Unternehmensbereichen<br />
„Automotive“, „Electronics“ und<br />
„Defence“, wobei Führungskräfte der<br />
Konzernholding und der jeweiligen<br />
Sparten den Hochschulabsolventen<br />
Rede und Antwort standen. Generelle<br />
Informationen und die heiß begehrte<br />
Hochschulmarketing-Broschüre<br />
„Rheinmetall – Ihre neue Perspektive“<br />
konnten die interessierten Kongreßbesucher<br />
vorab an der<br />
Infotheke des Messestandes<br />
erhalten.<br />
Die offene Gestaltung<br />
des informativ<br />
konzipierten Standes<br />
entsprach dem<br />
Wunsch des Unternehmens<br />
nach intensiverKommunikation<br />
mit potentiellen<br />
Bewerbern.<br />
„Wir konnten viele<br />
qualifizierte Nachwuchskräfte<br />
auf<br />
uns aufmerksam<br />
machen; mit rund<br />
250 Absolventen<br />
ergaben sich auch ausführlichere Gespräche“,<br />
berichtet Petra Gerlach –<br />
Personalreferentin bei der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong> und verantwortlich für die Gesamtkoordination<br />
des Messeauftritts<br />
– über die gute Resonanz. „Zur weiteren<br />
Kontaktaufnahme haben wir in<br />
Begleitprotokollen zu den Gesprächen<br />
die wesentlichen Daten<br />
ba Düsseldorf. Kompetentes Management<br />
steht auf mehreren Pfeilern –<br />
einer davon ist die persönliche Weiterbildung.<br />
Das Rheinmetall-Kolleg<br />
als interne Managementakademie<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong> bietet ihren Fachund<br />
Führungskräften – egal, ob als<br />
„young professional“ oder „alter<br />
Hase“ – in diesem Zusammenhang<br />
hervorragende Möglichkeiten. Das<br />
differenzierte Kolleg-Angebot transferiert<br />
Wissen in Nutzen und gibt<br />
Unterstützung bei der effizienten<br />
Lösung der Managementaufgaben<br />
und der Optimierung der Arbeitsresultate.<br />
Als Kompetenz-Center „Weiterbil-<br />
und Fakten der interessierten Berufseinsteiger<br />
registriert“, fährt sie mit<br />
Blick auf die Aufgaben der nächsten<br />
Wochen fort.<br />
„Während der beiden Messetage<br />
waren kontinuierlich 14 Personen am<br />
Stand präsent. Zu unserem Team zählten<br />
Leiter aus den Personalbereichen<br />
der verschiedenen Rheinmetall-Unternehmen<br />
und der Konzernholding, Vertreter<br />
aus den jeweiligen Unternehmensbereichen<br />
sowie Teilnehmer des<br />
Rheinmetall-Nachwuchsprogramms,<br />
die sich um die Fragen und Belange<br />
der jungen ‚High Potentials‘ kümmerten“,<br />
so Jörg Müller, Leiter Zentralbereich<br />
Personal bei der Hirschmann<br />
Electronics GmbH & Co. KG, über das<br />
große Engagement der beteiligten<br />
Rheinmetall-Mitarbeiter. „Diese Zusammensetzung<br />
gewährleistete die<br />
optimale Befriedigung des hohen Informationsbedarfs<br />
von seiten der Kongreßbesucher“,<br />
ergänzt Gerlach.<br />
Jochen Woyczek (l.), Ex-Trainee und inzwischen Assistent der<br />
Geschäftsführung bei der Preh-Werke GmbH & Co. KG, stellt<br />
die vielfältigen Berufschancen bei Rheinmetall vor.<br />
Am ersten Messetag fand – als Podiumsdiskussion<br />
– eine Unternehmenspräsentation<br />
des Rheinmetall-Konzerns<br />
statt. „Diese Art der Vorstellung<br />
kam bei den Kongreßbesuchern gut an<br />
und förderte das Image des Unternehmens<br />
als innovativer Arbeitgeber“, berichtet<br />
Gerlach über das Rahmenprogramm<br />
der zweitägigen Veranstaltung.<br />
dung“ hat das Rheinmetall-Kolleg<br />
sein Programm für das kommende<br />
Geschäftsjahr 2001 weiter optimiert.<br />
Das Seminarangebot bietet den Fachund<br />
Führungskräften im Konzern jetzt<br />
folgende Leistungen an:<br />
★ Im Bereich Training, der Veranstaltungen<br />
auf den Fachgebieten „Strategische<br />
Unternehmensführung“,<br />
„Führungskompetenz“, „Methodenkompetenz“,<br />
„Internationalisierung“<br />
und „Fachkompetenz“ umfaßt, ist<br />
das Angebot erweitert worden. Neu<br />
in 2001 sind u. a. die Veranstaltungen<br />
„Unternehmenssteuerung mit<br />
Kennzahlen“, „Teams führen“, „Moderations-Workshop<br />
für Profis“ so-<br />
Immer gut frequentiert: Der Messestand der Rheinmetall <strong>AG</strong> auf dem 12. Deutschen Absolventen-Kongreß in Köln.<br />
„Eine weitere Attraktion unseres Standes<br />
war das Gewinnspiel mit einer<br />
hochmodernen ‚Wrist-Cam‘ (Armbanduhr<br />
mit integrierter Digitalkamera)<br />
als Hauptpreis. Es ging darum, auf<br />
einem Röntgenbild eines detektierten<br />
Koffers die versteckten ‚gefährlichen‘<br />
Objekte zu erkennen“, schildert die<br />
32-jährige Personalreferentin kurz die<br />
Aufgabenstellung. „Zahlreiche Besucher<br />
versuchten ihr Glück; gleichzeitig<br />
konnten wir anhand des eingesetzten<br />
Handgepäck-Röntgenprüfgerätes von<br />
Heimann Systems eine der vielen<br />
Sparten des Konzerns plastisch darstellen“.<br />
Der Absolventen-Kongreß in Köln ist<br />
längst eine feste Institution zur Rekrutierung<br />
von hochmotivierten Fach- und<br />
Führungsnachwuchskräften geworden.<br />
„Die Qualifikation und das Engagement<br />
der Bewerber insgesamt wurden<br />
von allen Anwesenden als sehr hoch<br />
eingestuft. Von rund 120 Absolventen<br />
erhielten wir bereits vollständige Bewerbungsunterlagen“,<br />
zieht Dr. Wolfgang<br />
G. Glaubitz, Generalbevollmächtigter<br />
und Leiter des Zentralbereichs<br />
Personal der Rheinmetall <strong>AG</strong>, positive<br />
Bilanz. „Mit rund 20 der jungen Berufseinsteiger<br />
wurden bereits direkt<br />
am Stand konkrete Verhandlungen<br />
über einen möglichen Einstieg in den<br />
Engagiertes Rheinmetall-Team: Rund 600 junge Nachwuchskräfte informierten sich während der beiden Messetage in Köln über die vielfältigen Berufschancen innerhalb des Düsseldorfer Konzerns. Sie<br />
wurden kompetent beraten unter anderem von Petra Gerlach (l.) , Personalreferentin bei der Rheinmetall <strong>AG</strong> und verantwortlich für das Hochschul-Marketing, Dr. Gerd Gottwald (3. v. r.), Entwicklungsleiter<br />
im Produktbereich „MKT“ bei der Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, sowie Werner Wegat (r.), Leiter der Hauptabteilung Personal/Verwaltung bei der Rheinmetall W&M GmbH.<br />
Rheinmetall-Kolleg 2001<br />
Hauptaugenmerk liegt auf dem Management-Training<br />
wie „Praxisorientiertes Verhaltenstraining<br />
für das Lateinamerika-Geschäft<br />
(Schwerpunkt Brasilien)“.<br />
Weitere aktuelle Themen werden aufgegriffen<br />
bzw. vertieft.<br />
Allen Veranstaltungen gemeinsam<br />
ist der konsequente Zuschnitt auf die<br />
Bedürfnisse von Fach- und Führungskräften.<br />
Hochqualifizierte Trainer arbeiten<br />
– wo immer möglich – mit den<br />
Teilnehmern an eigenen arbeitsbezogenen<br />
Projekten und ermöglichen so<br />
durch stark praxisbezogenes Arbeiten<br />
den optimalen Wissenstransfer in das<br />
persönliche Arbeitsumfeld.<br />
★ Die seit 1999 offerierte und sehr gut<br />
besuchte Foren-Veranstaltungsreihe<br />
Konzern geführt“, so Glaubitz weiter.<br />
Der Veranstalter selbst, die Forum<br />
Verlag GmbH aus Konstanz, bestätigt<br />
den rundum positiven Eindruck der<br />
Veranstaltung: „Mit etwa 11 000 Kongreßbesuchern<br />
und 453 ausstellenden<br />
RIS-Fachmann Thomas Breuer (r.) erläutert<br />
den Internet-Auftritt des Rheinmetall-Konzerns.<br />
Unternehmen bleibt der Deutsche Absolventen-Kongreß<br />
die erste Adresse,<br />
wenn es um den beruflichen Einstieg<br />
von qualifizierten Nachwuchskräften<br />
geht“, so der Verlag. „In diesem Jahr<br />
brachten die Unternehmen 48 000 offene<br />
Stellen mit, wobei das Spektrum<br />
von Forschung und Entwicklung über<br />
Marketing bis hin zur Öffentlichkeits-<br />
dient dem firmenübergreifenden Erfahrungsaustausch<br />
zu aktuellen Themen<br />
und Fragestellungen im Konzern.<br />
Themen in 2001 sind „Außenhandelsund<br />
Projektfinanzierung“ sowie „Verbesserungsprozesse<br />
in der betrieblichen<br />
Praxis“. Während dieser Veranstaltungen<br />
bietet sich die Möglichkeit,<br />
erprobte Lösungsansätze und Verfahren<br />
im Konzern kennenzulernen, Kontakte<br />
zu Führungskräften in ähnlichen<br />
Verantwortungsbereichen zu knüpfen<br />
und so am „best practice“ zu partizipieren.<br />
Die Programmbroschüre 2001 des<br />
Rheinmetall-Kollegs wird in diesen Tagen<br />
veröffentlicht und von Anfang<br />
arbeit reichte.“ Aufgrund der gestiegenen<br />
Besucherzahlen wird der Kongreß<br />
von 2001 an sogar zweimal jährlich<br />
stattfinden – eine Entwicklung, die<br />
auch auf den ausdrücklichen Wunsch<br />
vieler der ausstellenden Unternehmen<br />
zurückzuführen ist.<br />
Rheinmetall nutzte das Forum, um<br />
die Vielfalt der Einstiegs- und Karriereangebote<br />
zu präsentieren. Darüber<br />
hinaus knüpfte man erste Kontakte<br />
mit geeigneten Bewerbern. „Der Bekanntheitsgrad<br />
des Konzerns unter<br />
den ‚Young Professionals‘ ist erheblich<br />
gestiegen, gleichzeitig konnten wir positive<br />
Imagepflege betreiben“, äußert<br />
sich Petra Gerlach zufrieden über die<br />
beiden Tage in Köln.<br />
„Der Deutsche Absolventen-Kongreß<br />
sollte auf jeden Fall fester Bestandteil<br />
im Rahmen unseres Hochschulmarketings<br />
werden“, faßt Glaubitz abschließend<br />
zusammen. „Nur durch regelmäßige<br />
Präsenz können wir potentiellen<br />
Bewerbern den Eindruck von<br />
Kontinuität und Nachhaltigkeit vermitteln.<br />
Darüber hinaus kann sich Rheinmetall<br />
als innovatives Unternehmen<br />
mit vielfältigen Perspektiven für<br />
Berufseinsteiger im Stellenmarkt für<br />
Fach- und Führungsnachwuchskräfte<br />
etablieren“, stellt er mit Blick auf den<br />
nächsten Kongreß fest.<br />
kommenden Jahres an in den jeweiligen<br />
Personalabteilungen vorliegen.<br />
Informationen zu den einzelnen Kolleg-Veranstaltungen<br />
können interessierte<br />
Konzern-Mitarbeiter zudem unter<br />
der entsprechenen Kachel im „Lotus<br />
Notes“-System abrufen. Darüber<br />
hinaus stehen Wolfgang Baer und<br />
Uwe Stichert vom Zentralbereich Personal<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong> im Bedarfsfall<br />
auch persönlich Rede und Antwort.<br />
Der Kontakt: Wolfgang Baer (Tel.<br />
0211/473-4303) und Uwe Stichert (Tel.<br />
0211/473-4003), Fax: 0211/473-4343,<br />
e-mail: wolfgang.baer@rheinmetallag.com<br />
bzw. uwe.stichert@rheinmetall-ag.com.
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Das aktuelle Thema<br />
Seite 11<br />
STN Atlas: Mit „W2S“ zurück zur alten Ertragskraft<br />
„Hier wird alles auf<br />
den Prüfstand gestellt“<br />
Knallig blaue Figuren begegnen einem bei der STN Atlas Elektronik GmbH<br />
derzeit auf Schritt und Tritt, am Mast weht eine Flagge, die zu keiner Nation<br />
gehört; bunte Plakate an den Infoständern und Newsletter für alle Mitarbeiter<br />
auf den Schreibtischen. In dem Unternehmen mit seinen Standorten Bremen<br />
(Firmensitz) und Wedel bewegt sich sichtbar etwas. Und die Bewegung hat einen<br />
Namen: „W2S – Way to Success“. Das klingt simpel, aber einfach ist es wirklich<br />
nur auf den ersten Blick. Denn „W2S“ steht für ein sehr umfassendes Ergebnisverbesserungsprogramm,<br />
mit dem die Mitarbeiter ihr Unternehmen wieder zu<br />
alter Ertragskraft führen wollen. Im nachfolgenden „<strong>Profil</strong>“-Beitrag stellt Peter<br />
Rücker (38), bei STN Atlas Elektronik als Leiter Kommunikation tätig und im<br />
„W2S“-Rahmen verantwortlich für die Projektkommunikation, Hintergründe,<br />
Aktivitäten und Ziele des flächendeckend angelegten Großprojektes vor.<br />
Bremen/Wedel. „Wir stellen alles<br />
auf den Prüfstand und fegen in jeder<br />
Ecke“, bringt es der Vorsitzende der<br />
STN-Atlas-Geschäftsführung Ulrich<br />
Grillo auf den Punkt. Und er fügt hinzu:<br />
„Aber wir legen Wert darauf, daß nicht<br />
pausenlos analysiert wird, also nicht<br />
nach dem Motto: Analyse, Dialyse,<br />
Paralyse, sondern es ist wichtig, daß<br />
wir die notwendigen Verbesserungen<br />
schnell umsetzen.“ Grillo vergleicht<br />
das „W2S“-Vorhaben gerne mit der<br />
„Tour de France“: „Die Bergwertung<br />
liegt noch vor uns. Eine Bergwertung<br />
erfordert viel Arbeit, viel Schweiß und<br />
Durchhaltevermögen. Die Umsetzung<br />
des ,W2S‘-Konzeptes ist wie eine Bergwertung.<br />
Wir müssen noch viel tun, um<br />
den Gipfel zu erreichen, um Höhenluft<br />
zu schnuppern. Wir müssen verdammt<br />
kräftig in die Pedale treten“, bekundete<br />
der Vorsitzende<br />
der Geschäftsführung<br />
zuletzt auf<br />
einer Betriebsversammlung<br />
vor<br />
rund 1800 Mitarbeitern.<br />
Grillo weiter:<br />
„Wie im Sport<br />
sind wir gerne bereit,<br />
die Nachzügler<br />
bei der Bergwertung<br />
zu trainieren,<br />
zu beschleunigen, damit sie mithalten<br />
können. Aber für Kollegen, die<br />
trotz Training die Bergwertung nicht<br />
verkraften, müssen wir eine andere<br />
Sportart suchen.“<br />
Das Tempo führt zu teilweise hohen<br />
Belastungen bei allen, die unmittelbar<br />
mit „W2S“ befaßt sind: Rund 150 sind<br />
es mittlerweile; sie arbeiten in 16 verschiedenen<br />
„Task-Forces“ und in mehreren<br />
Arbeitsgruppen, die sich alle-<br />
samt meistens einmal in der Woche<br />
treffen.<br />
Die Themen der einzelnen „Task-Forces“<br />
lassen die Spannbreite erkennen,<br />
mit der das Unternehmen im<br />
„W2S“-Projekt zu Werke geht: Von der<br />
Vision und der Unternehmensstrategie<br />
über die Produktstruktur, den Entwicklungs-<br />
und den Vertriebsprozeß<br />
bis hin zur Überarbeitung der Organisationsstruktur<br />
reicht die Palette. Abgerundet<br />
wird das alles durch die systematische<br />
Überprüfung der unterstützenden<br />
Prozesse und durch die<br />
Einführung von Wissensmanagement<br />
(siehe Grafik). „Wir haben erkannt,<br />
daß es nicht ausreicht, nur an einzelnen<br />
Stellen zu optimieren, und uns für<br />
einen ganzheitlichen Ansatz entschieden“,<br />
erläutert Arbeitsdirektor Georg<br />
Morawitz, der seitens der Geschäfts-<br />
führung von STN Atlas das Projekt aus<br />
der Taufe gehoben hat und federführend<br />
begleitet, die Überlegung, die<br />
am Anfang von „W2S“ stand.<br />
Ehe das Programm im Frühjahr diesen<br />
Jahres gestartet wurde, gab es –<br />
begleitet durch externe Berater – ein<br />
„Review“, das sich auf zahlreiche Experten-Interviews<br />
im Unternehmen<br />
stützte. Spätestens danach war klar:<br />
Es gibt ein beträchtliches Potential für<br />
Strategie<br />
Leitbild<br />
Produkt/Markt-<br />
Strategie<br />
Marketing/Vertriebs-Strategie<br />
Optimale<br />
Wertschöpfung<br />
Produkt<br />
Produktstruktur<br />
Value-<br />
Engineering<br />
Datenbasis und<br />
Systeme<br />
eine Ergebnisverbesserung bei der<br />
STN Atlas Elektronik GmbH – ein Potential,<br />
das auf über 40 Millionen €<br />
beziffert wird. Nach einem verlustreichen<br />
Geschäftsjahr 1999 sei man jetzt<br />
mit aller Entschlossenheit angetreten,<br />
um dieses Potential Stück für Stück zu<br />
heben, sagt Georg Morawitz.<br />
Daß dies kein Zuckerschlecken würde,<br />
war jedem einsichtig. Denn den<br />
klassischen Sanierungsweg über<br />
Kostensenkungen<br />
beim Personal<br />
oder beim Materialeinkauf<br />
– den wollte<br />
keiner gehen. Er<br />
hätte auch nicht<br />
weit geführt. Angesichts<br />
voller Auftragsbücher<br />
und<br />
mehrerer Personalabbaumaßnahmen<br />
seit Mitte der<br />
neunziger Jahre war an eine weitere<br />
Reduzierung der Belegschaft nicht zu<br />
denken. Und auf der Materialseite<br />
läuft bei STN Atlas schon seit Anfang<br />
1999 – sehr erfolgreich – ein Programm<br />
„World Class Einkaufsmanagement“,<br />
das bis heute Einsparungen<br />
von knapp zehn Millionen € eingefahren<br />
hat und das bis Ende 2003 weitere<br />
neun Millionen € bringen soll. Georg<br />
Morawitz: „Uns war von Beginn an<br />
Prozeßoptimierung, Strukturverbesserung und Verhaltensänderung bilden die Basis des firmenweiten „W2S“-Pojektes.<br />
W2S“ dreht nicht nur an kleinen<br />
Schräubchen, sondern sucht<br />
auf ganzer Linie nach Verbesund<br />
Modularisierung der Produkte<br />
querschnittlich abgestimmt und ein<br />
einheitliches Verfahren für ein konseserung.<br />
Dieser ganzheitliche Anspruch quentes Zielkostenmanagement in<br />
findet seinen Widerhall in 72 mehr<br />
oder weniger umfangreichen Maßnahmen,<br />
den sogenannten Konzeptelementen.<br />
Ein kleiner Ausschnitt davon:<br />
★ Eine Vision und ein Unternehmensleitbild<br />
sind erarbeitet und breitflächig<br />
kommuniziert worden. Die Vision ist<br />
Ausgangspunkt einer Strategie-Erneuerung<br />
für sämtliche Produkt- und<br />
Geschäftsbereiche, die auf Basis einer<br />
gründlichen Marktanalyse geschieht<br />
und kurz vor ihrem Abschluß steht.<br />
der Produktentwicklung festgelegt.<br />
★ Zur erfolgsorientierten Ausrichtung<br />
sämtlicher Vertriebsressourcen werden<br />
Marktchancen jetzt nach einem<br />
festgelegten Schema bewertet und Anfragen<br />
gefiltert. Das „Key Account Management“<br />
und das Beziehungsmanagement<br />
sind als neue Elemente<br />
in den Vertriebsprozeß fest integriert.<br />
★ Die Schnittstellen zwischen der Projekt-<br />
und der Linienorganisation sind<br />
klar definiert. Die gesamte Projektar-<br />
★ Die Entwicklungsprozesse sind<br />
überarbeitet worden und sollen auf<br />
dieser Basis künftig auf einen höheren<br />
Qualitätsstandard gehoben werden.<br />
Software-Entwicklungsergebnisse<br />
fließen ein in einen Pool, der allen Entwicklern<br />
im Unternehmen offen steht;<br />
damit das Rad nicht mehrfach neu erfunden<br />
werden muß, können sich die<br />
Entwickler aus diesem Pool bedienen.<br />
★ Die Flächenbereinigung ist angegangen,<br />
die Lagerstruktur ist optimiert<br />
★ Um Mehrfachentwicklungen ein für beit wird durch eine lückenlose „Re- worden. Neubau oder zusätzliche An-<br />
alle Mal zu verhindern, sind die Mögview“-Struktur von zu spät erkannten mietungen sind so verhindert worden,<br />
lichkeiten für eine Standardisierung Risiken befreit.<br />
der Materialfluß wurde beschleunigt.<br />
WAY 2 SUCCESS<br />
Geschäftsprozesse<br />
Marktbearbeitung/VertriebAuftragsabwicklung<br />
Entwicklung<br />
Wissensmanagement<br />
Volumen<br />
Unterstützende<br />
Prozesse<br />
Ein Projekt mit großer Spannbreite und ganzheitlichem Ansatz, das an den Standorten Bremen und Wedel von STN Atlas<br />
Elektronik läuft: „W2S“ baut auf der Erkenntnis auf, daß es nicht ausreicht, nur an einzelnen Stellen zu optimieren.<br />
klar, daß wir die herkömmlichen Pfade<br />
verlassen mußten. Wir wußten, wenn<br />
wir wirklich besser werden wollen,<br />
müssen wir an die Prozesse und an<br />
die Strukturen heran<br />
und letztlich<br />
auch an das Verhalten<br />
unserer Mitarbeiter.“<br />
Alles das soll<br />
„W2S“ nun leisten.<br />
Ausgelegt ist das<br />
im April 2000 gestartete<br />
Projekt auf<br />
insgesamt 21 Monate:<br />
von den<br />
ersten Konzepten<br />
bis zur vollständigenImplementierung<br />
aller Verbesserungen,<br />
die Ende<br />
2001 abgeschlossen<br />
sein sollen. In<br />
den ersten zwei,<br />
drei Monaten waren<br />
die Mitglieder<br />
der „Task-Forces“<br />
hauptsächlich damit<br />
beschäftigt, die erforderlichen<br />
Verbesserungsmaßnahmen zu strukturieren,<br />
konzeptionell zu beschreiben<br />
und einen Umsetzungsplan zu<br />
entwickeln. Dabei folgten alle Überlegungen<br />
in den unterschiedlichen<br />
„Task-Forces“ einem festen Prinzip:<br />
So einheitlich wie möglich, so unterschiedlich<br />
wie nötig. Gemeint ist damit,<br />
daß nicht jeder der drei Geschäftsbereiche<br />
von STN Atlas für sich<br />
nach separaten Lösungsansätzen<br />
sucht. Wo immer dies von den Prozessen<br />
und vom Produktspektrum her<br />
möglich war, wurde um die einheitliche<br />
Lösung für das gesamte Unternehmen<br />
gerungen.<br />
72 unterschiedliche Maßnahmen zur<br />
Optimierung von Strukturen und für<br />
Prozeßverbesserungen sind in der<br />
Konzeptphase des Projekts erarbeitet,<br />
definiert und beschrieben worden<br />
(siehe Kasten). In der Sprache von<br />
„W2S“ sind das die sogenannten<br />
„Konzeptelemente“. Die gilt es nach<br />
und nach umzusetzen: entweder unternehmensweit<br />
bei allen neu anlaufenden<br />
Kundenprojekten und dort, wo<br />
★ Das Berichtswesen über alle Geschäfts-<br />
und Produktbereiche ist jetzt<br />
vereinheitlicht und wird künftig mit einer<br />
optimierten DV-Unterstützung laufen.<br />
★ Das IT-Management realisiert kostensparende<br />
Supportlösungen und<br />
arbeitet unter anderem an der<br />
Einführung eines Verzeichnisdienstes.<br />
★ Das Qualitätsmanagement hat einen<br />
Basisleistungskatalog festgelegt<br />
und wird darüber hinausgehende Leistungen<br />
künftig nur noch dann erbringen,<br />
wenn die Zusatzkosten auch getragen<br />
werden.<br />
Struktur<br />
Integrierte<br />
Organisation<br />
Human<br />
Resources<br />
Ulrich Grillo Georg Morawitz<br />
M. Solmersitz H.-P. Wegner<br />
World Class<br />
Einkauf<br />
Beschaffung<br />
Bedarfsbündelung<br />
Integrierter<br />
Einkauf<br />
Globalisierung<br />
LieferantenmanagementEinkaufsabwicklung<br />
es noch sinnvoll ist, auch bei schon<br />
länger laufenden Projekten.<br />
Damit am Ende alles zusammenpaßt,<br />
setzen sich die Sprecher der<br />
„Task-Forces“ alle<br />
zwei Wochen im<br />
„W2S“-Kernteam<br />
zusammen und<br />
stimmen ihre Verbesserungskonzepte<br />
miteinander ab.<br />
Erst wenn in diesem<br />
Gremium Konsens<br />
herrscht, geben<br />
die Geschäftsführung<br />
und die<br />
Leiter der Geschäftsbereiche<br />
die<br />
Konzepte zur endgültigenUmsetzung<br />
frei. Damit ist<br />
sichergestellt, daß<br />
das, was in den Arbeitsteams„bottum-up“<br />
erarbeitet<br />
wurde, in der Umsetzungsphase<br />
„top-down“ begleitet<br />
und mitgetragen wird.<br />
Aber damit nicht genug: Neue Wege<br />
geht das „W2S“-Projekt auch in der Zusammenarbeit<br />
mit dem Betriebsrat.<br />
Schon im Zuge der letzten Sozialplanverhandlungen<br />
zum Ende des Jahres<br />
1999 wurde fest vereinbart, ein gemeinsames<br />
Gremium zu schaffen, das<br />
den kompletten Veränderungsprozeß<br />
begleitet: die sogenannte Pari-Kommission.<br />
„Entweder wir ändern uns,<br />
oder wir werden von außen verändert.<br />
Und ich vermag nicht zu beurteilen, wie<br />
dann unser Unternehmen aussieht“,<br />
sagt Manfred Solmersitz, Gesamtbetriebsratsvorsitzender<br />
bei STN Atlas<br />
Elektronik. Er fügt hinzu: „Daher wollen<br />
wir, daß ‚W2S‘ ein Erfolg wird, denn<br />
die Belegschaft in diesem Unternehmen<br />
hat genügend Opfer gebracht.<br />
Deshalb waren wir als Belegschaftsvertreter<br />
von Beginn an mit dabei und haben<br />
Maßnahmen gefordert. Aber wir<br />
wollen nicht nur am Rand mitlaufen,<br />
sondern wir wollen auch mitsprechen<br />
und mitentscheiden.“ Deshalb sitzen<br />
in der Pari-Kommission gleichberech-<br />
(Fortsetzung auf Seite 12)<br />
Das „W2S“-Projekt im Überblick<br />
★ Auf dem Feld der Personalentwicklung<br />
ist die Einführung von Mitarbeitergesprächen<br />
geregelt worden und<br />
ein Modus festgelegt, nach dem gezielt<br />
der Qualifizierungsbedarf bei bestimmten<br />
Mitarbeitergruppen ermittelt<br />
werden kann.<br />
★ Wissensmanagement wurde zum<br />
neuen Kernprozeß im Unternehmen<br />
erhoben. Vier Teams befassen sich mit<br />
den Wissensmanagement-Abläufen,<br />
mit den Inhalten, den kulturellen Voraussetzungen<br />
und einem geeigneten<br />
„Tool“ zur Unterstützung des Wissensmanagementprozesses.
Seite 12 Das aktuelle Thema / Aus den Unternehmensbereichen<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Einen für STN Atlas neuen Organisationstypus<br />
hat die „W2S-Task-<br />
Force“ geschaffen, die sich mit der<br />
Frage der Struktur beschäftigte: die<br />
Teamorganisation. Vom kommenden<br />
Jahr an wird das die zentrale Form der<br />
Linienorganisation im Unternehmen<br />
sein. Dahinter steckt die radikale Abkehr<br />
von der komplexen Aufbauorganisation<br />
mit ihren feinziselierten Organigramm-Darstellungen<br />
und einer hohen<br />
Zahl an „Kästchen“. Dahinter verbirgt<br />
sich die Hinwendung zu einer flachen<br />
und sehr flexiblen Form der Organisation,<br />
die konsequent an den im Rahmen<br />
von „W2S“ neu gestalteten Prozessen<br />
ausgerichtet ist und das zielorientierte<br />
Arbeiten befördern soll.<br />
Entscheidung für Teamorganisation<br />
erst von den vielen Kästchen weg.“ So nung bis hin zur Feinplanung der ei-<br />
sind von den einst 600 Kästchen im genen Ressourcen. Kooperative Zu-<br />
Organigramm von STN Atlas nur noch sammenarbeit, verbunden mit einem<br />
etwa ein Viertel geblieben – teilweise erweiterten Handlungsspielraum und<br />
mit neuen Aufgabeninhalten. „Was mehr Selbstverantwortung dort, wo<br />
wir an organisatorischer Ausprägung die eigentliche Wertschöpfung im Un-<br />
hatten, war nicht mehr steigerbar, eiternehmen stattfindet – das sind wene<br />
sinnvolle Organisationsentwicksentliche Ziele der Teamorganisation.<br />
lung war auf dieser Basis nicht mehr Sie zu erreichen setzt aber mehr als<br />
möglich“, begründet Arbeitsdirektor organisatorische Veränderung vor-<br />
Georg Morawitz die Entscheidung für aus: Deshalb wurde ein Zielvereinba-<br />
die Teamorganisation.<br />
rungssystem konzipiert, das Schritt<br />
In den Teams werden Aufgaben, für Schritt mit dem Entgeltsystem ver-<br />
Entscheidungskompetenz und Verbunden werden soll, und ein Ermittantwortung<br />
zusammengefaßt und lungsschema für den individuellen<br />
über eine Zielvereinbarung gekop- Qualifizierungsbedarf entworfen. Und<br />
Ulrich Grillo, Vorsitzender der Gepelt. Neben der Erledigung ihrer ei- abgerundet wird das alles durch ein<br />
schäftsführung der STN Atlas Elektrogentlichen Fachaufgabe sind die hochflexibles Arbeitszeitmodell, das<br />
nik GmbH: „Wenn wir vom Kästchen- Teams zur Selbststeuerung verpflich- schon seit Beginn diesen Jahres gilt.<br />
denken weg wollen, müssen wir zutet: Das reicht von der Urlaubspla-<br />
pr<br />
STN Atlas: Mit „W2S“ zurück zur alten Ertragskraft<br />
„Alles wird auf den Prüfstand ...“<br />
(Forts. von Seite 11)<br />
tigt Betriebsräte<br />
und Führungskräfte<br />
zusammen und<br />
sprechen über alle<br />
Maßnahmenpakete,<br />
die aus dem<br />
„W2S“-Projekt entstehen.<br />
Das schafft<br />
Vertrauen und beschleunigt<br />
den Umsetzungsprozeß<br />
–<br />
insbesondere,<br />
wenn es um mitbestimmungsrelevante<br />
Punkte geht.<br />
Zeit ist Geld. Dieser<br />
Grundsatz gilt<br />
allemal für „W2S“.<br />
Alle Beteiligten waren sich einig, daß<br />
noch im laufenden Jahr spürbare Verbesserungen<br />
erkennbar werden müssen.<br />
Nicht nur, um den für 2000 bei STN<br />
Atlas geplanten „Turn-Around“ zusätzlich<br />
abzusichern. Auch um das gesamte<br />
Projekt in Schwung zu halten, mußte<br />
der Weg vom Konzeptpapier zur Realität<br />
so weit wie möglich verkürzt werden.<br />
Deshalb drückten alle „Task-Forces“<br />
auf die Tube. „Wir arbeiten nach<br />
dem 80-20-Prinzip“, sagt Hans-Peter<br />
Wegner, der das „W2S“-Projekt leitet:<br />
„Wenn wir 80 Prozent sicher sind, die<br />
richtige Lösung umsetzungsreif zu haben,<br />
beginnen wir danach zu arbeiten.<br />
Die restliche Feinabstimmung geschieht<br />
dann während der Umsetzung,<br />
weil wir wissen,<br />
daß jede Realisierung<br />
sowieso an<br />
der einen oder anderen<br />
Stelle kleinere<br />
Korrekturen mit<br />
sich bringt.“<br />
So oder so liegt<br />
auf der Hand, daß<br />
nicht ein noch so<br />
gutes Konzept entscheidet,<br />
sondern<br />
einzig und allein<br />
die konsequente<br />
Umsetzung. Deshalb<br />
hat man beim<br />
Bremer Elektronikspezialisten<br />
vorgebeugt und ei-<br />
„Blaue Männer“ überall im Unternehmen: Die „W2S“-Symbolfigur<br />
– hier am Arbeitsplatz von Hans-Dieter Kammann.<br />
„W2S“: Von Beginn<br />
an transparent<br />
pr Bremen/Wedel. Ein wesentliches<br />
Prinzip der „W2S“-Projektarbeit<br />
ist größtmögliche Transparenz: Möglichst<br />
wenig soll im „stillen Kämmerlein“<br />
passieren; alle Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter müssen wissen, worum<br />
es bei „Way to Success“ geht und<br />
welche Veränderungen konkret damit<br />
verbunden sind. Deshalb haben Information<br />
und Kommunikation einen<br />
so hohen Stellenwert. Und die Palette<br />
ist weit gefächert: Angefangen von<br />
Einzelgesprächen, über zahllose Infoveranstaltungen,<br />
in dem die Veränderungsmaßnahmen<br />
all denen erläu-<br />
nen zentralen Prozeßkoordinator eingesetzt.<br />
Jürgen Dautert aus der Qualitätssicherung<br />
zieht durch das Unternehmen<br />
und hat ein Augenmerk darauf,<br />
daß es in der Realisierungsphase<br />
Jürgen Dautert<br />
Peter Rücker<br />
Teamorganisation: ein wesentliches Element der neuen<br />
Organisationsstruktur bei STN Atlas Elektronik GmbH.<br />
tert werden, die sie an ihrem Arbeitsplatz<br />
umsetzen müssen, bis hin zu<br />
Führungskräftetreffen, Mitarbeiterund<br />
Betriebsversammlungen, die eigens<br />
dem Thema „W2S“ vorbehalten<br />
bleiben.<br />
Unterstützt wird all dies durch ein<br />
breites internes Informationsangebot,<br />
das über „Inline“, dem zentralen<br />
Intranet von STN Atlas Elektronik, verbreitet<br />
wird. Dort sind die zentralen<br />
Dokumente zu „W2S“ hinterlegt; dort<br />
sind alle wichtigen Projekt-Termine<br />
abrufbar genauso wie die neuesten<br />
Nachrichten zum Projekt als Ganzes.<br />
Im „Inline“ kann über das Projekt diskutiert<br />
werden: Dazu gibt es das sogenannte<br />
„W2S“-Forum. Und „Inline“<br />
nirgendwo klemmt. Er ist der oberste<br />
Wächter darüber, daß nach den in den<br />
„W2S“-Teams festgelegten Vorgaben<br />
gearbeitet wird. Das zum einen. Zum<br />
anderen prüft er jede Neuerung darauf,<br />
daß sie ordentlich dokumentiert<br />
wird und sich nicht mit bestehenden<br />
Regeln oder anderen Veränderungen<br />
reibt.<br />
„Bei der Vielzahl der Dinge, die wir<br />
angeschoben haben, ist das nicht immer<br />
ganz so leicht. Und nebenbei muß<br />
man an der einen oder anderen Stelle<br />
auch noch ein wenig Überzeugungsarbeit<br />
leisten“, beschreibt Dautert<br />
seine Aufgabe. Dabei ist er aber nicht<br />
allein. Insgesamt 23 größere Kundenprojekte<br />
haben die Projektverantwortlichen<br />
ausgewählt und zu Schlüsselprojekten<br />
für „W2S“ erklärt. Diese<br />
Schlüsselprojekte werden unterstützend<br />
und beratend vor Ort von Implementierungsbeauftragten<br />
begleitet<br />
und einem besonders intensiven Controlling<br />
unterzogen.<br />
Denn ganz wichtig ist: Jede einzelne<br />
Maßnahme ist hinsichtlich ihrer dauerhaftenErgebnisverbesserungseffekte<br />
genau bewertet worden. Selbstverständlich<br />
auch im Hinblick darauf, was<br />
sie kostet. Notwendige Qualifizierungsmaßnahmen,<br />
die aus dem Projekt<br />
erwachsen, und die Vereinheitlichung<br />
und Optimierung der im Unternehmen<br />
eingesetzten DV-Werkzeuge<br />
sind zwei nicht unbeträchtliche Kostenfaktoren,<br />
die von vornherein mit<br />
einkalkuliert werden mußten.<br />
Damit inhaltlich wie zahlenmäßig<br />
nichts verwässert wird, hat die Projektleitung<br />
von Anfang an auf einem präzisen<br />
Projekt-Controlling bestanden.<br />
Denn allen Beteiligten im „W2S“-Projekt<br />
ist klar, was Projektleiter Hans-Peter<br />
Wegner auf den Punkt bringt: „Niemand<br />
interessiert sich am Ende für<br />
das, was wir uns an Verbesserungen<br />
überlegt haben; aber alle interessieren<br />
sich dafür, ob das auch in der Ergebnisrechnung<br />
ankommt.“ Insoweit kann<br />
Wegner zum Jahresende einen ersten<br />
Etappenerfolg vermelden. Die für<br />
2000 eingeplanten Ergebnisverbesserungen<br />
sind unter Dach und Fach. Die<br />
nächste Runde im „W2S“-Projekt kann<br />
eingeläutet werden. Peter Rücker<br />
erlaubt es auch, gezielte Fragen an<br />
die Projektleitung zu richten.<br />
Weil aber nicht alles auf elektronischem<br />
Weg geht, werden in regelmäßigen<br />
Abständen die Projekt-<br />
„Highlights“ in Form von Papier verteilt:<br />
Dazu wurde der „W2S“-Newsletter<br />
aus der Taufe gehoben, der an<br />
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
verteilt wird. Last but not least: Damit<br />
allen ins Bewußtsein dringt, daß<br />
„Way to Success“ kein Projekt ist wie<br />
jedes andere, hängen und stehen im<br />
gesamten Unternehmen die blauen<br />
„W2S“-Männer, und an den Fahnenmasten<br />
wehen – für alle Tag für Tag<br />
im Blick – die Fahnen mit dem entsprechenden<br />
Logo.<br />
Erfolgreiche Preh-Produktlinie<br />
Für Volkswagen schon<br />
fünf Millionen Systeme<br />
dp Bad Neustadt. Ende Oktober diesen<br />
Jahres wurde bei den Preh-Werken<br />
in Bad Neustadt an der Saale das fünfmillionste<br />
Heizungs-, Lüftungs-, Klimabediensystem<br />
für den VW-Konzern<br />
(Plattform A4/B5) produziert und ausgeliefert.<br />
Der Projektstart für diese Bedienteile<br />
erfolgte im April 1994. Nach relativ kurzer<br />
Entwicklungszeit wurden ein Jahr<br />
später die ersten Pressefahrzeuge bei<br />
Audi mit diesem Bediensystem ausgestattet.<br />
Der Serienstart auf einer automatischen<br />
Montageanlage begann im<br />
April 1997. Heute werden von diesem<br />
Bediensystem 45 Varianten gefertigt.<br />
Zum Einsatz kommen die Systeme<br />
mit Blenden in unterschiedlichem Design<br />
und verschiedenfarbiger Ausleuchtung<br />
(Nachtdesign) in folgenden<br />
Fahrzeugtypen: Audi A3, Audi A4, Audi<br />
A6, Audi TT, Skoda Oktavia, VW Golf,<br />
VW Bora, VW Polo, VW Lupo, VW Passat,<br />
New Beetle, Seat-Ibiza, -Cordoba,<br />
-Toledo, -Arosa und Porsche Boxter.<br />
Täglich werden in Bad Neustadt<br />
8400 Systeme im Drei-Schichtbetrieb<br />
produziert sowie zusätzlich im Werk<br />
Portugal 600 Stück für den Käfernachfolger<br />
„New Beetle“. Die Auslieferung<br />
der Bedienteile erfolgt „just-in-time“<br />
an die Werke des VW-Konzerns in<br />
Deutschland, Spanien, Tschechien,<br />
Mexiko und Brasilien. Die Investitionen<br />
für dieses Projekt betrugen mehr<br />
als 15 Millionen €.<br />
Eine hohe technische Herausforderung<br />
für die Preh-Werke stellte bei diesem<br />
Bediensystem die Entwicklung<br />
und Einführung der Mehrkomponenten-Kunststoffspritztechnik<br />
für die Tagund<br />
Nachtdesign-Darstellung sowie<br />
die Tag- und Nachtdesign-Darstellung<br />
Preh-Bediensystem für den Audi TT: Aluminium-Technik mit Nachtdesign.<br />
in Verbindung mit einer Aluminium-<br />
Oberfläche dar.<br />
Die Montageanlage, die vom Preh-<br />
Produktbereich Industrieausrüstungen<br />
konstruiert und gebaut wurde,<br />
mußte darüber hinaus eine baugruppenbezogene<br />
Montage mit gleichzeitiger<br />
Realisierung von bis zu acht Varianten<br />
mittels integrierten Design-Lasern<br />
beinhalten.<br />
Zur Zeit liegen von VW weitere Anfragen<br />
vor für die Belieferung der VW-<br />
Werke in China und Südafrika.<br />
Mehr als fünf Millionen Heizungs-, Lüftungs-, Klimabediensysteme haben die<br />
Preh-Werke bis heute für den Volkswagen-Konzern (Plattform A4/B5) produziert<br />
und ausgeliefert. Unter den insgesamt 45 Varianten sind auch die hier gezeigten<br />
Systeme für den Seat-Arosa (Foto unten) sowie den New Beetle (Foto oben).<br />
Erfolgreich in Serie: Bediensystem von Preh für den VW Golf.
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Aus den Unternehmensbereichen<br />
Seite 13<br />
Ob bei den Vorträgen, den – thematisch zugeordneten – Fragestunden oder der Abschlußdiskussion: Know-how-Transfer wurde beim Rheinmetall-Forum zum Thema „E-Business“ groß geschrieben. Unsere<br />
Fotos zeigen einige der Teilnehmer (v.l.n.r.): Wolfgang Martin (Rheinmetall <strong>AG</strong>), Petra Zibler und Ulf Scherenberg (beide RIS GmbH ), Holger Förster und Manfred Jansen (beide Jagenberg Papiertechnik GmbH),<br />
Urs Krank (PAT – Hintergrund), Andre Spang (Kolbenschmidt Pierburg <strong>AG</strong>), Torsten Michalski (Rheinmetall Landsysteme GmbH) und Dr. Ernst Rudolf Bauer (Preh-Werke GmbH & Co. KG).<br />
Rheinmetall-Forum zum Thema „E-Business“<br />
Ein Instrument mit<br />
großer Perspektive<br />
Düsseldorf. Begriffe wie „E-Commerce“,<br />
„Elektronischer Marktplatz“ oder<br />
„b2b“ sind in den Medien allgegenwärtig.<br />
Kaum ein Tag vergeht, an dem<br />
nicht auf den Wirtschaftsseiten der Tagespresse<br />
oder in den Nachrichtensendungen<br />
von Hörfunk und Fernsehen<br />
über ein neues, großes Internet-<br />
Vorhaben eines renommierten Unternehmens<br />
berichtet wird.<br />
Das Internet – die Basis für effiziente,<br />
schnelle und weltweite Kommunikation<br />
– entwickelt sich dabei zunehmend<br />
auch zur Handelsplattform für<br />
Unternehmen. Dem boomenden „business-to-business“-Bereich<br />
(„b2b“)<br />
kommt dabei besondere Bedeutung<br />
zu. Informationsbeschaffung, Auftragsabwicklung,<br />
Meldungen über die<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
Übrige B2B-Umsätze<br />
E-Marktplatz<br />
(Angaben in Milliarden Dollar)<br />
Verfügbarkeit von Material und Produkten,<br />
Projekt- und Kooperationabwicklung<br />
und „Online-Support“<br />
sind nur einige Bereiche, die durch „E-<br />
Commerce“ im „b2b“-Bereich effizient<br />
gestaltet werden können.<br />
Das Rheinmetall-Kolleg hat diesen<br />
Themenkomplex aufgegriffen und am<br />
14. November 2000 ein Forum zum<br />
Thema „E-Business“ veranstaltet. Angesprochen<br />
waren insbesondere Geschäftsführer<br />
der Konzerngesellschaften<br />
sowie Führungskräfte aus den Bereichen<br />
Beschaffung, Materialwirtschaft,<br />
Logistik und Vertrieb. Gut 50<br />
Teilnehmer nutzten schließlich die<br />
Gelegenheit, sich über die Trends und<br />
Nutzenpotentiale des „E-Business“<br />
im Allgemeinen und den aktuellen<br />
Status im Rheinmetall-Konzern im Besonderen<br />
zu informieren. Moderiert<br />
wurde die Veranstaltung von Dr. Wolfgang<br />
G. Glaubitz, Generalbevollmächtigter<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong>.<br />
Nach einem Impulsvortrag des<br />
„Chief Information Officers“ der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong>, Wolfgang Martin, referierten<br />
Jürgen Koopsingraven (Trainee<br />
Rheinmetall <strong>AG</strong>, z. Zt. RIS GmbH),<br />
Manfred Cordes (STN Atlas Elektronik<br />
GmbH), Tobias Hocker (MSI Motor Service<br />
International GmbH) und Thomas<br />
Kramer (KS Kolbenschmidt GmbH)<br />
über konkrete „E-Business“-Lösungen<br />
in ihren Gesellschaften. Petra Zibler<br />
und Ulf Scherenberg (beide RIS GmbH)<br />
stellten darüber hinaus die elektronische<br />
Plattform „mySAP.com“ („Das<br />
<strong>Profil</strong>“ 3/2000) vor.<br />
Im Anschluß an die einzelnen Vorträge<br />
nutzten die Forums-Teilnehmer<br />
die Möglichkeit, in Tischgruppen über<br />
die jeweilige Thematik zu diskutieren<br />
und detaillierte Fragen an den Referenten<br />
zu stellen, wovon reger Gebrauch<br />
gemacht wurde. Die Beiträge<br />
der Abschlußdiskussion zeigten, daß<br />
zum Thema „E-Business“ ein hoher<br />
Informationsbedarf in den Konzerngesellschaften<br />
besteht. Dabei wurde<br />
u.a. eine Intensivierung der konzernweiten<br />
Aktivitäten in diesem Bereich<br />
angeregt. (Die „E-Business“-Thematik<br />
wird in den nächsten „<strong>Profil</strong>“-Ausgaben<br />
ausführlicher vorgestellt.)<br />
Die Veranstaltungsreihe Rheinmetall-Forum<br />
wird 2001 fortgesetzt, und<br />
zwar mit folgenden Themen: „Verbesserungsprozesse<br />
in der betrieblichen<br />
Praxis“ (2. April 2001, Dorint-Hotel,<br />
Krefeld) und „Außenhandels- und Projektfinanzierung“<br />
(8. Oktober 2001,<br />
Dorint-Hotel, Krefeld). Anmeldungen<br />
nimmt das Rheinmetall-Kolleg entgegen.<br />
Wolfgang Baer<br />
Unternehmen der Zukunft<br />
Information als strategischer Wettbewerbsfaktor<br />
Mitarbeiter Kunden<br />
Partner<br />
3949<br />
7297<br />
2188<br />
2000<br />
953<br />
403<br />
45 145<br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Wächst: Geschäftsverkehr via Internet.<br />
Zulieferer<br />
Wissen ist heute ein wichtiger strategischer Wettbewerbsfaktor – und deshalb für<br />
moderne Industrieunternehmen ein unabdingbares Instrument zur Information<br />
von Kunden, Geschäftspartnern, Zulieferern und Mitarbeitern.<br />
Der „Tipp“-Nutzer wird bei der Eingabe der Kompetenzgebiete vom System geleitet (Bild l.). Dieses stellt einen „Online“-Fragebogen<br />
zur Verfügung, der für eine grundlegende Strukturierung sorgt und so eine schnelle und unproblematische Integration<br />
der Wissensdaten ermöglicht. Generell können die Anwender von „Tipp“ jederzeit eine Volltextsuche nach beliebigen Begriffen<br />
in der Datenbank starten(Bild r.). Dazu dient das Eingabefeld im oberen Teil. Allerdings ist es unter anderem ebenfalls<br />
möglich, sich die bereits eingegebenen Stichwörter, nach verschiedenen Bereichen geordnet, anzeigen zu lassen.<br />
Der Slogan, mit dem sie gegenwärtig bundesweit von<br />
der Deutsche Telekom Medien GmbH (Frankfurt/<br />
Main) beworben werden, ist eingängig und sagt es<br />
auf den Punkt: „Gelbe Seiten machen das Leben leichter“.<br />
In der Tat: Die „Gelben Seiten“ sind für jeden Ratsuchenden<br />
das wohl bekannteste Nachschlagewerk, um<br />
den richtigen fachlichen Ansprechpartner zur Lösung<br />
eines Problems zu finden. Auch innerhalb von Unternehmen,<br />
die das Know-how und die fachlichen Ressourcen<br />
ihrer Mitarbeiter umfassend und gezielt nutzen, gehören<br />
„Yellow Pages“-Projekt bei STN Atlas Elektronik<br />
Per„Tipp“Zugriff auf das Know-how<br />
Bremen. Wissen – es ist unsichtbar<br />
und doch eine der wichtigsten Ressourcen<br />
überhaupt. Als zentraler Baustein<br />
und außerordentlich wichtiges<br />
Kapital hochentwickelter Industriegesellschaften<br />
steht Wissen heute im<br />
Mittelpunkt vieler Programme, mit deren<br />
Hilfe sich Unternehmen den Vorsprung<br />
vor der Konkurrenz schaffen<br />
bzw. sichern wollen.<br />
Je mehr Mitarbeiter ein Unternehmen<br />
hat, desto notwendiger wird ein effektives<br />
Wissensmanagement. Ein Teilproblem<br />
aus dem Gebiet Wissensmanagement<br />
ist dabei das Aufdecken und Bekanntmachen<br />
von Wissen und den dazugehörigen<br />
Wissensträgern im Unternehmen.<br />
Unter anderem bedingt durch<br />
Personalfluktuation, sind dem einzelnen<br />
Mitarbeiter meist nur die Wissensgebiete<br />
seines unmittelbaren kollegialen<br />
Umfeldes bekannt. Es kann daher<br />
unter Umständen vorkommen, daß ein<br />
und dasselbe Problem an verschiedenen<br />
Stellen innerhalb eines Unternehmens<br />
oder Konzerns auftritt und dieses<br />
jeweils unabhängig voneinander<br />
gleich mehrmals gelöst wird. Um diesem<br />
Effekt entgegenzuwirken, wird mit<br />
unterschiedlichsten Methoden versucht,<br />
Wissen aufzudecken.<br />
Ein – im Wissensmanagement bekannter<br />
– Ansatz ist der Einsatz sogenannter<br />
„Yellow Pages“. Dabei werden<br />
die Wissensgebiete der einzelnen Mitarbeiter<br />
auf freiwilliger Basis in einer<br />
Datenbank abgelegt und anschließend<br />
mit Hilfe einer Suchmaschine dem Mit-<br />
arbeiterstamm zur Verfügung gestellt.<br />
Die Eingabe der Wissensgebiete geschieht<br />
durch den Wissensträger<br />
selbst; dieser ist somit für die Aktualität<br />
und den Inhalt seiner Eintragungen verantwortlich.<br />
Das Ergebnis dieses Prozesses<br />
ist schließlich eine Art „Inhaltsverzeichnis“<br />
des vorhandenen Wissens<br />
mit den dazugehörigen Know-how-Trägern.<br />
Entscheidend ist dabei, daß nicht<br />
die Wissensinhalte als solche abgelegt<br />
werden, da kein Lexikon geschaffen<br />
werden soll, sondern „nur“ die einzelnen<br />
Wissensgebiete mit den jeweiligen<br />
Ansprechpartnern genannt werden.<br />
Bei der STN Atlas Elektronik GmbH<br />
wurde ein derartiges System konzeptioniert,<br />
programmiert und unter dem<br />
Namen „Tipp“ („transparent – informativ<br />
– praktisch – professionell“)<br />
eingeführt. Die Plattform bildete dabei<br />
das in Bremen schon länger existierende<br />
„Inline“-Intranet („Das <strong>Profil</strong>“<br />
1/2000). Mit Hilfe der „Yellow Pages“<br />
können jetzt die Organisationseinheiten<br />
bis hin zu den einzelnen Arbeitsgruppen<br />
ihre Kompetenzgebiete dort<br />
selbst einpflegen.<br />
Dieser Vorgang ist denkbar einfach:<br />
Der verantwortliche Mitarbeiter – in der<br />
Regel der Leiter einer Organisationseinheit<br />
– ruft die „Tipp“-Startseite auf und<br />
läßt sich dann bei der Eingabe seiner<br />
Daten vom System leiten. Dieses wiederum<br />
fragt systematisch Ansprechpartner<br />
und Kompetenzgebiete ab. Der<br />
genannte Nutzer vergibt gleichzeitig das<br />
Passwort und kann so jederzeit auf den<br />
„Gelbe Seiten“ zunehmend zum betrieblichen Alltag –<br />
und zwar in Form sogenannter „Yellow Pages“, wie der<br />
folgende „<strong>Profil</strong>“-Beitrag von Dipl. Wirtschaftsing. (FH)<br />
Thies Topp (27) zeigt. Topp, Mitglied der zweiten Rheinmetall-Nachwuchsgruppe<br />
(„Das <strong>Profil</strong>“ 4/2000), hat sich<br />
während seiner Arbeit als Trainee bei der STN Atlas Elektronik<br />
GmbH mit dem Thema „Yellow Pages“ beschäftigt<br />
und dabei mit dem „Tipp“-Konzept ein Instrument entwickelt,<br />
mit dem der Bremer Elektronikspezialist jetzt<br />
hocheffektives Wissensmanagement betreibt. dp<br />
Inhalt der Eintragungen zurückgreifen<br />
oder ihn im Bedarfsfall aktualisieren.<br />
Die Endanwender können diese Daten<br />
lesen, indem sie ebenfalls auf die<br />
„Tipp“-Startseite gehen und dort einen<br />
oder mehrere Suchbegriffe eingeben.<br />
Nach diesen Begriffen wird die Datenbank<br />
durchsucht; anschließend erfolgt<br />
eine nach den angegebenen Kriterien<br />
geordnete Ausgabe der Ergebnisse.<br />
Diese sind automatisch mit dem Telefon-<br />
und Adressen-Server von STN Atlas<br />
Elektronik verbunden, so daß per<br />
Mausklick sofort die entsprechende Telefonnummer<br />
angezeigt wird. Weitere<br />
Suchmöglichkeiten bestehen über ein<br />
Stichwort- und Rubrikenverzeichnis.<br />
Die HTML-Programmierung sowie die<br />
in diesem Zusammenhang eingesetzte<br />
„Access“-Datenbank garantieren eine<br />
kostengünstige und universelle<br />
Einsetzbarkeit. Daneben können mit<br />
relativ geringem Zeitaufwand eventuell<br />
notwendige Anpassungen durchgeführt<br />
werden. Zudem ist eine einfache<br />
Portabilität auf andere Systeme gewährleistet.<br />
„Yellow Pages“ als ein Instrument im<br />
Bereich Wissensmanagement sind<br />
keine Wunderwaffe zur Kontrolle und<br />
Bewältigung der Informations- und<br />
Wissensflut in einem Unternehmen.<br />
Sie bieten jedoch eine weitere und zukunftsorientierte<br />
Möglichkeit, schneller<br />
auf vorhandenes Wissen zugreifen<br />
zu können und dadurch wertvolle Arbeitszeit<br />
sinnvoller als mit zeitraubender<br />
Suche zu nutzen. Thies Topp
Seite 14 Aus den Unternehmensbereichen<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Gruppenbild mit Minister und „Dachs“-Pionierpanzer (Foto oben): Der chilenische Verteidigungsminister Mario Fernández<br />
(4.v.l.) an der Spitze einer hochrangigen Delegation, die unter anderem von Dr. Peter Merten (5.v.l.), Geschäftsführer der<br />
Rheinmetall Landsysteme GmbH, und Manfred Eggers (2.v.l.), Hauptabteilungsleiter Vertrieb Unterstützungsfahrzeuge und<br />
Minenräumsysteme, ausführlich über das Systemprogramm informiert wurde. Auch die Mitglieder des schwedischen Verteidigungsausschusses<br />
unter ihrem Vorsitzenden Henrik Landerholm (vordere Reihe, 5. v. r.) statteten dem Kieler Heerestechnik-Spezialisten<br />
kürzlich einen Informationsbesuch ab (Foto unten). Betreut wurden die Parlamentarier unter anderem<br />
von Mertens Geschäftsführerkollegen Klaus Sander (vordere Reihe, 4. v.r.).<br />
Eurotunnel-Betreibergesellschaft setzt erneut auf Heimann Systems<br />
Prüfkapazität wird deutlich erhöht<br />
dp Folkestone/Wiesbaden. Heimann<br />
Systems, im internationalen Wettbewerb<br />
führender Hersteller von Röntgenprüfsystemen<br />
für Sicherheits- und<br />
Zollzwecke, hat jetzt einen weiteren<br />
Auftrag von der Eurotunnel plc (Großbritannien)<br />
erhalten. Die britische Betreibergesellschaft<br />
des Eurotunnels mit<br />
Sitz in Folkestone/Kent verfolgt dabei<br />
das Ziel, die Prüfkapazität im Frachtbereich<br />
zu erhöhen, um damit den globalen<br />
Frachtverkehr durch den Tunnel unter<br />
dem Ärmelkanal sicherzustellen.<br />
Der Vertrag umfaßt Lieferung und<br />
Installation eines stationären Röntgenprüfsystems<br />
sowie die Modernisierung<br />
des vorhandenen „Euroscan“-Systems.<br />
Beide Großanlagen sind Teil der<br />
Produktfamilie „Heimann CargoVision“<br />
(HCV), die speziell für die Durchleuchtung<br />
beladener Lastkraftwagen und<br />
Container entwickelt wurde.<br />
Die genannten Prüfsysteme liefern<br />
von den durchleuchteten Fahrzeugen<br />
und Ladungen hochauflösende Röntgenbilder,<br />
die anschließend durch erfahrenes<br />
Sicherheitspersonal analysiert<br />
werden. Auf diese Weise können<br />
illegale oder gefährliche Güter und<br />
Substanzen (z. B. Sprengstoffe) so<br />
präzise aufgespürt werden, als wäre<br />
der Lkw transparent, selbst wenn die<br />
Objekte in einem versiegelten Fach<br />
oder in der Fahrerkabine verborgen<br />
sind. Eine Inspektion dauert maximal<br />
zehn Minuten und ersetzt entgegen<br />
herkömmlicher Prüfmethoden die rein<br />
manuelle Überprüfung der Fahrzeuge.<br />
Der neue Vertrag spiegelt den wirtschaftlichen<br />
Erfolg des Prüfsystems –<br />
bei einem momentanen Aufkommen<br />
von 4000 bis 5000 Lkw täglich – wider.<br />
Darüber hinaus ist er Ausdruck einer<br />
erfolgreichen Zusammenarbeit<br />
zwischen Eurotunnel und Heimann Systems<br />
bei der Abwicklung eines<br />
„schlüsselfertigen“ Großprojektes,<br />
das den speziellen technischen Bedürfnissen<br />
des Kunden gerecht wird.<br />
Das neu zu installierende stationäre<br />
„Heimann CargoVision“-System verfügt<br />
von Herstellerseite über die neuesten<br />
technischen Modifizierungen,<br />
z.B. über eine auf 30 Fahrzeuge pro<br />
Stunde erhöhte Prüfkapazität.<br />
Die Modernisierung des bereits vorhandenen<br />
„Euroscan“–Systems – seit<br />
1993 in Betrieb – umfaßt neue Visualisierungs-<br />
und Bildverarbeitungsmöglichkeiten<br />
und erlaubt eine deutliche<br />
Verbesserung verschiedener Systemkomponenten,<br />
so zum Beispiel die Beförderung<br />
der Fahrzeuge durch den<br />
Röntgentunnel und die Qualität und<br />
Präzision der Röntgenbilder.<br />
Durch den Einsatz dieser „HCV“-Systeme,<br />
die an der Einfahrt in den Är-<br />
melkanal-Tunnel auf der britischen<br />
Seite installiert sind, wird die derzeitige<br />
Prüfkapazität um das Doppelte erhöht.<br />
Beide Systeme werden außerdem<br />
auf einer 24-Stunden-Basis arbeiten.<br />
Die Lieferung des neuen Systems<br />
ist für Anfang 2002 geplant, die<br />
Nachrüstung des gegenwärtig eingesetzten<br />
„Euroscan“-Systems wird Ende<br />
2002 abgeschlossen sein. Das Projekt<br />
ist so geplant, daß die Prüfsysteme<br />
immer leistungsfähig und in Betrieb<br />
sind.<br />
Heute sind Systeme des Wiesbadener<br />
Spezialisten bereits an zahlreichen<br />
wichtigen Wirtschaftsknotenpunkten<br />
rund um den Globus im Einsatz.<br />
13 Prüfsysteme gingen seit 1991<br />
in verschiedenen Seehäfen, Flughäfen<br />
und an Grenzübergängen in Betrieb.<br />
Die jüngsten Prüfsysteme wurden am<br />
Grenzübergang Vaalimaa (Finnland),<br />
im Hafen von Tema (Ghana), in Rotterdam<br />
(Niederlande), in Subaraya und<br />
Jakarta (Indonesien) installiert. In diesem<br />
Jahr erhielt Heimann Systems<br />
neue Aufträge von mexikanischen, japanischen<br />
und britischen Zollbehörden<br />
(„Das <strong>Profil</strong>“ berichtete). Insgesamt<br />
wird Heimann Systems Ende<br />
2001 mehr als 21 Systeme der „HCV“-<br />
Familie ausgeliefert haben und ist damit<br />
Weltmarktführer auf dem Gebiet<br />
der Frachtprüfsysteme.<br />
KOSTENNEUTRALE Systemoptimierung:<br />
Die Nico Pyrotechnik Hanns-Jürgen<br />
Diederichs GmbH & Co. KG hat jetzt ihre seit<br />
1992 bei der Bundeswehr eingeführte<br />
Übungspatrone DM 38 für die Panzerfaust 3<br />
(Fotos l. + r.) im Rahmen einer eigenfinanzierten<br />
Weiterentwicklung technisch<br />
verbessert. Der bisher als Verdämmungsund<br />
Gegenmasse (Simulation der Rückstrahlzone)<br />
verwendete Quarzsand wurde<br />
zur Verringerung der Rohr-Erosion durch<br />
Marmorgranulat ersetzt; darüber hinaus<br />
wurde das Geschoß verlängert, um eine<br />
noch größere außenballistische Stabilität zu<br />
gewährleisten. Beide Verbesserungen sind<br />
für die Bundeswehr kostenneutral. Einen ersten<br />
Auftrag über das System, das eine realitätsnahe<br />
Ausbildung im Gelände und auf<br />
Schießanlagen ermöglicht, hat das Trittauer<br />
Unternehmen kürzlich erhalten.<br />
Hochrangige Gäste aus Chile und Schweden<br />
Zusammenarbeit soll<br />
weiter vertieft werden<br />
bau Santiago de Chile/Stockholm.<br />
Der chilenische Verteidigungsminister<br />
Mario Fernández nutzte seinen Besuch<br />
bei Verteidigungsminister Scharping in<br />
Berlin vor wenigen Wochen auch zu einem<br />
Abstecher an die Kieler Förde zur<br />
Rheinmetall Landsysteme GmbH. Dabei<br />
wurde er von mehreren hochrangigen<br />
chilenischen und deutschen Offizieren<br />
begleitet. Den Besuchern wurde<br />
die Produktpalette des Unternehmens<br />
von Geschäftsführer Dr. Peter Merten in<br />
Hardware präsentiert – mit besonderem<br />
Schwerpunkt auf dem Thema „Leopard<br />
1“-Unterstützungsfahrzeuge.<br />
Vor dem Hintergrund der Beschaffung<br />
gebrauchter „Leopard 1“-Kampfpanzer<br />
benötigt die chilenische Armee<br />
derzeit die entsprechenden Unterstützungsfahrzeuge,<br />
also Pionier-, Bergeund<br />
Brückenlegepanzer auf „Leopard<br />
1“-Chassis. Die von Chile geplanten<br />
Unterstützungsfahrzeuge werden<br />
ebenfalls keine Neufahrzeuge, sondern<br />
gebrauchte Systeme sein, die<br />
von befreundeten europäischen Armeen<br />
angeboten werden.<br />
Die Rheinmetall Landsysteme GmbH<br />
bietet nicht nur die erforderliche technische<br />
und logistische Unterstützung<br />
an, die eine hohe Verfügbarkeit und<br />
Einsatzbereitschaft sowie eine lange<br />
Lebensdauer solcher Fahrzeuge gewährleistet,<br />
sondern hält auch kundenorientierteModernisierungskonzepte<br />
zur Leistungssteigerung dieser<br />
Fahrzeuge vor. Derzeit erarbeitet der<br />
Kieler Heerestechnik-Spezialist ein<br />
spezielles Angebot für den chilenischen<br />
Kunden.<br />
Chiles Interesse an den Minenräum-<br />
Systemen der Rheinmetall Landsysteme<br />
besteht bereits seit mehreren Jahren<br />
– so war es kein Wunder, daß auch<br />
der Verteidigungsminister des lateinamerikanischen<br />
Staates sich in Kiel<br />
noch einmal ausführlich über die weltweit<br />
erfolgreich im Einsatz befindlichen<br />
Systemkonzepte „Keiler“ und<br />
„Rhino“ informierte, denn die verminten<br />
Grenzen im Norden Chiles wurden<br />
bisher nicht geräumt.<br />
Im Rahmen seines Norddeutschland-<br />
und Berlin-Besuchs stattete auch der<br />
schwedische Verteidigungsausschuß<br />
der Rheinmetall Landsysteme GmbH<br />
vor kurzem einen Besuch ab. Unter den<br />
Gästen befanden sich u.a. der Ausschußvorsitzende<br />
Henrik Landerholm<br />
sowie der schwedische Verteidigungsattaché<br />
Hakan Beskow und der Vertreter<br />
der schwedischen Botschaft in Berlin,<br />
Lars-Göran Larsson.<br />
Geschäftsführer Klaus Sander stellte<br />
den interessierten Gästen die Produkte<br />
des Unternehmens vor, das von<br />
Schweden im vergangenen Jahr den<br />
Auftrag über die Lieferung von zehn<br />
Bergepanzern mit modernisierter und<br />
spezieller „Büffel“-Technologie erhielt.<br />
Im Zuge der Beschaffung der schwedischen<br />
Version des Kampfpanzers<br />
„Leopard 2 A5“ benötigt die schwedische<br />
Armee auch moderne, leistungsfähige<br />
Bergepanzer, die die Verfügbarkeit<br />
des Kampfpanzers sicherstellen.<br />
Bereits im übernächsten Jahr wird der<br />
erste dieser Bergepanzer an Schweden<br />
ausgeliefert.<br />
Starkes Interesse zeigten die schwedischen<br />
Gäste zudem an dem Systemkonzept<br />
eines neuen Pionierpanzers<br />
auf „Leopard 2“-Chassis. Des weiteren<br />
besteht eine Zusammenarbeit zwischen<br />
Hägglunds Vehicle AB (Örnsköldsvik/Schweden)<br />
und der Rheinmetall<br />
Landsysteme GmbH beim Projekt<br />
„leichte luftverladbare Führungs- und<br />
Transportfahrzeuge für die Bundeswehr“.<br />
Dieses gemeinsame Konzept<br />
sieht das schwedische Fahrzeug „Bv<br />
206“ für die Luftverladung in der Transall<br />
und den „Wiesel 2“ von Rheinmetall<br />
Landsysteme für den Hubschraubertransport<br />
vor. In Kiel konnten die Gäste<br />
die beiden jeweils ersten Prototypen in<br />
den beiden Varianten „Sanitätsfahrzeug“<br />
und „Gefechtsstandtrupp“ begutachten.<br />
Große Aufmerksamkeit widmeten<br />
die Besucher schließlich den international<br />
bekannten Minenräumsystemen<br />
„Keiler“ und „Rhino“.<br />
Die schwedische Delegation äußerte<br />
den Wunsch nach einer zukünftig engeren<br />
Zusammenarbeit mit dem Kieler<br />
Unternehmen.<br />
Bereits seit 1993 sorgt das „Euroscan“-System der Heimann Systems GmbH auf<br />
der französischen und der britischen Seite des Eurotunnels für Sicherheit. Jetzt<br />
konnte das Wiesbadener Unternehmen beim britischen Betreiber, der Eurotunnel<br />
plc in Folkestone/Kent, einen weiteren Großauftrag plazieren. Foto: dpa
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Aus den Unternehmensbereichen<br />
Seite 15<br />
Als autonomes Unterwasserfahrzeug läßt sich der „K-Fisch“ von Bord eines Schiffes aus zu seinen Operationen starten.<br />
„K-Fisch”: Fehlerbehebung für autonome Unterwasserdrohnen<br />
Am EU-Projekt „Advocate“ beteiligt<br />
fk Bremen. Die Erkennung und die<br />
Behebung von Fehlern bei unbemannten<br />
Unterwasserfahrzeugen (beispielsweise<br />
im Bereich von Antrieb<br />
und Energieversorgung) ist – neben<br />
der Entwicklung dieser hochtechnisierten<br />
Vehikel – ein ebenso weites<br />
wie spannendes Feld, das zahlreiche<br />
technische Probleme und Herausforderungen<br />
in sich birgt. Je mehr das<br />
Thema „autonome Unterwasserdrohnen“<br />
international weiterentwickelt<br />
und vorangetrieben wird und je leistungsfähiger<br />
die Fahrzeuge werden,<br />
desto größer ist die Bedeutung der in<br />
diese Roboter integrierten Fähigkeiten<br />
zur Operationskontrolle, Fehlererkennung<br />
und „Beseitigung“ möglicher<br />
Störfaktoren, die eine Operation zu gefährden<br />
drohen.<br />
Mit dem System „Seefuchs“ hat die<br />
STN Atlas Elektronik GmbH – wie ausführlich<br />
berichtet – eine Minenvernichtungsdrohne<br />
entwickelt, die in der Lage<br />
ist, Ankertau- und Grundminen weitestgehend<br />
selbständig zu orten und zu<br />
bekämpfen. Vom „Seefuchs“ ist auch<br />
eine zivile Variante – der „K-Fisch“ entwickelt<br />
worden. Er ist geeignet, unter<br />
Wasser beispielsweise Inspektionen<br />
von Pipelines oder andere unbemannte<br />
Operationen durchzuführen. Dieses System<br />
stand neben zwei weiteren unbemannten<br />
Unterwasserfahrzeugen im<br />
Mittelpunkt des Projekts „Advocate“ –<br />
einem Vorhaben der Europäischen Union,<br />
das jetzt erfolgreich abgeschlossen<br />
werden konnte.<br />
Bei „Advocate“ („Advanced on-board<br />
diagnostic and control of semi-autonomous<br />
mobile systems“) ging es um die<br />
Entwicklung und Erprobung von Fehlererkennungs-,<br />
Diagnose- und Degradationsverfahren<br />
(Verfahren, um geplante<br />
Operationen im Falle eines Fal-<br />
les modifizieren und in abgewandelten<br />
Abläufen weiterführen zu können) für<br />
Roboter – und das am Beispiel unbemannter<br />
Unterwasserfahrzeuge.<br />
An dem Vorhaben, das zu den erfolgreichsten<br />
EU-Projekten der letzten Jahre<br />
zählt und das deshalb auch auf der<br />
„Information Software Technology“<br />
(IST) in Nizza ausführlich vorgestellt<br />
wurde, waren neben STN Atlas Elektronik<br />
so namhafte Institutionen wie Ifremer,<br />
eines der führenden Meeresforschungsinstitute<br />
(Frankreich), die Universität<br />
Madrid, die Firma Decan<br />
(Frankreich), das dänische Softwarehaus<br />
Hugin Expert sowie die Marketing-<br />
und Unternehmensberatung<br />
Innova aus Italien beteiligt.<br />
„Das Stichwort Fehlertoleranz ist ein<br />
ganz zentraler Begriff, wenn man über<br />
das ‚Advocate‘-Projekt spricht und dies<br />
vor dem Hintergrund sieht, autonome<br />
Unterwasserdrohnen aus unserem<br />
Hause in bezug auf Operationskontrolle,<br />
Fehlererkennung und Beseitigung<br />
eventueller Störfaktoren zu optimieren“,<br />
so Willi Hornfeld, Leiter System-<br />
konzepte und Fahrzeugtechnologien<br />
Unterwasserfahrzeuge bei STN Atlas.<br />
Zum konkreten EU-Projekt selbst: Im<br />
Rahmen von „Advocate“ wurden an<br />
Simulatoren für drei verschiedene Unterwasserfahrzeuge<br />
die Leistungserprobungen<br />
für die Fehlerdiagnose und<br />
Degradation durchgeführt. Das Ziel<br />
war klar definiert: Ein effektives, intelligentes<br />
Fehlerbeseitigungssystem für<br />
unbemannte Unterwasserfahrzeuge<br />
zu schaffen, das seine Erkenntnisse<br />
an ein Mission-Managementsystem<br />
weiterleitet, das dann seinerseits die<br />
verbleibende Mission entsprechend<br />
modifiziert und im Idealfall bis zum<br />
Ende durchführt. Nach der Fehlerdiagnose<br />
sollte das neuartige „on<br />
board“-System in der Lage sein, Vorschläge<br />
zur degradierten – also in den<br />
Strukturen abgewandelten – Fortführung<br />
der eigentlichen Mission zu<br />
machen, diese einzuleiten und möglichst<br />
selbsttätig durchzuführen oder<br />
von einem in der Schleife befindlichen<br />
Operateur bestätigen zu lassen.<br />
Beim Auftreten von Fehlern innerhalb<br />
einer Mission sollen künftig abgestufte<br />
Reaktionen sicherstellen, daß<br />
eine einmal begonnene Mission erfolgreich<br />
zu Ende geführt werden kann,<br />
und zwar möglichst ohne zwischenzeitliche<br />
kosten- und zeitaufwendige<br />
Unterbrechung. Verschiedene<br />
Fehlerarten, Diagnosen und Reaktionen<br />
am „K-Fisch“ (simulierte Fehler<br />
an Motor und Stromversorgung) wurden<br />
durchgespielt und getestet.<br />
Willi Hornfeld: „Eines der Ziele für<br />
unser Unternehmen war es, ein Verfahren<br />
für die Überwachung von Robotern<br />
– konkret unseren ‚K-Fisch‘ – zu<br />
schaffen, Fehlerdiagnose und Degradation<br />
zu betreiben und letztlich –<br />
über welchen Lösungsweg auch immer<br />
– Fehlertoleranz<br />
zu schaffen,<br />
die gewährleistet,<br />
daß Operationen<br />
beim Auftreten<br />
von<br />
Störungen nicht<br />
immer gleich abgebrochenwerden<br />
müssen,<br />
sondern in modifizierter<br />
Weise –<br />
möglichst mit<br />
gleichwertigem<br />
Resultat – unter<br />
Wasser erfolgreich<br />
zu Ende geführt<br />
werden<br />
können.“<br />
Hornfeld über<br />
ein weiteres<br />
wichtiges Ergebnis:<br />
„Die dank<br />
,Advocate’ gefundenen<br />
Resultate<br />
sorgen dafür, daß<br />
bisher eingesetzte<br />
redundante Hardware künftig entfällt,<br />
man also nicht mehr – wie bislang<br />
– wichtige Teile eines Systems zwei<br />
oder sogar dreimal mitführen muß.<br />
Hierfür war das Projekt ‚Advocate‘ für<br />
unser Haus ein ganz entscheidender<br />
Schritt. Von allen Beteiligten wurden<br />
sehr gute und wertvolle Vorarbeiten geleistet.<br />
Wir haben jetzt entscheidende<br />
‚Tools‘ in unserer Hand.“<br />
Diese Instrumente sollen im Hause<br />
STN Atlas Elektronik genutzt werden,<br />
um weitere Fortschritte im Bereich der<br />
unbemannten Unterwasserfahrzeuge<br />
und -systeme zu gewährleisten, den „K-<br />
Fisch“ und künftige Vorhaben des Bremer<br />
Elektronikspezialisten so effizient<br />
wie möglich zu machen.<br />
Der „K-Fisch“ dient unter anderem zur Erkundung unter Wasser oder beispielsweise auch der Inspektion<br />
technischer Einrichtungen wie Pipelines. Das Projekt „Advocate“ hat STN Atlas wertvolle Erkenntnisse<br />
darüber gebracht, wie das kompakte Unterwasserfahrzeug noch effizienter arbeiten kann.<br />
Großauftrag für Heimann Systems GmbH<br />
Flughafen Düsseldorf<br />
ist weltweit Vorreiter<br />
dp Düsseldorf/Wiesbaden. Die Heimann<br />
Systems GmbH stattet bis Mitte<br />
2001 den Rhein-Ruhr Flughafen in<br />
Düsseldorf mit vollautomatischen<br />
Röntgenprüfsystemen zur hundertprozentigen<br />
Kontrolle von aufgegebenem<br />
Gepäck aus. Der Düsseldorfer Airport<br />
ist weltweit der erste Großflughafen,<br />
der dafür ein komplettes mehrstufiges<br />
System aus der Produktpalette des<br />
Wiesbadener Sicherheitsspezialisten<br />
einsetzt und damit bereits 2001 die<br />
künftigen Sicherheitsanforderungen<br />
der internationalen Luftfahrtverbände<br />
erfüllen wird: Von 2003 an muß das<br />
gesamte aufgegebene Gepäck einer<br />
hundertprozentigen Kontrolle unterzogen<br />
werden.<br />
Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt<br />
7,2 Millionen € und umfaßt<br />
fünf Geräte der ersten Kontrollstufe sowie<br />
vier Geräte der zweiten Stufe, die<br />
nahtlos in das bestehende Gepäckfördersystem<br />
integriert werden. „Die neuen<br />
Vorgaben der internationalen Luftfahrtverbände<br />
leisten einen wichtigen<br />
Beitrag zur Erhöhung der Flugsicherheit.<br />
Wir verfügen bereits heute über<br />
die notwendige Technologie zur Umsetzung“,<br />
so Geschäftsführer Hans A.<br />
Linkenbach.<br />
Das gesamte System wird bis Januar<br />
2001 installiert sein und nach einer intensiven<br />
Testphase voraussichtlich<br />
Mitte 2001 in Betrieb genommen werden.<br />
Auch im Anschluß daran wird Heimann<br />
Systems durch eine fachgerechte<br />
Wartung und Instandhaltung<br />
für größtmögliche Sicherheit auf dem<br />
Düsseldorfer Flughafen Sorge tragen.<br />
Bis Mitte kommenden Jahres stattet Heimann Systems den Rhein-Ruhr Flughafen<br />
in Düsseldorf mit automatischen Röntgenprüfanlagen zur hundertprozentigen<br />
Kontrolle von aufgegebenem Gepäck aus. Der Airport der NRW-Landeshauptstadt<br />
ist damit der weltweit erste Großflughafen, der ein komplettes mehrstufiges<br />
System der Wiesbadener Firma einsetzt. Foto: Flughafen Düsseldorf GmbH<br />
RUNDE ZAHL: Am 27. November diesen Jahres wurde mit Inke Kiesslich (r.) –<br />
sie arbeitet in der Materialwirtschaft der Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS) in<br />
Kiel – der 5000. „Lotus-Notes-User“ im Rheinmetall-Konzern begrüßt. Stellvertretend<br />
für die seit Mai 2000 neu hinzugekommenen 1000 Nutzer des hochmodernen<br />
Kommunikationssystems („Das <strong>Profil</strong>“ 3/2000) erhielt die RLS-Einkäuferin<br />
von Karsten Lüthje, Leiter des „Competence Centers Unternehmenskommunikation“<br />
der RIS, einen Gutschein über ein Wochenende für zwei Personen auf<br />
dem Dornröschenschloß Sababurg im Reinhardswald nördlich von Kassel. Der<br />
41jährige RIS-Fachmann freute sich beim Fototermin besonders darüber, daß er<br />
einem „User“ des Kieler Unternehmens gratulieren durfte, weil der „Roll-out“ von<br />
„Lotus Notes“ dortselbst erst im Juni 2000 begann und sich innerhalb kurzer Zeit<br />
401 Mitarbeiter zur Nutzung des Systems entschieden hatten. Lüthje: „Mit den<br />
jetzt erreichten 5000 ‚Lotus Notes‘-Anwendern innerhalb des Rheinmetall-Konzerns<br />
ist die Hälfte der insgesamt angestrebten ‚Roll-outs‘ vollzogen.“<br />
Preh-Neuheiten<br />
auf „Retail“-Messe<br />
dp Düsseldorf. Informations- und<br />
Sicherheitstechnik gewinnen im Handel<br />
zunehmend an Bedeutung, wie<br />
man an der Resonanz auf die diesjährige<br />
„Retail Technology“ in Düsseldorf<br />
sehen konnte, auf der auch die<br />
Preh-Werke als Aussteller auf dem<br />
Messestand der Data Cash GmbH<br />
(Florsheim) vertreten waren. Zahlreiche<br />
Experten aus allen Bereichen des<br />
Handels informierten sich vom 7. bis<br />
9. November 2000 auf dieser „Fachmesse<br />
für Informations-, Kommunikations-<br />
und Sicherheitstechnik“. Preh<br />
präsentierte ausgewählte Produkte<br />
aus dem Bereich der POS-Datensysteme<br />
(„point of sale“), unter anderem<br />
„Touchscreens“, frei programmierbare<br />
Tastaturen sowie kompakte Kassen-PCs.<br />
Marketingfachmann Jürgen<br />
Jähnel: „Aufgrund der hohen Qualität<br />
der Kontakte wird Preh auf der nächsten<br />
,Retail Technology‘ im Februar<br />
2002 erneut vertreten sein.“
Seite 16 Aus den Unternehmensbereichen<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
„ProLine“-Entwicklung bei Heimann Systems<br />
Das neue Design setzt<br />
ergonomische Akzente<br />
Wiesbaden. Auf der Expo 2000 waren<br />
sie allgegenwärtig; ebenso sind<br />
sie es tagtäglich bei den Sicherheits-<br />
Checks des für die Olympischen Spiele<br />
aufgerüsteten Flughafens und an<br />
vielen Standorten in über 150 Ländern<br />
der Welt in Aktion: die Röntgenprüfsysteme<br />
der Heimann Systems GmbH.<br />
Das jüngste innovative Systemkonzept<br />
„ProLine“ des zur Aditron-Gruppe<br />
zählenden Unternehmens setzt einmal<br />
mehr Maßstäbe<br />
in der Röntgenprüftechnik.<br />
Es zeichnet sich<br />
durch moderne<br />
Bildbearbeitungsfunktionen,<br />
ein ergonomisch<br />
optimiertes Arbeitsumfeldsowie<br />
ein attrakti-<br />
ves Design aus.<br />
Das Wiesbadener<br />
Unternehmen wird damit seine Marktführerschaft<br />
in der Ausrüstung von<br />
Flughäfen mit Röntgenprüfanlagen zur<br />
Personen- und Gepäckkontrolle weiter<br />
ausbauen können. Doch nicht nur das<br />
System ist zukunftsweisend; auch die<br />
Entwicklung von „ProLine“ bot und<br />
bietet Impulse und Anregungen für die<br />
Zukunft.<br />
1996 veranlaßte der immer schärfer<br />
werdende Konkurrenzdruck – vor allem<br />
des amerikanischen Marktes –<br />
die Heimann Systems GmbH, bei der<br />
Produktentwicklung neue Wege zu gehen.<br />
Unter der Prämisse der Kostenersparnis<br />
wurde ein Projektteam gebildet,<br />
das zunächst eine umfassende<br />
Analyse zum Thema „Handgepäck-<br />
Röntgenprüfgeräte“ startete. „Bei einem<br />
Funktionszyklus der Geräte von<br />
sieben bis zehn Jahren war von Anfang<br />
an klar, daß bei der<br />
Produktentwicklung<br />
langfristige Gesichtspunkte<br />
und Überlegungen<br />
ins Kalkül gezogen<br />
werden mußten.<br />
Aus diesem<br />
Grund galt es, die<br />
Marktanforderungen<br />
der Zukunft zu benennen“,<br />
erklärt Stefan<br />
Aust, ProduktmanagerGepäckprüfsysteme<br />
bei Heimann Systems.<br />
In der Folge<br />
fand ein intensiver<br />
Austausch zwischen<br />
den Teammitgliedern<br />
von Heimann Systems<br />
und externen Stellen<br />
statt, der schließlich<br />
zu einer völlig neuen<br />
Gerätegeneration<br />
führte.<br />
„Zu Beginn setzten<br />
wir uns mit allen Be-<br />
Stefan Aust<br />
„Livescanner“ auch<br />
in UNIX-Version<br />
sm Jena. Die Heimann Biometric<br />
Systems GmbH (HBS/Jena), ein<br />
führender Hersteller von Systemen<br />
zur digitalen Erfassung von Fingerabdrücken,<br />
hat kürzlich die neue<br />
UNIX-fähige Version des bekannten<br />
„LSP1/P+ Livescanners“ präsentiert.<br />
UNIX ist ein Betriebssystem,<br />
das neben „Windows NT“ bei Erfassungsstationen<br />
von Finger- und<br />
Handabdrücken eingesetzt wird.<br />
Die UNIX-fähige Anlage von HBS<br />
ist speziell auf die Anforderungen<br />
der von Printrak International Inc.<br />
(Anaheim/USA) angebotenen automatischenFingerabdruck-Identifikationssysteme<br />
zugeschnitten.<br />
Die Schnittstellen-Treiber-Software<br />
wurde von Microsoft „Windows NT“<br />
auf das von Printrak benutzte Betriebssystem<br />
UNIX modifiziert, wobei<br />
alle Vorteile der HBS-Scanner-<br />
teiligten zusammen: Dieser Kreis umfaßte<br />
Vertreter der zuständigen Behörden,<br />
der Flughafenbetreiber sowie des<br />
Sicherheitspersonals als eigentliche<br />
Bediener. Im Rahmen dieser Gespräche<br />
konnten die unterschiedlichen<br />
Anforderungen und Vorstellungen<br />
der einzelnen Gruppen definiert<br />
werden“, beschreibt Aust die Anfänge<br />
der Projektarbeit.<br />
Parallel dazu erstellte die Forschungsgruppe<br />
„Streß“ des arbeitsmedizinischen<br />
„Instituts für arbeitsökologische<br />
Forschung und Beratung“<br />
der Universität Heidelberg im Auftrag<br />
von Heimann Systems eine Expertise<br />
über die „ergonomischen Anforderungen<br />
an Röntgen-Gepäckkontrollanlagen<br />
auf Flughäfen“. Die Studie unter<br />
der Leitung von Professor Horst Mayer<br />
zeigte Defizite in der Arbeitsplatzgestaltung<br />
auf – zum Beispiel die bis<br />
dato fehlende Armauflage oder der ungenügende<br />
Fußraum der angebotenen<br />
Standgehäuse. Als Konsequenz forderten<br />
die Heidelberger Experten ein<br />
individuell einstellbares System.<br />
„Die herkömmliche ergonomische<br />
Gestaltung der in den Flughäfen installierten<br />
Anlagen wies Gestaltungsmängel<br />
auf. Mit der Vereinheitlichung der<br />
Europäischen Regelwerke über Gesundheits-<br />
und Arbeitsschutz ist eine<br />
Situation eingetreten, die heutzutage<br />
eine ergonomische Umgestaltung des<br />
Arbeitsplatzes am Röntgen-Gepäckscanner<br />
unumgänglich macht“, beschreibt<br />
Aust die weitreichende Bedeutung<br />
des Forschungsauftrags.<br />
Unter dem im Investitionsgüterbereich<br />
wesentlichen Gesichtspunkt<br />
„Anlagendesign ist Funktionsdesign“<br />
wurden daraufhin externe Industriedesigner<br />
hinzugezogen, die neue Mög-<br />
Die neugestalteten Einzelkomponenten der „ProLine“-Reihe, mit denen die<br />
Handgepäck-Röntgenprüfsysteme ausgestattet werden können: links das Röntgengerät,<br />
auf der rechten Seite (von oben) die höhenverstellbare Stehhilfe, der<br />
höhenverstellbare Monitor und die ergonomisch optimierte Tastatur.<br />
Technologie beibehalten worden<br />
sind.<br />
„Wir sind sehr zufrieden, der Firma<br />
Printrak jetzt diese UNIX-Version zur<br />
Verfügung stellen zu können. Die<br />
Aufgabe war eine größere Herausforderung<br />
als ursprünglich erwartet,<br />
aber dank der guten und fruchtbaren<br />
Zusammenarbeit zwischen den Softwareteams<br />
beider Firmen wurden alle<br />
Probleme optimal gelöst“, faßt Dr.<br />
Bernd Reinhold, Geschäftsführer<br />
von HBS, zusammen: „Das Projekt<br />
ist ein weiterer Meilenstein auf dem<br />
Weg zur Entwicklung der modernsten<br />
‚Livescanner‘-Technologie für interessierte<br />
Anwender weltweit. Wir<br />
freuen uns, daß Printrak International<br />
und deren Kunden für ihre Erfassungsstationen<br />
jetzt das jeweils bevorzugte<br />
Betriebssystem – UNIX<br />
oder Windows – wählen können.<br />
Darüber hinaus eröffnen sich aufgrund<br />
der Kompatibilität des ‚Livescanners‘<br />
mit UNIX für unser Haus<br />
neue potentielle Kundenkreise“.<br />
Zertifizierung für<br />
Zukunftsprojekte<br />
rds Nova Odessa. Gelungener Projektabschluß<br />
mit Vorbildcharakter:<br />
Vor wenigen Wochen hat die KS Pistões<br />
Ltda., Tochtergesellschaft der<br />
KS Kolbenschmidt GmbH in Brasilien,<br />
als erste der zur Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe<br />
gehörenden Kolbenproduzenten<br />
außerhalb Deutschlands<br />
die Zertifizierung nach ISO<br />
14001 (Umwelt) und BS 8800 (Sicherheit<br />
am Arbeitsplatz) erfolgreich<br />
abgeschlossen. Das Unternehmen<br />
mit Sitz in Nova Odessa im Bundesstaat<br />
Sao Paulo, dessen 1250 Mitarbeiter<br />
in diesem Jahr rund 14 Millio-<br />
nen Kolben (neuer Rekord!) produzieren<br />
werden, setzt damit erneut<br />
Akzente, die vor allem auch das<br />
zukünftige Geschäft erfolgreich beeinflussen<br />
werden. Geschäftsführer<br />
Americo Rajczy: „Mit dieser Zertifizierung<br />
ist unsere Firma für die Zukunft<br />
gut gerüstet, da wir damit bereits jetzt<br />
eine Kundenforderung erfüllt haben,<br />
die ab 2001/2002 eine Voraussetzung<br />
für die Vergabe von neuen Aufträgen<br />
sein wird. Gerade in Brasilien<br />
hat diese Zertifizierung einen beispielhaften<br />
Charakter; außerdem erhöht<br />
sie das Ansehen der deutschen<br />
Industrie im Lande.“<br />
Die in Nova Odessa auf modernsten<br />
Fertigungseinrichtungen hergestellten<br />
Kolben werden rund um den Glo-<br />
bus nachgefragt: Etwa 70 Prozent der<br />
Produktion gehen in den Export (z.B.<br />
nach Europa, in die USA, nach Mexiko<br />
und Australien). Und das in einer<br />
Qualität, die der Markt nicht nur mit<br />
entsprechenden Umsatzzahlen honoriert:<br />
Zusätzlich zu der vom weltgrößten<br />
Automobilhersteller General Motors<br />
verliehenen „Supplier of the<br />
Year“-Auszeichnung für 1999 („Das<br />
<strong>Profil</strong>” 4/2000) konnte KS Pistões im<br />
laufenden Geschäftsjahr bereits Qualitätsauszeichnungen<br />
von den langjährigen<br />
Kunden VW do Brasil und<br />
Maxion International verbuchen. Die<br />
Firma Maxion (Joint Venture mit International<br />
Inc./USA) ist ein bekannter<br />
Dieselmotorenhersteller mit Sitz in<br />
Pôrto Alegre im Süden Brasiliens.<br />
Das „ProLine“-Systemkonzept von Heimann Systems: Das flexible Modularsystem zur ergonomisch optimierten Arbeitsplatzgestaltung<br />
in Sicherheitskontrollbereichen für Handgepäck verzeichnet weltweit eine außerordentliche Marktakzeptanz.<br />
lichkeiten zur optisch ansprechenderen<br />
Gestaltung und zur Flexibilisierung<br />
des Systems entwarfen. „Obwohl<br />
nicht alle Vorschläge realisierbar waren,<br />
erscheint ‚ProLine‘ doch in einem<br />
völlig neuen, modernen Design. Die<br />
Form der Tastatur ist den Bedürfnissen<br />
der Bediener nachempfunden. Zusätzlich<br />
verändert die<br />
progressive Farbgebung<br />
das Erscheinungsbild<br />
des Systems nachhaltig“,<br />
faßt Aust<br />
kurz einige Veränderungenzusammen.<br />
Die gute Zusammenarbeit<br />
der<br />
Teammitglieder sowohl<br />
untereinander<br />
als auch mit den<br />
externen Experten<br />
förderte die Kreativität<br />
im Ganzen.<br />
„Wir konnten eigenverantwortlich<br />
und ohne Zeitdruck<br />
innovative Ideen<br />
einbringen und<br />
entwickeln. Das Resultat<br />
ist ein zukunftsorientiertes<br />
Modular-System“,<br />
so Aust über die fruchtbare Projektarbeit.<br />
Die in dieser Art erstmalig durchgeführte<br />
Produktentwicklung führte zu<br />
einer innovativen Komplettlösung, die<br />
alle in der Expertise angesprochenen<br />
Faktoren – zum Beispiel Arbeitsorganisation,<br />
Betriebsstättenarchitektur und<br />
Personaleinsatzpläne – berücksichtigt<br />
und die sich als baukastenartiges System<br />
individuell nach Kundenwünschen<br />
zusammenstellen läßt.<br />
Die neue bedienergerechte Gestaltung<br />
des Arbeitsumfeldes mit Hilfe von<br />
„ProLine“ hat einen direkten Einfluß auf<br />
die Qualität der Sicherheitskontrolle.<br />
„Durch das höhere Gepäckaufkommen<br />
aufgrund steigender Passagierzahlen<br />
verstärkt sich der psychologische Druck<br />
auf das Sicherheitspersonal. Der Bediener<br />
des Gerätes muß innerhalb von<br />
wenigen Sekunden entscheiden, ob<br />
das Röntgenbild des durchleuchteten<br />
Gepäckstücks eine Gefahr aufweist<br />
oder nicht“, betont Aust nochmals die<br />
Notwendigkeit, den „Faktor Mensch“<br />
bei der Arbeitsplatzdefinition konsequent<br />
zu berücksichtigen.<br />
Aus diesem Grund war die optimale<br />
Unterstützung des Sicherheitspersonals<br />
bei der Entscheidungsfindung ein<br />
wesentliches Kriterium während der<br />
Produktentwicklung. Die unterschiedlichen<br />
Einsatzbereiche und die rotierende<br />
Arbeitsplatzbesetzung erforderten<br />
eine größere Flexibilität der Anlage und<br />
die Möglichkeit, den Arbeitsplatz an die<br />
jeweiligen persönlichen Gegebenheiten<br />
anzupassen. Dies ist durch die elektrische<br />
Hubeinheit zur schnellen, individuellen<br />
Höhenanpassung des Bedienplatzes<br />
sowie die verstellbare Stehhilfe<br />
zur Unterstützung einer rückenentlastenden<br />
Arbeitshaltung gewährleistet.<br />
In diesem Sinne unterstützend wirkt<br />
auch die hochmoderne „HiTraX“-Systemtechnologie<br />
mit völlig neuartigen<br />
„Online“-Bildanalyseverfahren; ein<br />
weiterer Zusatzeffekt ist die erhebliche<br />
Reduzierung der Prüfzeiten.<br />
Die innovative Technik und der hohe<br />
Zuverlässigkeitsgrad machen das<br />
„ProLine“-System zu einem exzellenten<br />
Arbeitsmittel für den Einsatz in<br />
Überwachungsbereichen mit erhöhtem<br />
Sicherheitsbedarf. Inzwischen<br />
sind rund ein Viertel der von Heimann<br />
Systems verkauften Handgepäck-<br />
Röntgenprüfanlagen mit diesen Optionen<br />
zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung<br />
ausgestattet, mit steigender<br />
Tendenz. Abschließend fügt Aust<br />
hinzu: „Heimann Systems ist mit der<br />
Gerätegeneration ‚ProLine‘ eine zukunftsweisende<br />
Entwicklung gelungen,<br />
die am 21. Juni 2000 vom Deutschen<br />
Patentamt in München mit der<br />
Patenterteilung belohnt wurde.“<br />
Sonja Marx<br />
MESSEPREMIERE FÜR MODERNE FERTIGUNGSKONZEPTE: Mit zwei Systemneuheiten präsentierte sich der<br />
Preh-Produktbereich „Industrieausrüstungen“ (PIA) unlängst auf der „Motek 2000“ in Sinsheim einmal mehr von seiner<br />
innovativ-kreativen Seite. Zum einen stellten die Anlagenexperten aus Bad Neustadt das hochflexible Montage- und Logistiksystem<br />
„PIAflex“ (Foto links) vor, dessen standardisierte Systembauteile eine außerordentlich flexible und damit besonders<br />
wirtschaftliche Produktion erlauben – einschließlich der Möglichkeit zur „chaotischen“ Fertigung, bei der gleichzeitig<br />
unterschiedliche Varianten eines Produktes produziert werden. Zum anderen stellte Preh das neue Standard-Palettierkonzept<br />
„PIApal“ (Foto rechts) vor; mit diesem System können – neben herkömmlichen Bauteilen – insbesondere schwer zuführbare<br />
oder beschädigungsanfällige Werkstücke über Paletten lagerichtig zugeführt, entsorgt oder zwischengelagert werden.
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Aus den Unternehmensbereichen<br />
Seite 17<br />
Die Auftragsbearbeitung der Panzerhaubitze 2000, die Kampfwertsteigerung des „Leopard 2 A5“ sowie die Langzeitlagerung und Reparatur bereits genutzter Systeme gehören zum aktuellen Aufgabenspektrum<br />
des 44 Mitarbeiter starken Teams der Rheinmetall Landsysteme GmbH in Unterlüß. Einen Einblick in die tägliche Arbeit der Fachleute um Teamleiter Harry Kuhlmann geben die Fotos auf dieser „<strong>Profil</strong>“-Seite.<br />
Fachkundiges Team bürgt für Qualität bei der Serienfertigung, bei Maßnahmen zur Kampfwertsteigerung und bei Umrüstungen<br />
Seit mehr als 20 Jahren kommen Turmsysteme aus Unterlüß<br />
Unterlüß. Seit mehr als 20 Jahren ist<br />
die „Leopard“-Fertigung der (heutigen)<br />
Rheinmetall Landsysteme GmbH<br />
in Unterlüß angesiedelt. In diesem<br />
Zeitraum wurden mehr als 2000 Turmsysteme<br />
für den „Leopard 1“ und den<br />
„Leopard 2“ gefertigt und als komplettes<br />
Waffensystem ausgeliefert. Auftraggeber<br />
waren bzw. sind – neben<br />
der Bundeswehr – auch unterschiedliche<br />
Nato-Partner, zum Beispiel Dänemark,<br />
die Niederlande, Spanien,<br />
Österreich, die Türkei und Schweden.<br />
Ein hochqualifiziertes Team von Mitarbeitern<br />
sorgt für hohe Qualität in der<br />
Serienfertigung, bei Maßnahmen der<br />
Kampfwertsteigerung und bei Umrüstungen<br />
vorhandener Systeme.<br />
1977 wurde der erste Spatenstich für<br />
die Halle 395 gesetzt, in der heute<br />
noch gearbeitet wird. In diesem Bereich<br />
wurden zwischen 1979 und 1990<br />
unter anderen 926 Turmsysteme „Leopard<br />
2 A4“ für die Bundeswehr sowie<br />
parallel (1982 – 1986) 198 Türme des<br />
gleichen Bautyps für die niederländische<br />
Armee fertiggestellt. 168 Turmsystem-Umrüstungen<br />
und Maßnahmen<br />
zur Kampfwertsteigerung rundeten<br />
zwischen 1984 und 1987 den Gesamtauftrag<br />
für den „Leopard 2 A4“<br />
ab. Nach weiteren 34 Turmsystemen<br />
für diesen Panzer, die zwischen 1990<br />
und 1992 in Produktion gingen, wurde<br />
schließlich die Serienfertigung des<br />
„Leopard 2 A4“ in Unterlüß beendet.<br />
Das bisher letzte Großprojekt über<br />
520 Turmsysteme „Leopard 1 A5“ wurde<br />
in der Zeit von 1987 bis 1993 in Halle<br />
395 gefertigt. Eine wesentliche For-<br />
derung der Auftraggeberseite war in<br />
diesem Zusammenhang, die Führbarkeit<br />
des Gesamtsystems durch Maßnahmen<br />
der Kampfwertsteigerung zu<br />
optimieren. Unter anderem wurde die<br />
hydraulische Anlage modifiziert, um eine<br />
bessere Steuer-und Regelungsfunktion<br />
zu erhalten. Des weiteren wurde<br />
ein neu entwickelter Entfernungsmesser<br />
mit Wärmebildgerät integriert.<br />
Zwei weitere Projekte sicherten in<br />
der ersten Hälfte der neunziger Jahre<br />
des 20. Jahrhunderts die Auslastung<br />
der Fertigungsstätte in Unterlüß: Es<br />
handelte sich um 60 Turmsysteme für<br />
den „Leopard 1 A3“, deklariert als Rüstungssonderhilfe<br />
für die Türkei (1990<br />
–1991), sowie 123 „Leopard 1 A5“-<br />
Turmsysteme für die dänischen Streitkräfte<br />
(gefertigt von 1992 bis 1994).<br />
Unter dem bereits erwähnten Begriff<br />
der Kampfwertsteigerungsmaßnahmen<br />
(KWS I und KWS II) versteht man<br />
die Integration von neuen Techniken<br />
und Technologien zur Stärkung der<br />
Kampfkraft des Systems. Während bei<br />
der KWS II die Verbesserung der Führbarkeit<br />
des Waffensystems im Vordergrund<br />
stand, wird bei der aktuell laufenden<br />
KWS I die Kampfkraft durch eine<br />
Verlängerung des Rohres verstärkt:<br />
Das Rohr der 120mm-Glattrohrkanone<br />
wird um 130 Zentimeter verlängert;<br />
dies führt zu einer höheren Geschoßgeschwindigkeit<br />
und einer gesteigerten<br />
Wirkung der KE-Munition. Beschlossen<br />
wurden diese Maßnahmen<br />
zur Kampfwertsteigerung in der sogenannten<br />
„Mannheimer Konfiguration“,<br />
bei der sich der Bund und die ver-<br />
schiedenen Rüstungsgremien am runden<br />
Tisch zusammensetzten, um Verbesserungen<br />
am bestehenden Waffensystem<br />
vorzunehmen.<br />
Zur Zeit ist das in diesem Bereich<br />
engagierte, 44 Mitarbeiter umfassende<br />
Team der Rheinmetall-Landsysteme<br />
mit der Auftragsbearbeitung der<br />
Panzerhaubitze 2000, der Kampfwertsteigerung<br />
des „Leopard 2 A5“<br />
sowie der Langzeitlagerung und Reparatur<br />
bereits genutzter Systeme beschäftigt.<br />
Das fachkundige Team wird<br />
geleitet von Harry Kuhlmann und<br />
setzt sich aus Elektro-Ingenieuren,<br />
Maschinenschlossern, Fernsehtechnikern,<br />
Elektronikern, Meistern sowie<br />
Disponenten, Planern und Lagermitarbeitern<br />
zusammen.<br />
Sebastian Ortmann
Seite 18 Aus den Unternehmensbereichen<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
In einem spannenden Finale bezwangen die Kicker der Preh-Werke die Mannschaft der Rheinmetall W&M GmbH mit 1:0.<br />
Das Siegtor schoß Michael Link (vorne sitzend, 7.v.r.). Hier sind beide Teams mit ihren Betreuern Egon Friedel (Preh – 2.v.l.<br />
stehend) und Ralf Schiel (Rheinmetall – 5.v.r. stehend) zu sehen. Daß die 135 Aktiven sowie zahlreiche Zuschauer mit Spaß<br />
und Engagement beim 23. Fußballturnier der Rheinmetall <strong>AG</strong> dabei waren, zeigen die Bilder auf dieser Seite.<br />
23. Fußballturnier der Rheinmetall <strong>AG</strong> in Wiesbaden<br />
Spannende Spiele bei<br />
schönem Herbstwetter<br />
jd Wiesbaden. Die Hobbykicker der<br />
Preh-Werke GmbH & Co. KG aus Bad<br />
Neustadt haben kürzlich das 23. Fußballturnier<br />
der Rheinmetall <strong>AG</strong> in Wiesbaden<br />
gewonnen. Durch einen geschickten<br />
„Schlenzer ins lange Eck“ erzielte<br />
Mittelstürmer Michael Link den<br />
Siegtreffer im Finale gegen die Spieler<br />
der Rheinmetall W&M GmbH aus Unterlüß.<br />
Das Spiel um den Turniersieg<br />
war am 14. Oktober 2000 der Höhepunkt<br />
eines langen Tages mit spannenden<br />
Spielen bei herbstlich schönem<br />
Fußballwetter. Ein Tag im übrigen,<br />
an den sich der glückliche Preh-Mittelstürmer<br />
noch des öfteren gerne erinnern<br />
wird: „Es ist immer etwas Besonderes,<br />
wenn man ins Endspiel kommt<br />
und dann auch noch das entscheidende<br />
Tor schießt. Das ist einfach ein<br />
schönes Gefühl.“<br />
Bereits am Abend vor dem Turnier<br />
trafen die Reisebusse mit den insgesamt<br />
135 Fußballern der neun Mannschaften<br />
samt ihren Betreuern in Wiesbaden<br />
ein. Mit rund 600 Kilometern<br />
hatte das Team der Rheinmetall Landsysteme<br />
GmbH in Kiel die längste Anreise<br />
hinter sich.<br />
Im Vorfeld leisteten die Organisatoren<br />
ganze Arbeit. Dieter Seidelmann –<br />
Spielertrainer des knapp im Halbfinale<br />
gescheiterten Gastgebers Heimann<br />
Systems GmbH und zweiter Turnierleiter<br />
– knüpfte den Kontakt zum VfR<br />
Wiesbaden, der die Nutzung der Anlage<br />
auf der Steinberger Straße im Stadtteil<br />
Biebrich ermöglichte. Ausdrücklich<br />
würdigt der routinierte Fußballer – Seidelmann<br />
selbst spielt in der ersten<br />
Mannschaft und ist zudem Jugendtrainer<br />
beim VfR Wiesbaden – die Unterstützung<br />
durch seinen Verein: „Ohne<br />
die tatkräftige Hilfe der rund 20 Eltern<br />
und Helfer aus der Jugendabteilung<br />
wäre das Turnier gar nicht möglich gewesen.“<br />
So wurden beispielsweise alle<br />
Sportler mit Mittagessen und Getränken<br />
versorgt.<br />
Von der vielen Arbeit rund um das<br />
Turnier spürten die Aktiven jedoch<br />
kaum etwas. Bei ihnen stand stattdessen<br />
das – selbstredend auch schweißtreibende<br />
– sportliche Engagement im<br />
Vordergrund. So waren beispielsweise<br />
die Halbfinal-Spiele sehr spannend<br />
und durch fairen Einsatz geprägt. Wieder<br />
einmal Pech hatten die Kicker der<br />
Pierburg <strong>AG</strong> vom Standort Neuss. Wie<br />
schon eine Woche zuvor als gastgebende<br />
Mannschaft beim 5. Internationalen<br />
Fußballturnier um den „Europacup<br />
2000“ der Kolbenschmidt-Pier-<br />
burg-Gruppe in Neuss („Das <strong>Profil</strong>“<br />
4/2000) endete das Halbfinal-Match<br />
nach regulärer Spielzeit torlos unentschieden.<br />
Erneut mußte mittels Elfmeterschießen<br />
über den Finaleinzug entschieden<br />
werden – und wieder zogen<br />
die Neusser den „Kürzeren“, diesmal<br />
mit 3:4 Toren gegen die Mannschaft<br />
der Rheinmetall W&M GmbH aus Unterlüß,<br />
dem späteren Turnierzweiten.<br />
Auch das 2. Halbfinale hatte es in<br />
sich. Nach einem schnellen 0:1 Rückstand<br />
im Spiel gegen die Mannschaft<br />
der Preh-Werke GmbH & Co. KG leitete<br />
Dieter Seidelmann – Offensivspieler<br />
der gastgebenden Mannschaft Heimann<br />
Systems GmbH – mit vorbildlichem<br />
Einsatz und herausragendem<br />
technischen Können immer wieder<br />
neue Angriffe auf das gegnerische Tor<br />
ein. Trotz einiger guter Möglichkeiten,<br />
selbst zum Torerfolg zu kommen, gelang<br />
es dem Gastgeber jedoch nicht,<br />
den frühen Rückstand aufzuholen.<br />
Durch einen schnellen Konter stellte<br />
der spätere Turniersieger schließlich<br />
sogar den 2:0 Endstand her und zog<br />
somit ins Finale ein.<br />
Im „kleinen“ Finale um den 3. Platz<br />
wurde dann spontan auf ein reguläres<br />
Spiel verzichtet und direkt ein Elfmeterschießen<br />
ausgetragen. Mit 5:3 Toren<br />
war die Mannschaft der Pierburg <strong>AG</strong><br />
(Standort Neuss) siegreich und beendete<br />
damit auch ihr „Elfmeter-Trauma“.<br />
Alle neun teilnehmenden Mannschaften<br />
auf einen Blick: Heimann Systems<br />
GmbH, Rheinmetall Landsysteme<br />
GmbH, Pierburg <strong>AG</strong> (Standort<br />
Neuss), Lemo Maschinenbau GmbH,<br />
STN Atlas Elektronik GmbH, Rheinmetall<br />
W&M GmbH, Preh-Werke GmbH &<br />
Co. KG, Pierburg <strong>AG</strong> (Standort Nettetal)<br />
und Hirschmann Electronics GmbH &<br />
Co. KG.<br />
Kuriosität am Rande: Die Kicker der<br />
Rheinmetall W&M GmbH mußten im Finale<br />
zwei Spieler von der Mannschaft<br />
der Pierburg <strong>AG</strong> vom Standort Nettetal<br />
„ausleihen“, weil sie nur neun eigene<br />
Mannen bereitstellen konnten. Die<br />
gern gegebene Unterstützung war ein<br />
sichtbares Zeichen dafür, daß eine<br />
sehr lockere Atmosphäre unter den Aktiven<br />
herrschte. Friedhelm Henzel, Betriebsratsvorsitzender<br />
der Heimann Systems<br />
GmbH und Turnierleiter, brachte<br />
es auf den Punkt: „Ein derartiges Turnier<br />
stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl<br />
unter den Spielern aller teilnehmenden<br />
Mannschaften enorm; außerdem<br />
lernt man auch viele Kollegen von<br />
einer ganz neuen Seite kennen.“
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Die Reportage<br />
Seite 19<br />
Vom 29. September bis 3. Oktober 2000 nutzten 15 Journalisten renommierter europäischer Tages- und Fachzeitungen die Gelegenheit, sich im Rahmen eines Pressekolloquiums<br />
mit den Aktivitäten der Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe in Nordamerika vertraut zu machen („Das <strong>Profil</strong>“ 4/2000). Auf dem dichtgepackten Besuchsprogramm<br />
standen u.a. Visiten der Pierburg Inc. in Fountain Inn/Greenville (US-Bundesstaat South Carolina) und der Karl Schmidt Unisia Inc. in Marinette (Wisconsin). Einer der<br />
Reiseteilnehmer war Christian Bartsch (72), der für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die in Bern erscheinende „Automobil Revue“ berichtete.<br />
Bartsch, der im folgenden Beitrag für die Rheinmetall-Konzernzeitung „Das <strong>Profil</strong>“ seine Eindrücke von den erfolgreichen unternehmerischen Anstrengungen<br />
der Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe in den USA schildert, gilt als ausgewiesener Kenner der Materie: Nach Schulbesuch und Lehre als Autoschlosser<br />
studierte der in Klein-Polkwitz (Niederschlesien) geborene „Automotive“-Fachmann Maschinenbau in Dresden und Berlin; anschließend war<br />
er vier Jahre in der Entwicklung von Zweitaktmotoren tätig, danach mehrere Jahre in der industriellen Meß- und Regeltechnik. 1961 folgte der Wechsel zur<br />
„Motor-Rundschau“ (Frankfurt am Main) als technischer Redakteur; seit 1970 arbeitet Bartsch als freier Journalist, Buchautor und Berater namhafter deutscher<br />
Unternehmen, vornehmlich aus der Automobilindustrie. Das persönliche Reise-Fazit des heute in Dieburg lebenden Fachredakteurs: „Wir Journalisten<br />
haben bei diesem kurzen Ausflug in die USA den ‚anderen Teil‘ von Kolbenschmidt-Pierburg kennengelernt, der mithelfen wird, daß die Zukunft des<br />
ganzen Unternehmens in sicheren Bahnen verläuft. Die Firmengruppe ist dabei, die ‚neue Welt‘ zu erobern – zumindest deren automobilen Teil. Und wir<br />
Christian Bartsch haben gehört, welche zukünftigen Entwicklungen die Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe anpacken wird. An Arbeit ist wahrhaftig kein Mangel!“ dp<br />
Kolbenschmidt-Pierburg in den USA: Erfolge mit deutscher Technik<br />
Mit viel Umsicht in die „Neue Welt“<br />
Greenville/Marinette. Wer von den<br />
USA spricht, meint meist Florida, vielleicht<br />
auch New York, auf jeden Fall<br />
Hollywood und Los Angeles. Der letzte<br />
Krieg in den USA, nämlich jener der<br />
Nord- gegen die Südstaaten, ist auch<br />
uns geläufig und Karl Mays Winnetou<br />
als verklärtes Symbol der Ureinwohner,<br />
der Indianer. Aber Kolbenschmidt-<br />
Pierburg? Was haben die mit den USA<br />
zu tun? Um die Antwort vorweg zu<br />
nehmen: Sehr viel – und künftig noch<br />
mehr! Was hier folgt, sind Eindrücke<br />
von einer Kurzreise ins Land der „unbegrenzten<br />
Möglichkeiten“.<br />
„Was Sie dort sehen“, schmunzelt<br />
Dr. Dieter Seipler, „sind alles potentielle<br />
Kunden für uns.“ Damit meinte<br />
er die großvolumigen amerikanischen<br />
Limousinen, Pickups und SUV’s („special<br />
utility vehicles“) auf einer belebten<br />
Stadtstraße. Einige davon fahren<br />
bereits mit Kolben von Kolbenschmidt<br />
aus der Gemeinschaftsfertigung mit<br />
Unisia JECS, einem japanischen Kolbenhersteller.<br />
Andere wieder sind mit<br />
Pierburg-Geräten ausgerüstet. „Aber<br />
noch viel zu wenig“, meint Seipler.<br />
„Doch das wird sich in den nächsten<br />
Jahren ändern, schließlich sind wir auf<br />
dem US-Markt erst seit 1996 mit eigener<br />
Fertigung präsent.“ Für die kurze<br />
Zeitspanne wurde jedoch enorm viel<br />
erreicht.<br />
Im Jahr 1995 beschloß der Vorstand<br />
der Pierburg <strong>AG</strong> die Errichtung eines<br />
Fertigungsbetriebes bei Greenville in<br />
South Carolina im Südosten der USA.<br />
Für die Ortswahl gab es viele Gründe,<br />
vor allem die Nähe zu BMW im benachbarten<br />
Spartanburg, zu Daimler-<br />
Chrysler in Alabama und vor allem zu<br />
VW in Mexiko. Die Infrastruktur an diesem<br />
Standort ist hervorragend ausgebaut,<br />
zudem half der Staat South Carolina<br />
mit steuerlichen Anreizen und bei<br />
der Ausbildung der ersten Mitarbeiter.<br />
„Wir mußten ihnen zunächst das<br />
metrische System beibringen“, erzählt<br />
Willy Ruefenacht, Präsident der Pierburg<br />
Inc. Zwar wurde das metrische<br />
System schon vor über drei Jahrzehnten<br />
in den USA eingeführt, doch bei<br />
der Absichtserklärung blieb es weitgehend.<br />
Entfernungen werden noch immer<br />
in „miles“ gemessen, die sich auf<br />
Straßenschildern und Tachometern<br />
finden. Auch im Alltag sind die „inches“<br />
anstelle der Millimeter so wenig<br />
ausgestorben wie andere Begriffe aus<br />
dem Zoll-Zeitalter.<br />
Am 1. August 1996 verließen die ersten<br />
Benzinmodule die neue Fabrik in<br />
Greenville – und am Jahresende hatte<br />
das Unternehmen zwei Millionen<br />
Dollar umgesetzt. Heute ist es bei 30<br />
Millionen Dollar angelangt, mit weiter<br />
steigender Tendenz. Mit ganzen vier<br />
Produkten hatte man begonnen, heute<br />
sind es 35. Ruefenacht ist zuversichtlich,<br />
daß der Umsatz innerhalb<br />
der nächsten vier bis fünf Jahre verdoppelt<br />
werden kann. Denn als Kunden<br />
gewann die Pierburg Inc. inzwischen<br />
auch General Motors (GM) und<br />
Ford. Und zwar gegen zahlreiche Konkurrenten.<br />
In der nächsten Zeit wird<br />
die Fertigung von Drosselklappenstutzen<br />
sowie Öl- und Wasserpumpen aufgenommen.<br />
Von den Drosselklappenstutzen<br />
soll Pierburg allein an GM<br />
zunächst 800 000 Stück pro Jahr liefern.<br />
Weitere Komponenten werden<br />
hinzukommen.<br />
Die Technik für alle Bauteile kam<br />
zunächst aus Deutschland, das auch<br />
künftig Entwicklungszentrum bleiben<br />
wird. Kolbenschmidt-Pierburg baut<br />
jedoch gegenwärtig die amerikanischen<br />
Entwicklungszentren in Fort<br />
Wayne und in Auburn Hills nahe Detroit<br />
auf, um die US-Automobilhersteller<br />
schneller bedienen zu können. Die<br />
ersten Bauteile kamen vollständig aus<br />
Deutschland, heute nur noch etwa 50<br />
Prozent davon, die andere Hälfte wird<br />
in den USA hergestellt. Dazu zog Pierburg<br />
seine Zulieferer wie Alfmeier,<br />
Mikron, Friedrichs + Rath, Norma und<br />
andere hinüber in die USA, um auch<br />
weiterhin höchste Qualität liefern zu<br />
können.<br />
Michael Thiery, der von Pierburg in<br />
die USA geschickt worden war und inzwischen<br />
wieder nach Deutschland<br />
zurückkehrte, berichtet von den sehr<br />
unterschiedlichen Ansichten über<br />
technische Entwicklungen in Deutschland<br />
und in den USA. Stetige vorausschauende<br />
Entwicklung, wie sie in<br />
Deutschland dominiere, sei in den<br />
USA weniger ausgeprägt. Es gab kurzfristige<br />
Entwicklungsschübe, wenn<br />
ein neuer Motor oder andere Komponenten<br />
des Autos entwickelt werden<br />
sollten. Das neue Produkt wurde<br />
sodann auf Herz und Nieren geprüft,<br />
wobei sich die US-Hersteller sehr<br />
großer Vorserien bedienten, die in<br />
Deutschland nicht üblich sind. Anschließend<br />
wurde das Produkt möglichst<br />
lange unverändert gebaut.<br />
„Zur Ermittlung von Schwachstellen<br />
bedienen wir uns der Fehleranalyse<br />
und führen auch Belastungsproben<br />
wie Dauerläufe mit wenigen Stücken<br />
durch. Die Amerikaner verlangen vor<br />
Serienbeginn die Erprobung von<br />
1000 Bauteilen und finden hier Fehler<br />
heraus – ein für uns ziemlich teures<br />
Vergnügen“, erzählt Thiery. „Wir<br />
werden die beiden Systeme kombinieren,<br />
um die Fehlerquote noch<br />
weiter gegen Null zu drücken.“ Ein<br />
nächster Schritt dazu wäre die weitere<br />
Automatisierung der Produk-<br />
Nahm im Spätsommer 1996 die Produktion auf: das Werk der Pierburg Inc. in Fountain Inn/Greenville (South Carolina).<br />
tion, um die Qualiät in den USA wie<br />
die in Deutschland zu sichern.<br />
Noch ist es nicht soweit. Gegenwärtig<br />
arbeitet Pierburg in Greenville<br />
mit 120 Mitarbeitern, 80 Prozent davon<br />
sind Frauen. Das Durchschnittsalter<br />
beträgt 36 Jahre. Rechnet man in<br />
Deutschland pro Mitarbeiter mit mindestens<br />
fünf Prozent Fehlstunden pro<br />
Jahr, liegt die Quote in den USA unter<br />
eins. Wird in Deutschland im Mittel an<br />
210 Tagen im Jahr gearbeitet, so sind<br />
Rosa Lee, seit August 1998 Mitarbeiterin der Pierburg Inc. in Greenville (South<br />
Carolina), am Funktionsprüfstand der „Linie 3“. Hier werden gerade Kraftstofftankmodule<br />
für den Kunden Daimler/Chrysler getestet.<br />
es in den USA 249 Tage – ein kompletter<br />
Produktionsmonat mehr. „Unsere<br />
Mitarbeiter sind hochmotiviert“, erzählt<br />
Willy Ruefenacht. Rund 90 Prozent<br />
aller Amerikaner haben übrigens<br />
keinen Reisepaß, waren also auch<br />
noch nie im Ausland<br />
– bei der<br />
Weite des Landes<br />
kein Wunder.<br />
„Aber auch der<br />
Bildungsstand<br />
der Menschen<br />
hier ist einfacher“,<br />
fährt Ruefenacht<br />
fort. „Hinzu<br />
kommt, daß<br />
das deutsche<br />
Ausbildungssystem<br />
(Lehrling, Geselle, Meister) unbekannt<br />
ist. Wir haben es entweder<br />
mit Ungelernten oder mit Hochschulabgängern<br />
zu tun.“<br />
Aus dem hochsommerlich warmen<br />
Greenville ging es mit dem Flugzeug<br />
über Chicago nach Marinette, das im<br />
Norden der USA an einem Seitenarm<br />
des Michigan-Sees liegt. Hier gründete<br />
Kolbenschmidt zusammen mit der japanischen<br />
Unisia im Jahr 1990 eine<br />
Produktionsstätte für Kolben, die sich<br />
Willy Ruefenacht Frank Pohlmann<br />
Rund 50000 Kolben verlassen täglich die Fertigungsstätten der Karl Schmidt Unisia Inc. in Marinette im US-Bundesstaat Wisconsin.<br />
inzwischen zur wohl größten Kolbenfabrik<br />
der Welt entwickelte. Durch den<br />
Erwerb des amerikanischen Herstellers<br />
Zollner ist Kolbenschmidt auf dem<br />
US-Markt der größte Kolbenhersteller<br />
und liegt beim weltweiten Vergleich<br />
auf dem zweiten<br />
Platz. Frank Pohlmann,<br />
Präsident<br />
der Karl Schmidt<br />
Unisia Inc. (KUS)<br />
in Marinette, berichtet,<br />
daß es in<br />
der Welt nur noch<br />
drei große Kolbenhersteller<br />
gibt. Die kleineren<br />
wurden entweder<br />
aufgekauft<br />
oder verschwanden vom Markt. Kolbenschmidt-Pierburg<br />
habe eine<br />
hervorragende Ausgangsposition und<br />
vor allem den Willen zu weiterem<br />
Wachstum.<br />
Derzeit liefert die KUS in Marinette<br />
täglich 50 000 Kolben. Weitere 40 000<br />
Kolben werden in Fort Wayne hergestellt,<br />
10 000 in einer kanadischen Kolbenschmidt-Fabrik.<br />
Das heißt, man<br />
fertigt allein auf dem nordamerikanischen<br />
Kontinent rund 100 000 Kolben<br />
pro Tag (!). Zu den<br />
Kunden zählen<br />
alle Motorenhersteller<br />
der USA,<br />
von Harley-Davidson,<br />
für die KUS<br />
Alleinlieferant ist,<br />
über die Bootsmotoren<br />
von<br />
OMC und alle Automobilhersteller<br />
bis zu großen<br />
Dieselmotoren.<br />
Interessant ist,<br />
daß GM, Ford<br />
und Daimler-<br />
Chrysler bisher<br />
noch etwa 27 Prozent<br />
ihrer Kolben<br />
selbst fertigen –<br />
streng verfolgt<br />
von den Gewerkschaften,<br />
die darauf<br />
dringen, daß<br />
(Fortsetzung S. 20)
Seite 20 Die Reportage/Aus den Unternehmensbereichen<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
„Certified Machine Operator“ Bonnie Dobbin, seit 1986 bei der Karl Schmidt Unisia<br />
Inc. (KUS) in Marinette beschäftigt, in der automatischen Kolben-Endkontrolle<br />
für das General-Motors-Modell „Saturn“. Dobbins Ehegatte Kevin arbeitet übrigens<br />
ebenfalls bei KUS.<br />
Kolbenschmidt-Pierburg in den USA<br />
Mit viel Umsicht in . . .<br />
(Fortsetzung von Seite 19)<br />
keiner der dort Beschäftigten seinen<br />
Job verliert. Auf die Dauer ein unhaltbarer<br />
Zustand, weil nur Spezialunternehmen<br />
wie Kolbenschmidt-Pierburg<br />
in der Lage sind, die notwendige Vorausentwicklung<br />
zu betreiben. Das ist<br />
ja der Grund, warum die deutschen<br />
Automobilhersteller seit etwa 25 Jahren<br />
einen immer größeren Teil ihrer<br />
Fertigung und Entwicklung auf die Zulieferer<br />
übertrugen, die längst auch eigene<br />
Forschung betreiben.<br />
Marinette empfing uns mit kühlem<br />
Wetter und herbstlich bunt gefärbten<br />
Blättern an den Bäumen, obwohl der<br />
„Indian Summer“ erst etwa 14 Tage<br />
später erwartet wurde – und dem einzigen<br />
Hotel am Platz. Umso eindrucksvoller<br />
war das, was Frank Pohlmann<br />
und sein Stellvertreter Richard Dishaw<br />
– zugleich Leiter der Entwicklung der<br />
KUS – zu bieten hatten. So ist auch bei<br />
den Kolben der Trend fort von den<br />
Bauteil- zur Modullieferung nicht aufzuhalten.<br />
Zwar wird noch ein Teil der<br />
Kolben ohne Ringe an die Kunden geliefert,<br />
doch fordern GM und Ford bereits<br />
Module, die den Kolben mit Ringen,<br />
Bolzen und dem Pleuel umfassen.<br />
Da Kolbenschmidt in Neckarsulm<br />
auch Motorblöcke gießt, ist der Weg<br />
zum Rumpfmotor nicht mehr weit, zu<br />
dem Pierburg zahlreiche andere Komponenten<br />
bis hin zu Saugrohrmodulen<br />
beisteuern kann. Aus dem Rumpfmotor<br />
kann dann sehr schnell der komplette,<br />
einbaufertig montierte Vollmotor<br />
werden, der heute noch von den<br />
Automobilherstellern<br />
gefertigt<br />
und zusammengebaut<br />
wird.<br />
Da wird auf Kolbenschmidt-Pierburg<br />
in den nächsten<br />
Jahren noch<br />
einiges zukommen<br />
– an Arbeit<br />
gibt es jedenfalls<br />
keinen Mangel.<br />
Dr. Dieter Seipler,<br />
Vorsitzender des<br />
Vorstandes der<br />
Kolbenschmidt<br />
Pierburg <strong>AG</strong>, berichtete<br />
in Marinette<br />
über weitereZukunftsprojekte,<br />
die bis zu<br />
Hochdruckpumpen<br />
für die Einspritzungreichen.<br />
Er betonte,<br />
daß die Entwicklung<br />
neuer Werk-<br />
Informationen aus erster Hand: Vorstandschef<br />
Dr. Dieter Seipler erläuterte<br />
der 15köpfigen Journalistengruppe<br />
auch die für die Zukunft abgesteckten<br />
Ziele der Kolbenschmidt-Pierburg-<br />
Gruppe in den USA. Seine Botschaft:<br />
Weiteres Wachstum ist angesagt.<br />
stoffe das wichtigste Forschungsprojekt<br />
wäre, denn der Trend zu höheren<br />
Motorleistungen bei sinkendem Hubraum<br />
(„downsizing“) würde sich künftig<br />
beschleunigen. Da für die nächsten<br />
Abgasgrenzwerte die Schadstoffemissionen<br />
um weitere 50 Prozent reduziert<br />
und der Kraftstoffverbrauch um<br />
rund 20 Prozent gesenkt werden müssen,<br />
die Automobilhersteller allen<br />
Fortschritt jedoch mit sinkenden Preisen<br />
„honorierten“, werden die Zeiten<br />
für die Zulieferer nicht einfacher. Alle<br />
Anforderungen unter einen Hut zu bekommen,<br />
sei nur möglich, wenn das<br />
Unternehmen weiter wächst.<br />
Was gibt es bei den Kolben an Neuigkeiten?<br />
Der Dieselkolben von Kolbenschmidt<br />
mit eingegossenem Kühlkanal<br />
wird nun erstmals beim VW TDI<br />
mit 110 kW/150 PS aus 1,9 Liter Hubraum<br />
eingebaut. Relativ neu sind in<br />
Marinette Pendelschaftkolben für<br />
Nutzfahrzeugdiesel, aus denen sich<br />
der reine Stahlkolben entwickelt, mit<br />
dessen erster Serienfertigung in sieben<br />
bis zehn Jahren zu rechnen ist.<br />
Für VW entwickelte das Unternehmen<br />
aber auch den stark profilierten<br />
Kolben für die direkte Benzineinspritzung<br />
(FSI). Mit diesem System<br />
sollen Verbrauchseinsparungen bis 15<br />
Prozent möglich sein. Auf dem Programm<br />
stehen jedoch auch hochwarmfeste<br />
Aluminiumlegierungen,<br />
Beschichtungen und der Verbund mit<br />
anderen Werkstoffen. Wenige Worte<br />
beschreiben ein riesiges Aufgabengebiet,<br />
das über mehr als zehn Jahre in<br />
die Zukunft greift.<br />
Schon vorher werden<br />
Otto- und Dieselmotor<br />
mit homogener<br />
Verbrennung<br />
arbeiten und nahezu<br />
keine Schadstoffe<br />
mehr emittieren.<br />
Für Kolbenschmidt-<br />
Pierburg war das Engagement<br />
in den USA<br />
ein überaus wichtiger<br />
Schritt. Er wurde<br />
mit in Deutschland<br />
entwickelter Technik<br />
erst möglich. Auch<br />
künftig werden sich<br />
die Betriebe in den<br />
USA nur dann überdurchschnittlichentwickeln<br />
können,<br />
wenn die Mutter in<br />
Deutschland für Innovationen<br />
sorgt.<br />
Doch darum ist uns<br />
nicht bange.<br />
Christian Bartsch<br />
Erfolgreiche Zertifizierung des „SAP Customer Competence Centers“<br />
Know-how-Bündelung senkt Kosten<br />
Hamburg/Neuss. Schon früh wurde<br />
in der Rheinmetall Informationssysteme<br />
GmbH (RIS/Neuss) erkannt: Um<br />
Synergien für den Rheinmetall-Konzern<br />
zu schaffen, muß die RIS ihr<br />
Know-how bündeln. Folgerichtig wurden<br />
Anfang 1999 für die wichtigen Anwendungssysteme<br />
und Technologien<br />
„Competence Center“ eingerichtet. Als<br />
Beispiele seien hier SAP, CAD-CATIA<br />
(in der computergestützten Konstruktion/Entwicklung<br />
eingesetzte IBM-<br />
Software), Unternehmenskommunikation,<br />
PC-Service, Netzwerke (LAN/„Local<br />
Area Network“ + WAN/„Wide Area<br />
Network“) sowie TK-Anlagen (TK: Telekommunikation)<br />
genannt. Mit diesen<br />
„Competence Centern“ hat die RIS die<br />
virtuelle Organisationsform gefunden,<br />
um das Know-how anerkannter Experten<br />
der jeweiligen Gebiete konzernweit<br />
zur Verfügung zu stellen. Die<br />
Hauptaufgaben dieser „Center“ liegen<br />
in der Marktbeobachtung bzw. der Information<br />
über Weiterentwicklungen,<br />
der Technologie-Beratung, der Mitwirkung<br />
in Pilotprojekten sowie der Schulung<br />
und Information der anderen Mitarbeiter<br />
des jeweiligen Fachgebietes.<br />
Eine besondere Rolle innerhalb der<br />
RIS-„Competence Center“ nimmt das<br />
„SAP Customer Competence Center“<br />
(SAP-CCC) ein. Hier kommt hinzu, daß<br />
der Walldorfer Softwarehersteller seine<br />
Großkunden – z.B. Rheinmetall,<br />
das derzeit insgesamt 30 unterschiedliche<br />
SAP-Systeme einsetzt – dazu<br />
auffordert, ein derartiges „Customer<br />
Competence Center“ zu<br />
etablieren, um damit u.a. einen<br />
zentralen Ansprechund<br />
Vertragspartner im<br />
jeweiligen Konzern zu<br />
erhalten. Aufgaben<br />
wie Bereitstellung<br />
von SAP-<br />
Informationsmaterial,Organisa-<br />
tion und Durchführung von Informationsveranstaltungen<br />
zu SAP-Produkten<br />
und -Strategien, Lizenzverwaltung und<br />
Verwaltung der Kundendaten werden<br />
in enger Zusammenarbeit zwischen<br />
SAP und SAP-CCC in der RIS durchgeführt.<br />
Das überwiegend in Hamburg<br />
angesiedelte SAP-CCC umfaßt ein<br />
Kernteam von acht Mitarbeitern sowie<br />
weiteren zehn RIS-Experten in den<br />
SAP-Basisgruppen an den drei Hauptstandorten<br />
Bremen, Neckarsulm und<br />
Neuss.<br />
Für das „Customer Competence Center“<br />
besteht die Möglichkeit, sich<br />
durch SAP zertifizieren<br />
zu lassen. Zertifizierung<br />
bedeutet<br />
in diesem Fall, daß<br />
die von SAP vorgegebenenFunktionen<br />
(z.B. Vertrags-<br />
abwicklung,internes Marketing, Koordination<br />
der Entwicklungsanforderungen<br />
und vor allem<br />
der „Support<br />
Desk“ für SAP-Anwender)<br />
vom SAP-<br />
CCC der RIS übernommen<br />
und in einer<br />
– vom WalldorferSoftware-Spezialisten<br />
– jährlich<br />
überprüften Qualität<br />
durchgeführt<br />
werden müssen. Im<br />
Gegenzug gewährt<br />
SAP einem Kunden<br />
mit zertifiziertem<br />
SAP-CCC einen signifikanten<br />
Rabatt<br />
auf die jährliche<br />
Software-Pflegegebühr.<br />
Es versteht sich von selbst, daß auch<br />
das „SAP Customer Competence Center“<br />
der Rheinmetall Informationssysteme<br />
GmbH diese Zertifizierung angestrebt<br />
– und zwischenzeitlich erreicht<br />
– hat, um dem Düsseldorfer<br />
Konzern den hier jährlich auflaufenden,wirtschaftlichen<br />
Vorteil in Millionenhöhedauerhaft<br />
zu sichern.<br />
Know-how-Bündelung<br />
als Instrument<br />
nachhaltiger<br />
Kostenreduzierung.<br />
Zum Ablauf der<br />
Ulf Scherenberg<br />
Zertifizierung: Erste<br />
Gespräche mit<br />
SAP führte man im Sommer 1999. Dabei<br />
wurde schnell klar, daß im Rheinmetall-Konzern<br />
der Erfolg im Funktionsbereich<br />
„Support Desk“ über die<br />
Zertifizierung entscheiden würde. Die<br />
Aufgabe des „Support Desks“ besteht<br />
darin, für alle SAP-Systeme des Konzerns<br />
die Anfragen zu Problemen, Fehlern<br />
oder Ausgestaltungsmöglichkeiten<br />
der SAP-Software innerhalb des<br />
SAP-CCC zu beantworten.<br />
Dabei gilt es, möglichst<br />
wenig Anfragen an SAP<br />
weiterzugeben.<br />
Denn alle an<br />
SAP weitergeleitetenPro-<br />
Die Felder der intensiven Zusammenarbeit: Das „Customer Competence Center“ der Rheinmetall Informationssysteme<br />
GmbH ist die Kommunikations-Schnittstelle zwischen der Rheinmetall <strong>AG</strong> und der SAP <strong>AG</strong>.<br />
blem- bzw. Fragestellungen werden in<br />
der sogenannten Quote festgehalten.<br />
Für diese „Quote“ ist entscheidend,<br />
wieviele der bei SAP eingegangenen<br />
Meldungen innerhalb deren dreistufiger<br />
Support-Organisation („Local Support“,<br />
„Regional Support“, „Development<br />
Support“) erst in der Entwicklung<br />
(„Development Support“) gelöst<br />
werden können. Anders gesagt: Das<br />
SAP-CCC von Rheinmetall hat sich das<br />
Ziel gesetzt, möglichst viele der Problemstellungen<br />
in eigener Regie zu<br />
bewältigen. Annähernd 80 Prozent<br />
der monatlich etwa 125 Anfragen wer-<br />
den denn auch von den Teammitgliedern<br />
selbst beantwortet; die restlichen<br />
Anfragen gehen an SAP, wobei<br />
es sich dabei dann um hochkomplexe<br />
Probleme handelt, die in der Regel<br />
nur die Software-Entwicklungsexperten<br />
von SAP („Developement<br />
Support“) lösen bzw. beseitigen können.<br />
Vor dem Hintergrund einer möglichst<br />
hohen „Quote“ hat die RIS mithin<br />
dafür gesorgt, daß alle Anfragen<br />
zu Problemen, Fehlern oder Ausgestaltungsmöglichkeiten<br />
der SAP-Software<br />
im Rheinmetall-Konzern zentral<br />
beim SAP-CCC auflaufen und nur nach<br />
entsprechender Prüfung und Bearbeitung<br />
an SAP weitergegeben werden.<br />
Unterstützt werden die Mitarbeiter<br />
des „SAP Customer Competence Centers“<br />
dabei von ihren Kollegen aus<br />
den SAP-Basisgruppen, die vorwiegend<br />
technische Fragen und Probleme<br />
bearbeiten. Damit auch die Individualität<br />
der Geschäftsprozesse der<br />
einzelnen Rheinmetall-Firmen berücksichtigt<br />
werden kann, sind inzwischen<br />
auch alle SAP-Berater und -Entwickler<br />
der RIS über eine Lösungsdatenbank<br />
in diesen Klärungsprozeß integriert<br />
worden.<br />
Was die eigentliche Zertifizierung<br />
angeht, so wurde es im Januar 2000<br />
ernst. Es galt, die möglichst hohe<br />
„Quote“ mindestens sechs Monate<br />
lang zu bestätigen, um die erforderlichen<br />
Zertifizierungsunterlagen bei<br />
SAP einreichen zu können. Dank des<br />
großen Einsatzes aller Beteiligten<br />
wurden die vom Softwarelieferanten<br />
gestellten Qualitätsanforderungen<br />
erfüllt. Damit war nur noch eine<br />
Hürde zu überspringen: Das<br />
SAP-CCC der RIS mußte<br />
die bereits erwähnten<br />
Funktionen<br />
nicht allein für<br />
die bis dato<br />
von<br />
ihm<br />
betreuten<br />
27 SAP-Sy-<br />
stemeübernehmen;gegenüber SAP verantwortlich<br />
sein<br />
mußte man auch für die Installationen<br />
in der Schweiz, in Spanien und in den<br />
USA, die nicht von der RIS betreut werden.<br />
Im August und September 2000<br />
konnte auch diese Hürde genommen<br />
werden, so daß einer Zertifizierung<br />
nichts mehr im Wege stand. Seit 25.<br />
Oktober diesen Jahres ist das „SAP<br />
Customer Competence Center“ der<br />
Rheinmetall Informationssysteme<br />
GmbH weltweit die 40. zertifizierte<br />
Einrichtung ihrer Art.<br />
Ulf Scherenberg*<br />
* Ulf Scherenberg (43) ist Leiter des „SAP Customer<br />
Competence Centers“ (Zentrale: Hamburg).<br />
30 produktive SAP-Landschaften im Rheinmetall-Konzern<br />
User Help Desk<br />
SAP-Anwendungsentwicklung/-betreuung<br />
Monatlich durchschnittlich 125 Anfragen<br />
CCC<br />
Monatlich durchschnittlich 25 Meldungen<br />
Rheinmetall Informationssysteme<br />
„Support Desk“, eine zentrale Funktion des „SAP Customer Competence Centers“ und letzte<br />
Instanz, bevor ein software-spezifisches Problem den Rheinmetall-Konzern verläßt.
Das <strong>Profil</strong> 5/2000 Menschen im Blickpunkt<br />
Seite 21<br />
Paraglider Roland Reichardt von Hirschmann<br />
„Bisweilen muß ich unter<br />
den Wolken schweben“<br />
Roland Reichardt liebt’s schwerelos.<br />
Mit Paragliding schlägt er der<br />
Schwerkraft ein Schnippchen.<br />
am meisten: „Ein fremder Berg ist immer<br />
wieder spannend.“ Bevor er<br />
drauflosfliegt, macht sich Reichardt<br />
Angefangen hat alles 1988 mit einem bei einheimischen Gleitern sachkun-<br />
Schnupperkurs, den der Metzinger dig. Wenn Wind- und Wetterverhältnis-<br />
einfach so, aus Neugier, mitgemacht se stimmen, liegen bis zu zweieinhalb<br />
hat. Ein paar Meter in der Luft, wenige Stunden schwereloses Gleiten in einer<br />
Sekunden schweben und Roland Höhe von bis zu 3200 Metern vor<br />
Reichardt wußte: „Das ist mein Sport.“ Reichardt. „Das ist der alte Traum vom<br />
Vorbelastet war er ja schon durch sei- Fliegen“, erklärt Roland Reichardt seine<br />
Begeisterung fürs Fallschirmsprinne Liebe zu seinem Sport. Das schwegen,<br />
was ihm als Hobby aber immer relose Gleiten in der Luft gibt ein „Ge-<br />
zu kostspielig gewesen ist.<br />
fühl von Freiheit“. Als naturverbunde-<br />
Dann ging alles Schlag auf Schlag:<br />
Der Hirschmann-Techniker meldete<br />
sich bei der Ulmer Gleitschirmschule<br />
ner Mensch fasziniere ihn auch die<br />
Wahrnehmung von Farben, Pflanzen,<br />
Gerüchen.<br />
an und machte seinen „Schein“. Jetzt Ohne die Beobachtung der Natur<br />
verbindet der sportliche 50jährige ger- kommt nach Reichardts Meinung auch<br />
ne Urlaub und Hobby miteinander. kein umsichtiger Paraglider aus: Der<br />
Morgens Skifahren, mittags Paragli- Flug der Vögel, Struktur und Farbe der<br />
ding, so kann ein winterlicher Urlaubs- Wolken können einem kundigen Kopf<br />
tag bei Roland Reichardt aussehen. wichtige Informationen über die Wet-<br />
Im Sommer zieht’s ihn nach Österreich terentwicklung geben. Bei Regen bei-<br />
an den Wolfgangsee.<br />
spielsweise sinkt der Luftauftrieb und<br />
Lange Pausen zwischen den einzelnen<br />
Flügen mag er gar nicht. Nach einer<br />
Weile merkt er dann: „Jetzt brauch’<br />
ich’s wieder: Jetzt muß ich wieder<br />
schweben.“<br />
Fremde Berge zu erfliegen, das<br />
macht ihm besonders Spaß. Um jeden<br />
Berg weht ein anderer Wind, jeder Abhang<br />
erfordert ein anderes Flugverhalten.<br />
Das fasziniert Roland Reichardt<br />
macht das Fliegen unmöglich. Wolken<br />
können auch Gewitter ankündigen.<br />
Blitz und Donner sind für Paraglider lebensgefährlich.<br />
Bei Gewitter herrscht<br />
absolutes Flugverbot. Reichardt ist<br />
umsichtig: „Man muß auch mal auf einen<br />
Flug verzichten können, man muß<br />
abbrechen können, wenn die Wetterverhältnisse<br />
eben nicht optimal sind –<br />
auch dann, wenn es gerade großen<br />
Spaß macht.“<br />
Roland Reichardt würde sein<br />
Steckenpferd nicht als gefährlich einstufen:<br />
„Gleitschirmfliegen ist auch<br />
nicht gefährlicher als Fußball, solange<br />
man die Regeln einhält“, meint er.<br />
Manchmal amüsieren ihn die Vorurteile,<br />
die über seinen Sport im Umlauf<br />
sind. Zum Beispiel, daß das Hobby gesundheitlich<br />
belastend sei: Der „Aufprall“<br />
beim Landen sei keiner, betont<br />
Reichardt: „Wer es richtig gelernt hat,<br />
der kann auf den Zehenspitzen landen.“<br />
Die Belastung für die Gelenke<br />
sei der bei einem Sprung von einer<br />
Treppenstufe vergleichbar. Roland<br />
Reichardt, der eine Bandscheibenoperation<br />
hinter sich hat, nennt sich<br />
selbst das beste Beispiel. Zudem sei<br />
der Sport nicht an ein bestimmtes Alter<br />
gebunden: „Das kann man auch<br />
noch mit 60 lernen.“<br />
Was ihn stört, sind die begrenzten<br />
Möglichkeiten, hierzulande den<br />
Paraglider Roland Reichardt in seinem<br />
Hobbyelement: „Leinen ziehen“ heißt<br />
es beispielsweise bei den Vorbereitungen<br />
für den Rückwärtsstart.<br />
Schirm zu entfalten. Zuviele Verbote<br />
verleiden die Freude am Hobby, klagt<br />
der Paraglider, wie beispielsweise auf<br />
der Schwäbischen Alb, die in allernächster<br />
Nähe zu Reichardts Wohnort<br />
liegt. Barbara Scherer<br />
Angeln ist alles andere als langweilig.<br />
Es gibt nichts Schöneres,<br />
als einen dicken Fisch mit Haken<br />
und Köder auszutricksen“, so Angel-<br />
Fan Karl Caris, der als Vorarbeiter/Fertigung<br />
im Neusser Pierburg-Werk beschäftigt<br />
ist. Zusammen mit seinen<br />
beiden Arbeitskollegen Dieter Stark<br />
(Transport) und Joachim Thomas (Vorarbeiter)<br />
sowie fünf weiteren Anglern<br />
hat er vor Jahren den Stammtisch „Von<br />
der Rolle“ gegründet. Bei ihnen dreht<br />
sich alles um Angelruten, Köder und<br />
reiche Fischgründe.<br />
Die suchen die Stammtischler in<br />
ganz Europa und in Nordamerika.<br />
1985 waren sie das erste Mal gemeinsam<br />
im „Angel-Urlaub“ in Dänemark.<br />
„Um den Fischen immer ganz nah zu<br />
sein“, scherzen die drei Hobbyangler,<br />
waren sie mit einem Kajüt-Boot unterwegs.<br />
Da der Platz auf einem solchen<br />
Boot ebenso begrenzt ist wie in Blockhütten<br />
oder Kleinbussen, möchte der<br />
Stammtisch auch nicht größer werden:<br />
„Sonst müßte tatsächlich einer von<br />
uns mal zu Hause bleiben, weil kein<br />
Platz mehr vorhanden ist.“<br />
Caris hat das Angeln quasi in die<br />
Wiege gelegt bekommen. Sein Vater<br />
ist Vorsitzender des Sportangelvereins<br />
1934 Büderich, in dem er selbst seit 13<br />
Jahren Mitglied ist. Kollege Stark konn-<br />
Schnappschuß von der Angeltour im Sommer 1999 nach Hitra, einer Insel im te 1995 für den Büdericher Verein<br />
Trondheim-Fjord: Die drei Pierburg-Mitarbeiter Karl Caris (l.), Joachim Thomas gewonnen werden. Thomas reicht die<br />
(2.v.r.) und Dieter Stark (r.) sowie „Von der Rolle“-Vereinskollege Gerd Arndt mit Mitgliedschaft im Stammtisch, der<br />
einem Teil der täglichen Ausbeute; Dorsch, Lumb, Leng, Makrele und Seelachs sich einmal im Monat in einer Gast-<br />
lagen praktisch immer „frisch in der Pfanne“ und schmeckten entsprechend gut. stätte trifft. Dann werden Gelder ein-<br />
Roland Reichardt liebt’s schwerelos – doch bevor sich dieses Gefühl in luftiger Höhe einstellt, muß der 50jährige Techniker<br />
erst einmal abheben. Unser Fotograf hielt den begeisterten Paraglider während der Aufziehphase beim Vorwärtsstart fest.<br />
Rückkehr von einer ertragreichen Angeltour im Gebiet der norwegischen Insel Hitra: Der Fang wird ausgenommen, filetiert,<br />
portioniert und, abgesehen vom täglichen Bedarf, in Tüten eingefroren – als Mitbringsel für Familie oder Freunde.<br />
Drei Pierburg-Angler vom Stammtisch „Von der Rolle“<br />
„Petri Heil“ in reichen Fischgründen<br />
kassiert und vor allem die nächsten<br />
Touren besprochen.<br />
Statt an Baggerseen wie Sangsheide,<br />
Linnertsee und Dammloch – die<br />
Angelgründe des Büdericher Vereins –<br />
suchen sich die Stammtischler ihren<br />
besonderen „Kick“ in Norwegen, Finnland,<br />
Irland, Kanada oder gar Alaska.<br />
„Unsere Jahrestouren sind die absoluten<br />
Höhepunkte“, versichern die drei<br />
Pierburg-Mitarbeiter. Viel Spaß, ein<br />
Schuß Abenteuer und kiloweise frischer<br />
Fisch sind dabei immer garantiert.<br />
1998 war man in Aland in Finnland<br />
unterwegs: Mal nicht mit dem<br />
Boot, sondern per VW-Bus und Hänger.<br />
Dieter Stark war das Anglerglück<br />
besonders hold: Er holte einen 15,2 Kilo<br />
schweren und 84 Zentimeter langen<br />
Silberlachs aus dem Meer. Der<br />
40jährige fand mit diesem kapitalen<br />
Fang sogar Eingang ins Internet: Dort<br />
landete er auf einer speziellen<br />
Angler-Hitliste bundesweit auf dem<br />
sechsten Platz. Ranglisten, Waage und<br />
Zollstock gehören für den „echten“<br />
Angler einfach dazu.<br />
Der Stammtisch reist aber vor allem<br />
in den Norden Norwegens mit dem<br />
Ziel Lofot-Inseln. Dort gibt es nach<br />
Meinung von Caris immer noch die allerbesten<br />
Fischgründe: Steinbeißer,<br />
Seelachse, Dorsche und andere<br />
Fischarten tummeln sich in den kalten<br />
Fluten vor Norwegens Küste. Er aber<br />
schwärmt noch heute von seinem Königslachs,<br />
den er 1989 in Kanada gefangen<br />
hat: „Der Bursche wog ausgenommen<br />
59 Pfund und war 1,21 Meter<br />
lang!“ Jochen Thomas sieht das alles<br />
eher locker. Für ihn ist Angeln ein entspannender<br />
Ausgleich zusammen mit<br />
Freunden. Aber immerhin, ein Highlight<br />
hat auch er auf Lager: Vor der<br />
Küste von Irland hatte er vor Jahren<br />
mal einen kapitalen 2,15 Meter langen<br />
Blauhai an der Angel.<br />
„Für einen Lachs, der angebissen<br />
hat, brauchst du schon mal 35 Minuten,<br />
um ihn endlich hochzuziehen“,<br />
erklärt „Experte“ Caris die Feinheiten<br />
des Angelns. Das Problem beim Einholen<br />
sei eher die Verkrampfung als die<br />
mangelnde Muskelkraft. Langeweile<br />
beim Angeln kennen die drei nicht.<br />
„Beim Angeln muß man die Fische<br />
überlisten, wenn man etwas fangen<br />
will“, fachsimpelt Caris. Die richtige<br />
Wahl der Ruten, Blinker, Schwimmer<br />
und Köder ist eine Wissenschaft für<br />
sich und nur ein Teil der komplexen<br />
Angeltechnik.<br />
Die drei Angler belassen es aber<br />
nicht nur beim Fangen der Fische. Sie<br />
können ihnen auch kulinarische Seiten<br />
abgewinnen – ob gebraten, gekocht<br />
oder geräuchert. Stark: „Fisch,<br />
den wir in der Wildnis fangen,<br />
schmeckt unvergleichbar lecker.“ Ein<br />
Teil des Fanges wird vor Ort auf den<br />
Touren verzehrt, der Rest wird filetiert,<br />
geräuchert oder eingefroren. Damit<br />
auch zu Hause Fisch auf den Tisch<br />
kommt. Der Gedanke an eine ganz besondere<br />
Delikatesse läßt Caris das<br />
Wasser im Mund zusammenlaufen:<br />
Tartar von den Bauchlappen des Lachses.<br />
Stephan Lorenz
Seite 22 Impressionen<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
ÄSTHETISCHER BLICKWINKEL: Wie bereits<br />
im Vorjahr mit vielen überraschenden Effekten unter<br />
anderem für den Jahreskalender 2000 realisiert („Das<br />
<strong>Profil</strong>“ 1999/2000), haben zwei renommierte deutsche<br />
Fotografen jetzt weitere wehrtechnische Produkte der<br />
Rheinmetall DeTec <strong>AG</strong> und ihrer Tochterfirmen anspruchsvoll<br />
inszeniert. Das Ergebnis sind einmal mehr<br />
Motive mit hohem künstlerischen Anspruch, die der<br />
„Defence“-Sektor zukünftig ebenfalls gezielt im Rahmen<br />
seiner zunehmend internationalen Marktpositionierung<br />
visuell einsetzen wird – so auch im Kalender<br />
für das Geschäftsjahr 2001. Als „Fotomodelle“ dienten<br />
– wie diese „<strong>Profil</strong>“-Aufnahmen zeigen – z.B. die gelenkte<br />
Einzelradaufhängung des gepanzerten „H 400“-<br />
Kampffahrzeuges, ein Bewegungssystem für Flug- und<br />
Fahrsimulatoren, die Radar- und elektrooptischen<br />
Sensoren der Feuerleitung des „Skyshield“-Flugabwehrsystems,<br />
die 155mm-Waffenanlage L52 der Panzerhaubitze<br />
2000, eine Sonarantenne für spezielle<br />
Anwendungen sowie die 35mm-Flugabwehrmunition.








![PDF [1.0 MB] - KSPG AG](https://img.yumpu.com/5513074/1/171x260/pdf-10-mb-kspg-ag.jpg?quality=85)