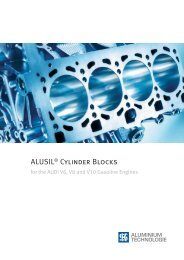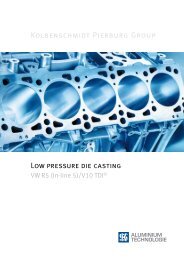Profil f r PDF - KSPG AG
Profil f r PDF - KSPG AG
Profil f r PDF - KSPG AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 4 Investor Relations<br />
Das <strong>Profil</strong> 5/2000<br />
Anfang November diesen Jahres veröffentlichte die Financial<br />
Times Deutschland (Hamburg) einen Beitrag<br />
über die Rheinmetall <strong>AG</strong>, in dem unter anderem von einer<br />
„ernsten Finanzkrise“ die Rede war. Mit aller Schärfe<br />
wies der Vorstandsvorsitzende der Düsseldorfer Unternehmensgruppe,<br />
Dipl.-Math. Klaus Eberhardt, diese „unhaltbare<br />
Behauptung“ zurück und unterstrich dabei gleichzeitig<br />
die finanzielle Solidität des Konzerns, der in seinen drei<br />
Geschäftsfeldern „Automotive“, „Electronics“ und „Defence“<br />
weltweit erfolgreich am Markt plaziert ist. Eberhardts<br />
Börsen-Zeitung: Gespräch mit Rheinmetall-Vorstandschef Klaus Eberhardt<br />
Konsolidierungspause eingelegt<br />
Ertrag, Ertrag, Ertrag und Liquididät.“<br />
Mit dieser prägnanten Formel<br />
umreißt Klaus Eberhardt, der<br />
seit dem 1. Januar 2000 amtierende<br />
Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall<br />
<strong>AG</strong>, in welche Richtung er den<br />
Konzern bewegen will. Seit Anfang<br />
der neunziger Jahre hat Rheinmetall<br />
zehn Wehrtechnik-Unternehmen für<br />
fast 1 Mrd. DM gekauft. Im letzten und<br />
in diesem Jahr wurde ein Umsatzvolumen<br />
von 938 Mill. € erworben, und<br />
285 Mill. € wurden abgegeben. Der<br />
Konzern ist massiv auf Wachstum<br />
geprägt worden, und das hat bei der<br />
Finanzausstattung deutliche Spuren<br />
hinterlassen. Der Konzernumsatz<br />
wurde innerhalb von zehn Jahren auf<br />
8,8 Mrd. DM nahezu verdreifacht,<br />
und die Bilanzsumme wurde bis 1999<br />
um den Faktor 2,5 auf 6,8 Mrd. DM<br />
verlängert.<br />
Mit dieser mächtigen Expansion hat<br />
das Eigenkapital trotz der Kapitalerhöhungen<br />
1996, 1997 und 1998 bei<br />
weitem nicht Schritt gehalten. Es ist<br />
gerade mal um ein Drittel auf 1,1 Mrd.<br />
DM angereichert worden. Dagegen<br />
wurde die Gesamtverschuldung von<br />
knapp 670 Mill. DM auf 3,1 Mrd. DM<br />
hochgezogen. Rheinmetall lebt in einer<br />
gewiß nicht übertrieben komfortablen<br />
finanziellen Situation, doch von<br />
einer „ernsten Finanzkrise“, wie<br />
Anfang November 2000 von der<br />
„Financial Times Deutschland“ behauptet,<br />
kann bei weitem keine Rede<br />
sein, auch wenn die Brutto-Finanzschulden<br />
von 1998 bis Ende 1999<br />
einen Sprung von 450 auf dicht unter<br />
1,4 Mrd. DM gemacht haben werden.<br />
Die Netto-Finanzschulden werden für<br />
Ende 2000 bei 600 (584) Mill. € erwartet.<br />
Seit Eberhardt den langjährigen<br />
Rheinmetall-Chef Hans U. Brauner abgelöst<br />
hat, wurde ein Paradigmenwechsel<br />
vollzogen. Die Jahre der Quantensprünge,<br />
gekennzeichnet durch<br />
Akquisititionen zur starken strategischen<br />
Positionierung vor allem in<br />
der Wehrtechnik und durch die Abgabe<br />
von Randaktivitäten, gehören der<br />
Odeon im Qualitätstest<br />
Vergangenheit an. Er verfolgt eine<br />
Strategie „der klaren Linie“, die sich<br />
primär an der wirtschaftlichen Performance<br />
orientiert. Für ihn ist Wachstum<br />
zwar wichtig, doch die Größe<br />
allein läßt er als Kriterium nicht gelten.<br />
„Das Management will zeigen, was in<br />
Rheinmetall steckt: nicht mit Visionen,<br />
sondern mit realen, nachvollziehbaren<br />
Fakten.“<br />
Kompetenz ohne<br />
Kommando-Ton<br />
Seite 9<br />
Deshalb braucht der Konzern nach<br />
den stürmischen und von Visionen geprägten<br />
Zeiten dringend eine Konsolidierungspause.<br />
Wie Eberhardt im Gespräch<br />
mit der Börsen-Zeitung sagte,<br />
wird er das aktive Portfoliomanagement<br />
zumindest in den nächsten zwei<br />
Jahren unter umgekehrten Vorzeichen<br />
betreiben. Er will aus der großen Fülle<br />
der ins Netz gegangenen Fische jene<br />
Fänge ausmustern, die außerhalb der<br />
Kernkompetenz der drei Säulen Automotive,<br />
Electronics und Defence leben.<br />
Den Liquiditätszufluß daraus (Verkaufspreis<br />
plus Abbau der Finanzschulden)<br />
veranschlagt er auf deutlich<br />
über 100 Mill. €. Daß den Vorzugsaktionären<br />
der Jagenberg <strong>AG</strong> ein freiwilliges<br />
Kaufangebot unterbreitet wird, widerspricht<br />
seiner Politik nur scheinbar,<br />
denn tatsächlich soll damit die komplette<br />
Veräußerung an einen Finanzinvestor<br />
vorbereitet werden. Jagenberg<br />
wird im Geschäftsjahr 2000 einschließlich<br />
der Erträge aus Immobilienverkäufen<br />
eine schwarze Null erreichen,<br />
nachdem sich das operative Ergebnis<br />
deutlich zweistellig verbessert<br />
Premium-Produkt: Das Heizungs- und<br />
Klimabediensystem für den BMW Z8<br />
stammt von der Firma Preh.<br />
hat. Der operative Turnaround soll im<br />
nächsten Jahr vollzogen werden.<br />
Auch wenn derzeit weitere Zukäufe<br />
nicht das vorrangige Thema sind, will<br />
Rheinmetall doch das Pulver trocken<br />
halten und den finanziellen Spielraum<br />
für Akquisitionsgelegenheiten haben.<br />
Diesen Spielraum sieht Finanzvorstand<br />
Herbert Müller gesichert („Wir<br />
fühlen uns komfortabel“), auch nach<br />
der verschobenen Anleihe über 300<br />
Mill. €. Diese Anleihe, die nun zunächst<br />
für das Frühjahr 2001 vorgesehen<br />
ist, sollte der Umfinanzierung eines<br />
bis Ende 2002 laufenden syndizierten<br />
Kredits dienen. Daß hier Rheinmetall<br />
der Schuh nicht drückt, hat<br />
nicht allein mit dem Termin zu tun,<br />
sondern auch mit den Konditionen.<br />
Denn die seit 1998 laufende Kreditfazilität<br />
über 700 Mill. DM stellt sich für<br />
Rheinmetall deutlich günstiger als die<br />
geplante Anleihe, zumal zur Nutzung<br />
Darstellung der aktuellen Situation sowie der strategischen<br />
Positionierung des Konzerns fand ein breites Echo in<br />
renommierten deutschsprachigen bzw. internationalen Tages-<br />
und Wirtschaftszeitungen. „Das <strong>Profil</strong>“ veröffentlicht<br />
stellvertretend einen Beitrag der Börsen-Zeitung (BZ/Frankfurt<br />
am Main) vom 2. Dezember des Jahres. Darin geben BZ-<br />
Chefredakteur Claus Döring und Brunfrid Rudnick, Leiter der<br />
Rhein-Ruhr-Redaktion der BZ, ein Gespräch wieder, das sie<br />
wenige Tage zuvor mit Eberhardt über die aktuellen und<br />
zukünftigen Perspektiven von Rheinmetall führten. dp<br />
der niedrigeren Zinsen am kurzen Ende<br />
auf Basis der Kreditfazilität kurzfristige<br />
Gelder rollierend aufgenommen<br />
wurden. Insofern führt die in der<br />
1999er Bilanz ausgewiesene und auch<br />
im Credit Research von Dresdner KB<br />
erwähnte Fristigkeit der Verbindlichkeiten<br />
den externen Betrachter leicht in<br />
die Irre. Dort werden 82% der 757 Mill.<br />
€ Bruttofinanzschulden als innerhalb<br />
von zwölf Monaten fällig beschrieben.<br />
Vor allem die Spread-Ausweitung<br />
während der Roadshow von ursprünglich<br />
90 auf dann 130 bis 140 Basispunkte<br />
über Euribor, von der auch andere<br />
mit Triple-B geratete Gesellschaften<br />
betroffen waren, hätten zur Absage<br />
der Anleihe bewogen, so der Finanzvorstand.<br />
Sicher sei es nicht einfach,<br />
nach halbjähriger Vorbereitung auf<br />
die Emission zu verzichten. Am Markt<br />
sei die Verschiebung allerdings gut<br />
aufgenommen und als Zeichen von<br />
Professionalität gewertet worden.<br />
Müllers Ziel ist es, im Abschluß für<br />
2000 die Netto-Finanzschulden auf<br />
600 Mill. € zu begrenzen. Dies wären<br />
zwar mehr als im Jahr zuvor (584 Mill.<br />
€), doch muß dies vor dem Hintergrund<br />
der Akquisitionen gesehen werden.<br />
So dürften sich die liquiden Mittel<br />
per Ende 2000 gegenüber Ultimo<br />
1999 von 173 auf 105 Mill. € verringern,<br />
die Finanzverbindlichkeiten aber<br />
ebenfalls, und zwar von 757 auf 705<br />
Mill. €. Die sich bei 3 Mrd. € Bilanzsumme<br />
daraus abzuleitende (jedoch<br />
mehr statische und in ihrer Aussagefähigkeit<br />
für die finanzielle Verfassung<br />
begrenzte) Verschuldungsquote von<br />
18% ist deshalb um weitere Finanzkennziffern<br />
zu ergänzen. So wird für<br />
2000 ein Cash-flow von 360 Mill. € erwartet,<br />
womit der dynamische Verschuldungsgrad<br />
bei 2 liegt. Bei einem<br />
für 2000 in Aussicht gestellten Ergebnis<br />
vor Steuern und Zinsen (Ebit) von<br />
145 Mill. € errechnet sich ein Zinsdeckungsgrad<br />
(Ebit in Relation zum<br />
Nettozinsaufwand) von 2,6; auf Basis<br />
des Ergebnisses vor Steuern, Zinsen<br />
und Abschreibungen (Ebitda) wären<br />
es sogar 7,3.<br />
Freilich wird bei Rheinmetall derzeit<br />
eine andere Kennziffer besondere Beachtung<br />
finden, nämlich das Verhältnis<br />
der Gesamtverbindlichkeiten zum<br />
Cash-flow. Denn hier hatte sich der<br />
Konzern in den sogenannten Financial<br />
Covenants des syndizierten Kredits<br />
auf eine Obergrenze von 3,5 verpflichtet.<br />
Sie war infolge des verzögerten Jagenberg-Verkaufs<br />
vorübergehend<br />
überschritten worden, und dies hatte<br />
letztlich die irreführenden Schlagzeilen<br />
von der Finanzkrise ausgelöst.<br />
Stuttgart anfing. Als Vorstandsassimetall Elektronik <strong>AG</strong> (heutige Adistent<br />
und Leiter der Fertigungssteuetron <strong>AG</strong>) übernahm. Dieses Amt berung<br />
in der Nachrichtentechnik samhielt er, als er zum 1. Januar 2000 als<br />
Wenn Klaus Eberhardt Rheinmetall<br />
als „eines der faszinierendsten<br />
Unternehmen“ bemelte<br />
er das Know-how, um später<br />
bei MBB das Werk Nabern zu leiten<br />
und anschließend den Geschäftsbereich<br />
Fertigung.<br />
Nachfolger von Hans U. Brauner die<br />
Konzernführung übernahm. Die Turbulenzen<br />
um seinen Vorgänger Brauner<br />
will Eberhardt schnell vergessen<br />
schreibt, klingt dies glaubwürdig. Dann folgte das Thema „Defence“, machen, die Zeit der Selbstherrlich-<br />
Denn in der jetzigen Aufgabe fließt er wurde Mitglied der Unternehkeit an der Rheinmetall-Spitze<br />
zusammen, was der 52-jährige MamensbereichsleitungVerteidigungs- scheint vorüber. Mit dem Großnager<br />
auf verschiedenen Stufen seisysteme. Als die zivile Mikroelektroaktionär Röchling pflegt er eine<br />
ner Karriereleiter in unterschiednik aus der Dasa ausgegründet und „sehr gute und vertrauensvolle“ Zulichen<br />
Firmen kennengelernt hat: in die Temic eingebracht wurde, bot sammenarbeit. Auch im Vorstand<br />
„Electronics“, „Automotive“ und sich die nächste Chance. Als stell- legt Eberhardt Wert auf klare Verhält-<br />
„Defence“. Dies sind heute die drei vertretender Vorsitzender der Genisse: Der angelsächsische CEO<br />
Säulen der „strategischen Holding“ schäftsführung der Temic Telefunken liegt ihm näher als ein Primus inter<br />
Rheinmetall, an deren Spitze er seit microelectronic GmbH verantwor- pares. Doch die Vorliebe für klare<br />
Jahresanfang 2000 steht. Begonnen tete er die Kfz-Elektronik, Airbag-Sy- Kommandostrukturen heißt nicht<br />
hat Eberhardts Laufbahn mit Electrosteme und Mikrosysteme. Nach die- Kommandoton. Entscheidungen im<br />
nics, als er nach dem Studium der sen „Automotive“-Jahren wechselte Vorstand werden erst getroffen,<br />
Mathematik und Physik 1972 bei der Eberhardt 1997 zu Rheinmetall, wo wenn Einstimmigkeit erreicht ist.<br />
Standard Electric Lorenz <strong>AG</strong> (SEL) in er den Vorstandsvorsitz der Rhein-<br />
(Börsen-Zeitung, 2. 12. 2000)<br />
„Automotive inside“: Für den 6-Zylinder-Boxter-Motor (Porsche) liefert die zum<br />
Rheinmetall-Konzern gehörende Kolbenschmidt-Pierburg-Gruppe den kompletten<br />
Aluminium-Motorblock, Kolben, Gleitlager sowie Öl- und Wasserpumpen.<br />
Vorstandschef Eberhardt wertet es als<br />
klaren Vertrauensbeweis, daß trotz<br />
dieses Verstoßes gegen die Covenants<br />
alle 21 Institute des international<br />
zusammengesetzten Konsortiums<br />
die dinglich nicht gesicherte Kreditfazilität<br />
ohne Abstriche aufrechterhalten<br />
haben.<br />
Entgegen allen anders lautenden<br />
Spekulationen ist sich der Rheinmetall-Chef<br />
des Rückhalts des Mehrheitsaktionärs<br />
Röchling sicher, seit der<br />
neue Aufsichtsratsvorsitzende Werner<br />
Engelhardt, der Vorsitzende der Geschäftsführung<br />
der Gebr. Röchling und<br />
Räumt Minen: der „Keiler“ von Rheinmetall-“Defence“.<br />
der Röchling Industrie Verwaltung<br />
GmbH, vor den Aktionären klipp und<br />
klar erklärte, daß der Familienverband<br />
nach wie vor fest zu Rheinmetall steht<br />
und seine Mehrheit von rund 66% der<br />
Stammaktien als ein maßgebliches industrielles<br />
Engagement betrachtet.<br />
Röchling erwarte allerdings eine angemessene<br />
Dividende sowie eine dauerhafte<br />
Wertsteigerung des Unternehmens,<br />
„die sich dann auch im Aktienkurs<br />
niederschlagen muß“.<br />
Der Forderung nach einer angemessenen<br />
Dividende ist Rheinmetall in<br />
der Vergangenheit stets nachgekommen,<br />
auch dann, wenn – wie zuletzt<br />
für 1999 – das operative Ergebnis<br />
nicht ausreichte. Die Ansprüche an die<br />
Wertsteigerung und den Aktienkurs<br />
hingegen blieben seit dem Sommer<br />
1998 unerfüllt, denn seit dem damaligen<br />
Gipfel von 32 € befand sich das<br />
Papier auf Talfahrt. Als sich der Staub<br />
nach der angeblichen Finanzkrise zu<br />
legen begann, kam der nächste<br />
Nackenschlag, als Rheinmetall am 16.<br />
November aus dem Index MSCI flog.<br />
Dem folgte ein Absturz auf die bisherige<br />
Talsohle von 6,41 €. Der<br />
Großaktionär könnte sicherlich selbst<br />
etwas für Wertsteigerung und Aktienkurs<br />
tun, wenn er dem Gedanken<br />
näher träte, durch Abschaffung der<br />
stimmrechtslosen Vorzugsaktien den<br />
Free Float nennenswert zu verbreitern,<br />
um möglicherweise wieder Gnade<br />
beim MSCI zu finden . . .<br />
Um den ersten Beweis anzutreten,<br />
daß sein Weg der richtige ist, kämpft<br />
Eberhardt darum, seine Prognose für<br />
das zu Ende gehende Jahr zu erfüllen.<br />
Mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern<br />
und Abschreibungen will er bei 400<br />
(305) Mill. € landen und damit das<br />
Niveau von 378 Mill. € aus dem Jahr<br />
1998 übertreffen. Das Ergebnis vor<br />
Steuern, ursprünglich mit 100 Mill. €<br />
angesetzt, wurde mit 90 Mill. € korrigiert,<br />
weil der Verkauf der Büromöbelsparte<br />
Mauser Waldeck mit einem<br />
Buchverlust einherging.<br />
Daß im<br />
ersten Halbjahr<br />
ein Verlust von 25<br />
Mill. € gezeigt<br />
werden mußte, ist<br />
bei Rheinmetall<br />
üblich. Die Aufholjagd<br />
in der zweiten<br />
Jahreshälfte wird<br />
115 Mill. € einfahren.<br />
Darin enthalten<br />
ist der Turnaround<br />
bei STN<br />
Atlas Elektronik, wo aus einem Verlust<br />
der zweiten Jahreshälfte von 25 Mill. €<br />
in diesem Jahr ein Gewinn von 7 Mill.<br />
€ werden soll.<br />
Die Umsatzrendite diesen Jahres von<br />
voraussichtlich 2,0% liegt noch weit<br />
von Eberhardts Ansprüchen entfernt.<br />
Als Vorgabe für das Jahr 2003 nennt er<br />
5%. Die Eigenkapitalrentabilität will er<br />
auf 20% (2000 voraussichtlich 16,7%)<br />
hochziehen und die Gesamtkapitalrentabilität<br />
bei 12% ansiedeln. Diese<br />
Kennzahl hatte 1999 bei 6,2% gelegen,<br />
und sie wird dieses Jahr auf<br />
10,0% anziehen.<br />
Eberhardt zeigt zwar ausgeprägte<br />
Ambitionen, bei dem von der Bundesregierung<br />
gewünschten Schulterschluß<br />
in der deutschen und später in<br />
der europäischen Heerestechnik mit<br />
Rheinmetall in der ersten Reihe zu stehen.<br />
Gleichwohl soll der Konzern nicht<br />
wieder wehrtechniklastig werden, sondern<br />
eines Tages ausgewogen auf drei<br />
Säulen stehen: In zehn Jahren, so seine<br />
Vorstellung, wird auf Automotive,<br />
Electronics und Defence jeweils ein<br />
Drittel des Umsatzes entfallen. Um dieses<br />
Gleichgewicht zu finden, wird der<br />
Elektronik-Bereich mit seinem aktuellen<br />
Gewicht von 16% am stärksten<br />
wachsen müssen. Das bedeutet, daß<br />
sich an die Konsolidierungspause alsbald<br />
eine offensive Phase anschließen<br />
muß.








![PDF [1.0 MB] - KSPG AG](https://img.yumpu.com/5513074/1/171x260/pdf-10-mb-kspg-ag.jpg?quality=85)