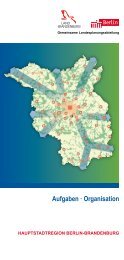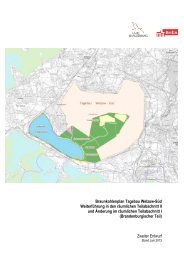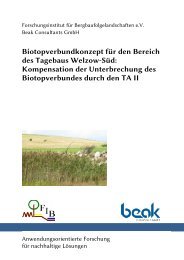MORO - Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
MORO - Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
MORO - Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fachbeiträge<br />
Prof. Dr. Hans Heinrich Blotevogel<br />
Präsident der Akademie für Raumforschung und Landesplanung<br />
Die Bedeutung von Stadt–Land–Partnerschaften<br />
Der Begriff Stadt–Land–Partnerschaften hat sowohl in der<br />
nationalen Raumordnungspolitik als auch auf Ebene der EU<br />
seit etwa zehn Jahren Konjunktur. Großräumige Partnerschaften<br />
gehen dabei über die klassische Stadt–Land–Beziehung<br />
hinaus. Die Räume haben ein gemeinsames „territoriales<br />
Kapital“. Angestrebt ist ein Arbeiten auf gleicher Augen höhe.<br />
Wichtige Voraussetzungen für tragfähige Partnerschaften<br />
sind Prozessorientierung, Dynamik und Konsensprinzip.<br />
Die Prozesse der Zusammenarbeit müssen vom „Government“<br />
zur „Governance“ entwickelt werden – kurz: nicht „gut, dass<br />
wir darüber gesprochen haben“, sondern „wir verein baren,<br />
wie die Dinge umgesetzt werden“.<br />
Typische Koope rationsfelder sind horizontale Kooperationen<br />
in den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft,<br />
Kultur, Tourismus, Energie, Verkehr, Umwelt u.a.m. Mit diesem<br />
Partnerschaftsansatz werden tradierte Sichtweisen angepasst.<br />
Eine Abkehr von der traditionellen Großstadtfeindlichkeit<br />
hin zur Vielfalt von Stadt, kleineren Zentren im Raum<br />
und einem Bewusstsein für „das Land als Stärke“. Damit ist<br />
kein Paradigmenwechsel im Sinne einer Abkehr vom Ausgleich<br />
zwischen Stadt und Land gemeint, sondern eine Neuorientierung<br />
auf notwendige Voraussetzungen tragfähiger Partnerschaften.<br />
Das Raumordnungs–Leitbild „Wachstum und Innovation“ der<br />
Ministerkonferenz für Raumordnung (2006), das den <strong>MORO</strong>–<br />
Vorhaben zugrunde liegt, ist im fachpolitischen wie wissenschaftlichen<br />
Bereich kontrovers diskutiert worden. Teilweise<br />
wurde eine Abkehr vom bisherigen Ausgleichsziel „Schaffung<br />
gleichwertiger Lebensverhältnisse“ zwischen Stadt und<br />
Land unterstellt. Tatsächlich wird endlich die Rolle der gro ßen<br />
Städte und Verdichtungsräume für die Raumentwicklung angemessen<br />
berücksichtigt. Das tradierte Ressourcentransferdenken<br />
wird überwunden.<br />
Heute stehen alle Gebietskategorien – Metropolregionen<br />
ebenso wie ländliche Räume – mit ihren spezifischen Heraus<br />
3<br />
forderungen, Problemen und Entwicklungschancen im Fokus<br />
(„place based approach“). Die territoriale Vielfalt wird dabei<br />
als Stärke gesehen. Komplementäre regionale Stärken können<br />
durch territoriale Kooperationen genutzt werden.<br />
Stadt–Land–Partnerschaften solch neuer Ausrichtung und<br />
neuen Zuschnitts haben Chancen und Grenzen. Wichtig ist,<br />
die Erwartungen auf ein realistisches Maß zu begrenzen – zu<br />
hoch gesteckte Erwartungen würden zwangsläufig zu Enttäuschungen<br />
führen.<br />
Aktuelle zivilgesellschaftliche Fragen wie „Stuttgart 21“,<br />
machen Anforderungen an die Weiterentwicklung der bisherigen,<br />
formalisierten Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich.<br />
Diesen Aufgaben wird man sich in Zukunft stellen müssen.<br />
Ansätze, welche die Bürgerbeteiligung als „lästige Pflicht“<br />
begreifen, sind nicht zukunftsfähig. Der Prozess des Umdenkens<br />
hat aber bereits begonnen.