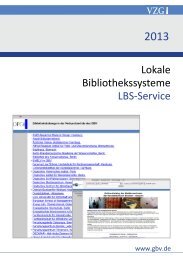Entwicklung einer Referenzkörnung für die Alkali-Kieselsäure - GBV
Entwicklung einer Referenzkörnung für die Alkali-Kieselsäure - GBV
Entwicklung einer Referenzkörnung für die Alkali-Kieselsäure - GBV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN<br />
Tabelle 3.5: Chemische Zusammensetzung der Borosilikatglasperlen lt. Herstellerangaben<br />
42<br />
Chemische Verbindung Anteil in M-%<br />
SiO2<br />
B2O3<br />
81,20<br />
12,30<br />
Na2O 3,13<br />
Al2O3<br />
2,34<br />
K2O 0,85<br />
Gegenüber dem Borosilikatglasmehl, welches <strong>für</strong> <strong>die</strong> gesinterten Glasperlen verwendet<br />
wurde, fällt der SiO2-Gehalt bei den Kugeln aus industrieller Herstellung zwar geringfügig<br />
höher und der Gehalt an Na2O etwas niedriger aus, dennoch sind <strong>die</strong> jeweiligen<br />
Zusammensetzungen sehr ähnlich und daher gut vergleichbar.<br />
Für <strong>die</strong> Versuche wurden Borosilikatglasperlen (Rohdichte 2,23 g/cm³) der Korngröße<br />
3 mm verwendet. Diese sind praktisch porenfrei gesintert (Porosität 0,18 %) und weisen<br />
aufgrund ihrer mechanischen Nachbearbeitung eine matte Oberfläche auf.<br />
Da sich Borosilikatglasscherben als überempfindlich erwiesen haben, wurde außerdem<br />
nach <strong>einer</strong> Möglichkeit gesucht, <strong>die</strong> Reaktivität der Glasperlen zu beeinflussen, <strong>die</strong>se<br />
also herabsetzen zu können, falls <strong>die</strong>s nötig sein sollte. Daher wurden <strong>die</strong> Glaskugeln<br />
sowohl im ursprünglichen Zustand als auch mit geätzter Oberfläche in den Probekörpern<br />
verwendet. Borosilikatglas ist chemisch sehr beständig, weshalb es auch zur Herstellung<br />
von Laborgläsern und –gefäßen verwendet wird. Die Oberflächenätzung erfolgte<br />
daher mit 5%iger Flusssäure, <strong>die</strong> über eine Dauer von 20 min einwirkte. Flusssäure<br />
greift das Glas dahingehend an, dass sie seine Hauptkomponente, das SiO2, in Lösung<br />
bringt:<br />
SiO2 + 6HF → H2(SiF6) + H2O (3.1)<br />
Die Reaktionsgleichung gibt den Angriff durch Flusssäure allerdings nur stark vereinfacht<br />
wieder, denn in der Praxis lagern sich <strong>die</strong> Reaktionsprodukte an der Oberfläche ab<br />
und beeinflussen damit den weiteren Verlauf des Ätzens [Scho88].<br />
Zum Vergleich der unbehandelten mit der geätzten Probe wurde eine Elektronenstrahl-<br />
Mikrosonden-Untersuchung durchgeführt. Damit können chemische Elemente ab der<br />
Ordnungszahl 5 (Bor) qualitativ und quantitativ nachgewiesen werden. Chemische Zonierungen<br />
in Feststoffen lassen sich so im Bereich von wenigen µm bestimmen. Die<br />
Untersuchungsergebnisse <strong>für</strong> Bor in der Oberflächenschicht der unbehandelten und der<br />
geätzten Probe sind in Bild 3.7 und in Bild 3.8 wiedergegeben.<br />
Während bei der unbehandelten Probe <strong>die</strong> Intensität des Bors von der Glasperlenoberfläche<br />
nach innen gleichbleibend verteilt ist, ergibt sich bei der geätzten Probe eine gesteigerte<br />
Intensität des Bors über <strong>die</strong> ersten 2 µm an der Oberfläche, fällt dann leicht ab<br />
und verläuft nach insgesamt 3 µm wieder auf gleich bleibendem Level. Durch <strong>die</strong> Ätzung<br />
reichern sich also Borat-Verbindungen an der Glasperlenoberfläche an.