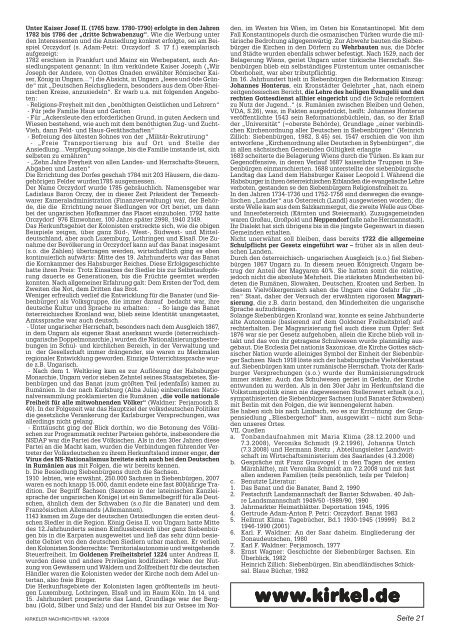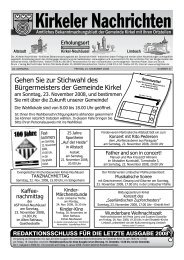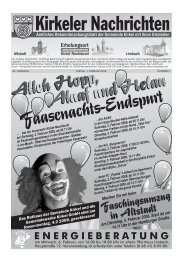Danke! - Kirkel
Danke! - Kirkel
Danke! - Kirkel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unter Kaiser Josef II. (1765 bzw. 1780-1790) erfolgte in den Jahren<br />
1782 bis 1786 der „dritte Schwabenzug“. Wie die Werbung unter<br />
den Interessenten und die Ansiedlung konkret erfolgte, sei am Beispiel<br />
Orczydorf (s. Adam-Petri: Orczydorf S. 17 f.) exemplarisch<br />
aufgezeigt:<br />
1782 erschien in Frankfurt und Mainz ein Werbepatent, auch Ansiedlungspatent<br />
genannt: In ihm verkündete Kaiser Joseph („Wir<br />
Joseph der Andere, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser,<br />
König in Ungarn…“) die Absicht, in Ungarn „leere und öde Gründe“<br />
mit „Deutschen Reichsgliedern, besonders aus dem Ober-Rheinischen<br />
Kreise, anzusiedeln“. Er warb u.a. mit folgenden Angeboten:<br />
- Religions-Freyheit mit den „benöthigten Geistlichen und Lehrern“<br />
- Für jede Familie Haus und Garten<br />
- Für „Ackersleute den erforderlichen Grund, in guten Aeckern und<br />
Wiesen bestehend, wie auch mit dem benöthigten Zug- und Zucht-<br />
Vieh, dann Feld- und Haus-Geräthschaften“<br />
- Befreiung des ältesten Sohnes von der „Militär-Rekrutirung“<br />
- „Freie Transportierung bis auf Ort und Stelle der<br />
Ansiedlung…Verpflegung solange, bis die Familie imstande ist, sich<br />
selbsten zu ernähren“<br />
- „Zehn Jahre Freyheit von allen Landes- und Herrschafts-Steuern,<br />
Abgaben und Lasten“<br />
Die Errichtung des Dorfes geschah 1784 mit 203 Häusern, die dazugehörigen<br />
Felder wurden1785 ausgemessen.<br />
Der Name Orczydorf wurde 1785 gebräuchlich. Namensgeber war<br />
Ladislaus Baron Orczy, der in dieser Zeit Präsident der Temeschwarer<br />
Kameraladministration (Finanzverwaltung) war, der Behörde,<br />
die die Errichtung neuer Siedlungen vor Ort beriet, um dann<br />
bei der ungarischen Hofkammer das Placet einzuholen. 1792 hatte<br />
Orczydorf 976 Einwohner, 100 Jahre später 2998, 1940 2149.<br />
Das Herkunftsgebiet der Kolonisten erstreckte sich, wie die obigen<br />
Beispiele zeigen, über ganz Süd-, West-, Südwest- und Mitteldeutschland,<br />
aber auch Luxemburg, Lothringen und Elsaß. Die Zunahme<br />
der Bevölkerung in Orczydorf kann auf das Banat insgesamt<br />
(s.o. die Zahlen) übertragen werden, wirtschaftlich ging es eben<br />
kontinuierlich aufwärts: Mitte des 19. Jahrhunderts war das Banat<br />
die Kornkammer des Habsburger Reiches. Diese Erfolgsgeschichte<br />
hatte ihren Preis: Trotz Einsatzes der Siedler bis zur Selbstaufopferung<br />
dauerte es Generationen, bis die Früchte geerntet werden<br />
konnten. Nach allgemeiner Erfahrung galt: Dem Ersten der Tod, dem<br />
Zweiten die Not, dem Dritten das Brot.<br />
Weniger erfreulich verlief die Entwicklung für die Banater (und Siebenbürger)<br />
als Volksgruppe, die immer darauf bedacht war, ihre<br />
deutsche Kultur und Sprache zu erhalten: - So lange das Banat<br />
österreichisches Kronland war, blieb seine Identität unangetastet,<br />
Amtssprache war auch deutsch.<br />
- Unter ungarischer Herrschaft, besonders nach dem Ausgleich 1867,<br />
in dem Ungarn als eigener Staat anerkannt wurde (österreichischungarische<br />
Doppelmonarchie,) wurden die Nationalisierungsbestrebungen<br />
im Schul- und kirchlichen Bereich, in der Verwaltung und<br />
in der Gesellschaft immer drängender, sie waren zu Merkmalen<br />
regionaler Entwicklung geworden. Einzige Unterrichtssprache wurde<br />
z.B. Ungarisch.<br />
- Nach dem 1. Weltkrieg kam es zur Auflösung der Habsburger<br />
Monarchie, Ungarn verlor sieben Zehntel seines Staatsgebietes, Siebenbürgen<br />
und das Banat (zum größten Teil jedenfalls) kamen zu<br />
Rumänien. In der nach Karlsburg (Alba Julia) einberufenen Nationalversammlung<br />
proklamierten die Rumänen „die volle nationale<br />
Freiheit für alle mitwohnenden Völker“ (Waldner: Perjamosch S.<br />
40). In der Folgezeit war das Hauptziel der volksdeutschen Politiker<br />
die gesetzliche Verankerung der Karlsburger Versprechungen, was<br />
allerdings nicht gelang.<br />
- Enttäuscht ging der Blick dorthin, wo die Betonung des Völkischen<br />
zur Programmatik rechter Parteien gehörte, insbesondere die<br />
NSDAP war die Partei des Völkischen. Als in den 30er Jahren diese<br />
Partei an die Macht kam, wurden die Verbindungen führender Vertreter<br />
der Volksdeutschen zu ihrem Herkunftsland immer enger, der<br />
Virus des NS-Nationalismus breitete sich auch bei den Deutschen<br />
in Rumänien aus mit Folgen, die wir bereits kennen.<br />
b. Die Besiedlung Siebenbürgens durch die Sachsen.<br />
1910 lebten, wie erwähnt, 250.000 Sachsen in Siebenbürgen, 2007<br />
waren es noch knapp 15.000, damit endete eine fast 800jährige Tradition.<br />
Der Begriff Sachsen (Saxones in der lateinischen Kanzleisprache<br />
der ungarischen Könige) ist ein Sammelbegriff für alle Deutschen,<br />
ähnlich dem der Schwaben (s.o.für die Banater) und dem<br />
Französischen Allemands (Allemannen).<br />
1143 kamen im Zuge der deutschen Ostsiedlungen die ersten deutschen<br />
Siedler in die Region. König Geisa II. von Ungarn hatte Mitte<br />
des 12.Jahrhunderts seinen Einflussbereich über ganz Siebenbürgen<br />
bis in die Karpaten ausgeweitet und ließ das sehr dünn besiedelte<br />
Gebiet von den deutschen Siedlern urbar machen. Er verlieh<br />
den Kolonisten Sonderrechte: Territorialautonomie und weitgehende<br />
Steuerfreiheit. Im Goldenen Freiheitsbrief 1224 unter Andreas II.<br />
wurden diese und andere Privilegien kodifiziert: Neben der Nutzung<br />
von Gewässern und Wäldern und Zollfreiheit für die deutschen<br />
Händler waren die Kolonisten weder der Kirche noch dem Adel untertan,<br />
also freie Bürger.<br />
Die Herkunftsgebiete der Kolonisten lagen größtenteils im heutigen<br />
Luxemburg, Lothringen, Elsaß und im Raum Köln. Im 14. und<br />
15. Jahrhundert prosperierte das Land, Grundlage war der Bergbau<br />
(Gold, Silber und Salz) und der Handel bis zur Ostsee im Nor-<br />
den, im Westen bis Wien, im Osten bis Konstantinopel. Mit dem<br />
Fall Konstantinopels durch die osmanischen Türken wurde die miltärische<br />
Bedrohung allgegenwärtig. Zur Abwehr bauten die Siebenbürger<br />
die Kirchen in den Dörfern zu Wehrbauten aus, die Dörfer<br />
und Städte wurden ebenfalls schwer befestigt. Nach 1529, nach der<br />
Belagerung Wiens, geriet Ungarn unter türkische Herrschaft. Siebenbürgen<br />
blieb ein selbständiges Fürstentum unter osmanischer<br />
Oberhoheit, war aber tributpflichtig.<br />
Im 16. Jahrhundert hielt in Siebenbürgen die Reformation Einzug:<br />
Johannes Honterus, ein Kronstädter Gelehrter „hat, nach einem<br />
zeitgenössischen Bericht, die Lehre des heiligen Evangelii und den<br />
rechten Gottesdienst allhier eingericht und die Schule reformiert<br />
zu Nutz der Jugend..“ (s. Rumänien zwischen Bleiben und Gehen,<br />
VDA, S.26), was, in Fakten ausgedrückt, heißt: Johannes Honterus<br />
veröffentlichte 1543 sein Reformationsbüchlein, das, so der Erlaß<br />
der „Universität“ (=oberste Behörde), Grundlage „einer verbindlichen<br />
Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen“ (Heinrich<br />
Zillich: Siebenbürgen, 1982, S.45) sei. 1547 erschien die von ihm<br />
entworfene „Kirchenordnung aller Deutschen in Sybenbürgen“, die<br />
in allen sächsischen Gemeinden Gültigkeit erlangte<br />
1683 scheiterte die Belagerung Wiens durch die Türken. Es kam zur<br />
Gegenoffensive, in deren Verlauf 1687 kaiserliche Truppen in Siebenbürgen<br />
einmarschierten. 1688 unterstellte der siebenbürgische<br />
Landtag das Land dem Habsburger Kaiser Leopold I. Während die<br />
Habsburger in ihren österreichischen Erblanden die evangelische Lehre<br />
verboten, gestanden se den Siebenbürgern Religionsfreiheit zu.<br />
In den Jahren 1734-1736 und 1752-1756 sind deswegen die evangelischen<br />
„Landler“ aus Österreich (Landl) ausgewiesen worden; die<br />
erste Welle kam aus dem Salzkammergut, die zweite Welle aus Oberund<br />
Innerösterreich (Kärnten und Steiermark). Zuzugsgemeinden<br />
waren Großau, Großpold und Neppendorf (alle nahe Hermannstadt).<br />
Ihr Dialekt hat sich übrigens bis in die jüngste Gegenwart in diesen<br />
Gemeinden erhalten.<br />
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass bereits 1722 die allgemeine<br />
Schulpflicht per Gesetz eingeführt war – früher als in allen deutschen<br />
Landen.<br />
Durch den österreichisch- ungarischen Ausgleich (s.o.) fiel Siebenbürgen<br />
1867 Ungarn zu. In diesem neuen Königreich Ungarn betrug<br />
der Anteil der Magyaren 40%. Sie hatten somit die relative,<br />
jedoch nicht die absolute Mehrheit. Die stärksten Minderheiten bildeten<br />
die Rumänen, Slowaken, Deutschen, Kroaten und Serben. In<br />
diesem Vielvölkergemisch sahen die Ungarn eine Gefahr für „ihren“<br />
Staat, daher der Versuch der erwähnten rigorosen Magyarisierung,<br />
die z.B. darin bestand, den Minderheiten die ungarische<br />
Sprache aufzudrängen.<br />
Solange Siebenbürgen Kronland war, konnte es seine Jahrhunderte<br />
alte Autonomie (basierend auf dem Goldener Freiheitsbrief) aufrechterhalten.<br />
Der Magyarisierung fiel auch diese zum Opfer: Seit<br />
1876 war sie per Gesetz aufgehoben, allein die Kirche blieb voll intakt<br />
und das von ihr getragene Schulwesen wurde planmäßig ausgebaut.<br />
Die Ecclesia Dei nationis Saxonicae, die Kirche Gottes sächsischer<br />
Nation wurde alleiniges Symbol der Einheit der Siebenbürger<br />
Sachsen Nach 1918 löste sich der habsburgische Vielvölkerstaat<br />
auf. Siebenbürgen kam unter rumänische Herrschaft. Trotz der Karlsburger<br />
Versprechungen (s.o.) wurde der Rumänisierungsdruck<br />
immer stärker. Auch das Schulwesen geriet in Gefahr, der Kirche<br />
entwunden zu werden. Als in den 30er Jahr im Herkunftsland die<br />
Volkstumspolitik einen nie dagewesenen Stellenwert erhielt (s.o.),<br />
sympathisierten die Siebenbürger Sachsen (und Banater Schwaben)<br />
mit Berlin mit den Folgen, die wir kennengelernt haben.<br />
Sie haben sich bis nach Limbach, wo es zur Errichtung der Gruppensiedlung<br />
„Bliesbergerhof“ kam, ausgewirkt – nicht zum Schaden<br />
unseres Ortes.<br />
VII. Quellen<br />
a. Tonbandaufnahmen mit Maria Klima (28.12.2000 und<br />
7.3.2008), Veronika Schmidt (9.2.1996), Johanna Untch<br />
(7.3.2008) und Hermann Steitz , Abteilungsleiter Landwirtschaft<br />
im Wirtschaftsministerium des Saarlandes (4.3.2008)<br />
b. Gespräche mit Franz Grauvogel ( in den Tagen der ersten<br />
Märzhälfte), mit Veronika Schmidt am 7.2.2008 und mit fast<br />
allen anderen Familien (teils persönlich, teils per Telefon)<br />
c. Benutzte Literatur:<br />
1. Das Banat und die Banater, Band 2, 1990<br />
2. Festschrift Landsmannschaft der Banter Schwaben. 40 Jahre<br />
Landsmannschaft 1949/50 -1989/90, 1990<br />
3. Jahrmarkter Heimatblätter. Deportation 1945, 1995<br />
4. Gertrude Adam-Anton P. Petri: Orczydorf. Banat 1983<br />
5. Hellmut Klima: Tagebücher, Bd.1 1930-1945 (19999) Bd.2<br />
1946-1990 (2001)<br />
6. Karl. F. Waldner: An der Saar daheim. Eingliederung der<br />
Donaudeutschen, 1980<br />
7. Karl F. Waldner: Perjamosch, 1977<br />
8. Ernst Wagner: Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Ein<br />
Überblick, 1982<br />
Heinrich Zillich: Siebenbürgen. Ein abendländisches Schicksal.<br />
Blaue Bücher, 1982<br />
www www.kirkel.de<br />
www .kirkel.de<br />
KIRKELER NACHRICHTEN NR. 19/2008 Seite 21