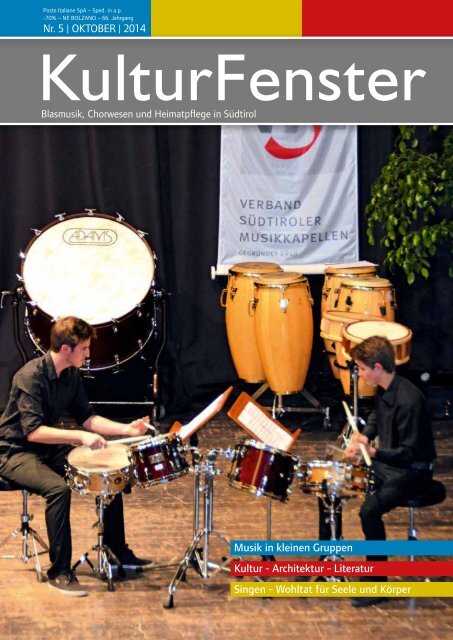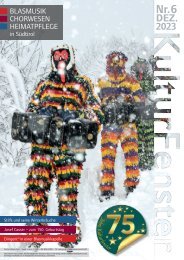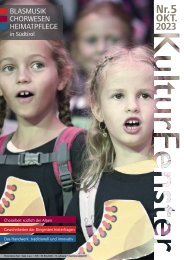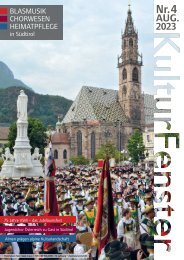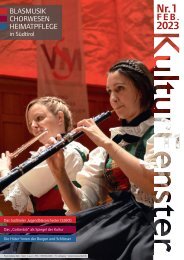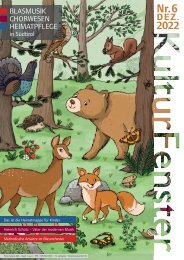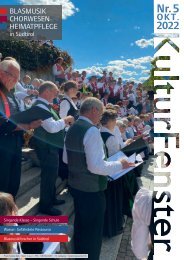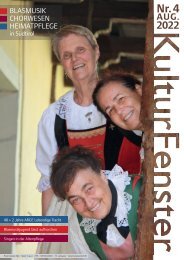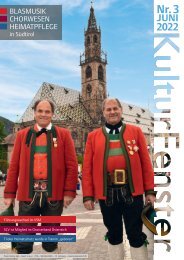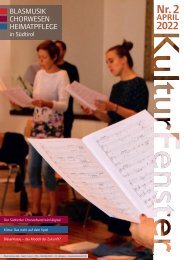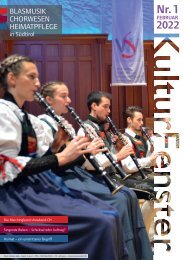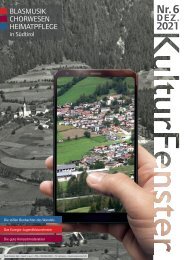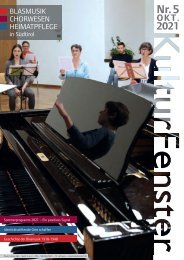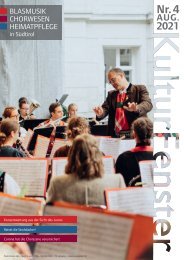KulturFenster Nr. 05|2014 - Oktober 2014
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Poste Italiane SpA – Sped. in a.p.<br />
-70% – NE BOLZANO – 66. Jahrgang<br />
<strong>Nr</strong>. 5 | OKTOBER | <strong>2014</strong><br />
<strong>KulturFenster</strong><br />
Blasmusik, Chorwesen und Heimatplege in Südtirol<br />
Musik in kleinen Gruppen<br />
Kultur - Architektur - Literatur<br />
Singen - Wohltat für Seele und Körper
• Geleitwort •<br />
Das Glück des Musizierens<br />
• Inhalt •<br />
• Blasmusik<br />
Eine Studie der Universitäten Graz und<br />
Heidelberg bestätigte kürzlich, dass junge<br />
Menschen, die ein Instrument lernen, für<br />
ihr ganzes Leben ein Potential erwerben,<br />
das nicht hoch genug eingeschätzt werden<br />
kann. Die beiden Unis führten bei rund 150<br />
Schülerinnen und Schülern Tests durch,<br />
die sich über Jahre erstreckten und signifikante<br />
Unterschiede zu Tage förderten: Aufgrund<br />
von psychoakustischen Messungen,<br />
verbunden mit psychologischen Tests und<br />
Kreativtests sowie Kernspintomografie und<br />
Magnetenzephalografie, zeigte sich, dass<br />
Kinder, die ein Instrument lernen, beim<br />
Zuhören konzentrierter sind, sich besser<br />
unter Kontrolle haben und auch bei Lesen<br />
und Rechtschreiben im Vorteil sind. Überhaupt<br />
stellten die Wissenschaftler fest, dass<br />
diese Kinder eine bessere Hörfähigkeit entwickeln<br />
und mit dem Musikunterricht eine<br />
Entwicklung der für Sprache und Hören<br />
zuständigen Gehirnareale einhergeht. Gerade<br />
in einer Zeit wie der unseren, in der<br />
• Heimatplege<br />
junge Menschen häufig in einer Umgebung<br />
mit großer Reizüberflutung aufwachsen,<br />
komme dem praktischen Instrumentalunterricht<br />
(und auch dem Singen) eine<br />
zunehmend größere Bedeutung zu, gerade<br />
auch um Störungen im Lern- und Sozialverhalten<br />
vorzubeugen, so die Wissenschaftler.<br />
In Südtirol mit seiner blühenden Musiklandschaft<br />
lernen Tausende und Abertausende<br />
von jungen Menschen ein Instrument. Vorreiter<br />
sind mit den Eltern die Musikschulen<br />
und mit ihnen Hand in Hand die Musikkapellen.<br />
Eine besondere Plattform ist das<br />
Spiel in kleinen Gruppen, das sich mittlerweile<br />
als fester Bestandteil in den Fortbildungsprogrammen<br />
des VSM etabliert hat.<br />
Im Zusammenspiel der einzelnen Register<br />
müssen – bei Jung und Alt – die Ensemblemitglieder<br />
in Tempo, Rhythmus, Dynamik,<br />
Klangfarbe und Intonation ein eigenes musikalisches<br />
Konzept erarbeiten. Wenn das<br />
gelingt, ist das nicht nur musikalisch, sondern<br />
auch sozial von enormem Wert.<br />
Alfons Gruber<br />
• Chorwesen<br />
Jugend weitteifert in kleinen Gruppen 4<br />
Literaturempfehlung für Blasmusikwerke 6<br />
Großer Zuwachs bei den JMLA-Prüfungen 7<br />
220 Jungmusikanten bilden sich fort 8<br />
Latsch - im Zeichen der Blasmusik 9<br />
Jugendkapellen des Pustertales<br />
in St. Lorenzen 10<br />
Südtiroler zu Gast bei<br />
Wiener Philharmonikern 11<br />
Toni Profanter 60 15<br />
Alberto Promberger:<br />
Wenn man sich Ziele setzt... 16<br />
Mit Blasmusik durch die EU:<br />
Großbritannien - Italien 18<br />
Landesmusikfest Mai 2015 in Brixen -<br />
Vorschau 20<br />
Südtiroler Blasmusiktage in Bozen 21<br />
Musikpanorama 25<br />
Kleine Beiträge, die Großes bewirken 29<br />
Küchelbergtunnel - großer Eingriff in Meran 30<br />
Naturpark Drei Zinnen - Einwand 31<br />
Wie gehen wir mit Natur respektvoll um 32<br />
Terrassenbau Steinegg<br />
Lokalaugenschein 33<br />
Sichtbare Geschichte in Vilpian 34<br />
Heimatschutzverein Meran:<br />
Markante Schwerpunkte 35<br />
Geplante Bushaltestelle am<br />
Marconipark in Meran 37<br />
Rundschau 38<br />
Arge Lebendige Tracht:<br />
Silberne Edelweiß 39<br />
Mundartdichterinnen in Aldein 40<br />
Hoangart auf Schloss Prösels 41<br />
Die Macht des Singens 43<br />
Singen fördert Gehirn-Entwicklung 44<br />
Chöre-Festival auf Schloss Rodenegg 46<br />
Trautmannsdorf: Tag der Chöre 48<br />
Bezirk Bozen: Kulturfahrt nach Kufstein 50<br />
Chorleiterseminar: Abschlusskonzert 51<br />
Jugendliche im ,,Musical-Fieber" 52<br />
Burgeis: Abschlusskonzert der<br />
Chor- und Stimmbildungswoche 53<br />
Sängerwanderung des<br />
Bezirks Burggrafenamt-Vinschgau 55<br />
Titelbild: Schlagzeug-Duo "Die Zwei" (Julian Gruber und Elias Egger) beim VSM-Landeswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" <strong>2014</strong> in Auer<br />
2<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Vorweg<br />
Blasmusik<br />
Musik in kleinen Gruppen<br />
„Talent ist unbezahlbar, die Förderung von Talenten schon“.<br />
VSM-Verbandsjugendleiter Meinhard<br />
Windisch sieht in der „Musik in kleinen<br />
Gruppen“ großes Potential für die<br />
persönliche musikalische Entwicklung.<br />
Das Musizieren in kleinen Gruppen fördert auch das Zusammenspiel im großen<br />
Blasorchester.<br />
Das Musizieren im kleinen Kreis hat die<br />
Menschen schon immer fasziniert. Denken<br />
wir nur an das große Repertoire der<br />
Kammermusik, die ausgehend vom späten<br />
16. Jahrhundert die europäische Musikgeschichte<br />
mitgeprägt hat.<br />
Dies gilt heute natürlich auch für das<br />
Musizieren in kleinen Gruppen. Wenn<br />
seine Entstehung auch nicht direkt aus<br />
der Kammermusik abzuleiten ist, hat es<br />
aber wohl den gleichen Reiz. Das „Spiel<br />
in kleinen Gruppen“ - seit 1990 „Musik in<br />
kleinen Gruppen“ genannt - wurde 1947<br />
erstmals eingeführt, und in regelmäßigen<br />
Abständen wurden hierzu Wettbewerbe<br />
ausgeschrieben. 1976 wurde in Linz der<br />
erste Bundeswettbewerb“ Spiel in kleinen<br />
Gruppen“ veranstaltet. Dies bewirkte natürlich<br />
auch, dass damit einhergehend Literatur<br />
für die verschiedenen Besetzungen<br />
entstand. Dank dieser Entwicklung kön-<br />
nen wir heute auf ein reichhaltiges Repertoire<br />
an Ensemble-Literatur zurückgreifen.<br />
Das Musizieren im Ensemble, vom Duo<br />
bis zum Oktett, begleitet heute Klein und<br />
Groß auf Ihrem musikalischen Weg und<br />
stellt so einen wichtigen Bestandteil zur<br />
Förderung des musikalischen Niveaus in<br />
den Musikschulen und Musikkapellen dar.<br />
Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />
ist ein wichtiger Anreiz dies ebenfalls<br />
zu fördern und weiter zu tragen. An<br />
dieser Stelle möchte ich den ÖBV-Präsidenten<br />
Matthäus Rieger zitieren: „Talent<br />
ist unbezahlbar, die Förderung von Talenten<br />
schon“.<br />
In diesem Sinne wünsche ich allen Ensembles<br />
viel Freude und unvergessliche<br />
Stunden beim diesjährigen Bundeswettbewerb<br />
in Toblach.<br />
Meinhard Windisch<br />
VSM-Verbandsjugendleiter<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 3
Das Thema<br />
Jugend wetteifert mit Musik<br />
in kleinen Gruppen<br />
Bundeswettbewerb der Österreichischen Blasmusikjugend heuer in Toblach zu Gast<br />
Bewertung<br />
Mit dem Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ wird Toblach am 25. und<br />
26. <strong>Oktober</strong> einmal mehr zum „Musikknotenpunkt“.<br />
Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />
wird von der österreichischen Blasmusikjugend<br />
im 2-Jahres-Rhythmus ausgeschrieben.<br />
Die Landesverbände des<br />
österreichischen Blasmusikverbandes sowie<br />
die beiden Partnerverbände Südtirol<br />
und Liechtenstein führen eigene Landeswettbewerbe<br />
für „Musik in kleinen Gruppen“<br />
durch. Der Bundeswettbewerb im <strong>Oktober</strong><br />
<strong>2014</strong> wird von der österreichischen<br />
Blasmusikjugend in enger Zusammenarbeit<br />
mit dem Verband Südtiroler Musikkapellen<br />
organisiert und in Toblach durchgeführt.<br />
Im Jahr 1976 wurde vom österreichischen<br />
Blasmusikwettbewerb der Bundeswettbewerb<br />
„Spiel in kleinen Gruppen“ als<br />
Beitrag zum Österreichischen Nationalfeiertag<br />
am 26. <strong>Oktober</strong> erstmals ausgeschrieben.<br />
24 Ensembles in unterschiedlichen Besetzungen<br />
stellten sich am 26.10.1976 im<br />
Bruckner-Konservatorium in Linz der Jury.<br />
Seitdem finden nun im 2-Jahres-Rhythmus,<br />
zuerst auf Landesebene und darauffolgend<br />
im Herbst auf Bundesebene, Wettbewerbe<br />
für „Musik in kleinen Gruppen“<br />
statt. Waren es zu Beginn noch 24 Ensembles,<br />
steigerte sich die Anzahl der Teilnehmer<br />
im Laufe der Jahre. Für den anstehenden<br />
Bundeswettbewerb im <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />
in Toblach wurden von den Landes- und<br />
Partnerverbänden über 50 Ensembles in<br />
vier verschiedenen Kategorien (Holzbläser,<br />
Blechbläser, Schlagwerk und gemischte Ensembles)<br />
gemeldet. Im Laufe der Zeit hat<br />
es eine beeindruckende Entwicklung der<br />
Qualität gegeben. Auch im Wettbewerbsablauf<br />
kam es zu einigen Änderungen:<br />
Besetzungen<br />
Ein Ziel war und ist es, neben den Holzund<br />
Blechbläsern auch die Teilnahme von<br />
Schlagwerkern zu forcieren, weshalb eine<br />
eigene Kategorie für Schlagwerker eingeführt<br />
wurde. Weiters wurde im Lauf der<br />
Zeit eine eigene Sondergruppe installiert,<br />
womit der Wettbewerb für die in den Reihen<br />
der Musikkapellen tätigen „Professionisten“,<br />
d.h. Musikstudierenden bzw.<br />
Absolventen von Musikuniversitäten und<br />
Konservatorien sehr interessant wurde. Ein<br />
weiteres erklärtes Ziel der Wettbewerbe ist<br />
auch die Förderung von weitmensurierten<br />
Blechinstrumenten und „Mangelinstrumenten“<br />
wie Oboe und Fagott. Auch dem<br />
Umstand, dass das fächerübergreifende<br />
Musizieren in den Musikschulen forciert<br />
wird, wurde mit der Einführung einer eigenen<br />
Kategorie für gemischte Besetzungen<br />
Rechnung getragen.<br />
Die Form der Bewertung der Vorträge änderte<br />
sich mehrmals im Laufe der Jahre. In<br />
den Anfängen des Bundeswettbewerbes wurden<br />
Preise bzw. Ränge vergeben, von 1982<br />
bis 1996 wechselte man zu Prämierungen:<br />
Die Ensembles erspielten sich ausgezeichnete,<br />
sehr gute und gute Erfolge. 1998 kam<br />
man zum Entschluss, ausschließlich Punkte<br />
zu vergeben, was zwei Jahre später – im Jahr<br />
2000 – wieder verworfen wurde. Seit 2004<br />
werden nun die Vorträge nur mehr mit Punkten<br />
bewertet. Jedes Ensemble strebt nach<br />
einer möglichst hohen Punkteanzahl. 1992<br />
schaffte es das Oberösterreichische Klarinettenensemble<br />
„Clarinettissimo“ in Südtirol<br />
erstmals, 100(!) von möglichen 100 Punkten<br />
zu erreichen. Dieses sensationelle Ergebnis<br />
wiederholte sich beim Bundeswettbewerb<br />
in Tulln in Niederösterreich im Jahr<br />
2009, als die „Brass Boys“ aus Kärnten von<br />
der Jury die volle Punkteanzahl bekamen.<br />
Finalrunde<br />
Mit der Novellierung des Statutes „Musik<br />
in kleinen Gruppen“ im Jahr 2010 wurde<br />
eine Finalrunde am zweiten Wettbewerbstag<br />
eingeführt. Beim Wettbewerb in Feldkirch/<br />
Vorarlberg im Jahr 2008 wurde dieses Modell<br />
erprobt und ist seit 2010 fixer Bestand-<br />
„Die Ensemblemitglieder müssen sich einander anpassen und einen gemeinsamen<br />
Weg finden“, sagt Helmut Schmid.<br />
4<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
Helmut Schmid ist Landesmusikschulinspektor in Tirol und als Referatsleiter beim<br />
Amt der Tiroler Landesregierung für die Abteilung Bildung/Musikschulen zuständig.<br />
Sein Studium hat er am Tiroler Landeskonservatorium absolviert. Er war von<br />
1992 bis 2000 Dirigent der Bürgermusik Wenns und seit dem Jahr 2000 leitet er die<br />
Stadtmusikkapelle Landeck.<br />
Im Tiroler Blasmusikverband bekleidete Helmut Schmid von 2001 bis 2010 das Amt<br />
des Landesjugendreferenten. Im Jahr 2007 wurde er zum Bundesjugendreferent-<br />
Stellvertreter im Österreichischen Blasmusikverband bestimmt; seit 2013 hat er die<br />
Funktion des Bundesjugendreferenten (Österreichische Blasmusikjugend) inne.<br />
Zudem ist er Vorsitzender der Konferenz der österreichischen Musikschulwerke.<br />
Auch im VSM ist Helmut Schmid kein Unbekannter mehr. Er war letzthin Wertungsrichter<br />
beim Landesjugendkapellentreffen 2013 in Nals, beim Konzertwertungsspiel<br />
2013 in Vöran sowie beim Landeswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" im heurigen<br />
Frühjahr in Auer.<br />
teil des Bundeswettbewerbes. Die besten Ensembles<br />
des ersten Wettbewerbstages aus<br />
allen vier Kategorien (Holzbläser, Blechbläser,<br />
Schlagwerk und gemischte Ensembles)<br />
stellen sich am zweiten Tag vor versammeltem<br />
Publikum einer erweiterten Finaljury, in<br />
der der Hauptpreisträger des Wettbewerbs<br />
gekürt wird.<br />
Zielsetzung und pädagogische<br />
Hintergründe des Wettbewerbes<br />
„Musik in kleinen Gruppen“<br />
Musizieren im Ensemble ist ein wichtiger<br />
Punkt, um sich selbst und den Verein musikalisch<br />
weiter zu entwickeln. Das Ensemblespiel<br />
ist ein gutes und wichtiges Training,<br />
um gewisse Kenntnisse, wie aufeinander hören,<br />
Zusammenspiel und Intonation weiter<br />
zu entwickeln.<br />
Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />
ist eine Plattform, um genau diese Eigenschaften<br />
zu üben und zu festigen. Die<br />
Motivation eines Musikers, in einem Ensemble<br />
zu musizieren, kann verschiedene Hintergründe<br />
haben. Sehr oft stehen im Mittelpunkt<br />
die Freude und der Spaß am Musizieren<br />
mit Gleichgesinnten, die sich mehr als nur<br />
in der Blasmusik mit dem eigenen Instrument<br />
beschäftigen wollen. Alle Beteiligten<br />
haben ein zusätzliches Ziel, auf das es sich<br />
lohnt hinzuarbeiten. Oft gibt das Ensemblespiel<br />
aber auch die Möglichkeit, sich mit der<br />
eigenen Auftrittsangst zu beschäftigen. Die<br />
Musikerinnen und Musiker sind direkt damit<br />
konfrontiert und sehen aber gleichzeitig,<br />
dass es anderen genauso ergeht. Im Ensemble<br />
können also alle voneinander lernen:<br />
Es wird klar, dass jedes Ensemblemitglied<br />
Stärken und Schwächen hat. Dadurch gelingt<br />
unter anderem auch Nachwuchsmusikern<br />
der Einstieg in den Verein vielleicht um<br />
einiges leichter. Für Instrumente, welche in<br />
der Blasmusik hauptsächlich Begleitfunktionen<br />
übernehmen wie zum Beispiel Tuba<br />
oder Fagott ist das Musizieren im Ensemble<br />
eine Chance, auch einmal einen eigenständigen<br />
Part zu spielen und somit eine<br />
musikalische Führungsrolle zu übernehmen.<br />
Aus Sicht der Musikkapelle fördert das<br />
gemeinsame Musizieren in kleinen Gruppen<br />
natürlich auch das Zusammenspiel<br />
der einzelnen Register. Ob Tempo, Rhythmus,<br />
Dynamik, Klangfarbe oder Intonation,<br />
die Ensemblemitglieder müssen sich einander<br />
anpassen und einen gemeinsamen Weg<br />
finden - die Gruppe entwickelt dabei auch<br />
ein gemeinsames musikalisches Konzept,<br />
eine eigene musikalische Gestaltung. Dabei<br />
ist die Meinung eines jeden Einzelnen<br />
enorm wichtig – jeder Einzelne beeinflusst<br />
das Gesamtergebnis.<br />
Wesentlich ist auch, dass die Ensemblemitglieder<br />
Literatur kennenlernen, die in der<br />
Blasmusik selten bzw. gar nicht gespielt wird.<br />
Immer öfter wird mit neuer Musik experimentiert<br />
und improvisiert. Weiters kommen<br />
des Öfteren Nebeninstrumente (z.B. Bassklarinette,<br />
Sopran, Tenor und Baritonsaxophon)<br />
zum Einsatz und diese sind somit für<br />
alle Beteiligten eine Bereicherung.<br />
Für eine Musikkapelle selbst bringt die<br />
kammermusikalische Betätigung der einzelnen<br />
Musikantinnen und Musikanten eine<br />
erstaunliche Qualitätssteigerung mit sich.<br />
Die Musikantinnen und Musikanten haben<br />
durch das Ensemblespiel mitunter wieder<br />
mehr Motivation, selbst zu üben und sich<br />
vermehrt mit dem eigenen Instrument zu<br />
beschäftigen.<br />
Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />
soll einen entscheidenden Impuls dafür<br />
geben, gemeinsam mit Freunden im Ensemble<br />
zu musizieren und viele neue und<br />
schöne Erfahrungen zu sammeln.<br />
Helmut Schmid<br />
Das Musizieren in<br />
kleinen Gruppen bietet<br />
zweifelsohne eine<br />
Horizonterweiterung im<br />
musikalischen Sinn.<br />
Der Erfolg ist ein<br />
Meilenstein auf<br />
dem weiteren<br />
Weg – im Bild die<br />
Hauptpreisträger des<br />
Bundeswettbewerbes<br />
2012 „M&M drops“ mit<br />
dem „Yamaha-Preis“.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 5
Praxis<br />
Literaturempfehlung<br />
für Blasmusikwerke<br />
Von VSM-Bezirkskapellmeister Erwin Fischnaller<br />
In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen<br />
wir in dieser Rubrik des <strong>KulturFenster</strong>s<br />
Empfehlungen für gut spielbare<br />
Stücke in allen Leistungsstufen.<br />
Dies ist u.a. als eine praktische Hilfe bei<br />
der Zusammenstellung von Konzertprogrammen<br />
gedacht. Erwin Fischnaller,<br />
Bezirkskapellmeister des VSM-Bezirkes<br />
Brixen, hat uns diesmal freundlicherweise<br />
seine persönliche Auswahl geschickt. Es<br />
ist dies, wie er sagt, eine „Literaturempfehlung<br />
von Stücken, die ich größtenteils<br />
selbst aufgeführt habe und die meinen<br />
Musikantinnen und Musikanten, und mir<br />
gut gefallen.“<br />
Herzlichen Dank dafür!<br />
VSM-Bezirkskapellmeister Erwin<br />
Fischnaller<br />
Kirchenmusik Komponist/Arr. Stufe<br />
Deutsche Messe Franz Schubert A<br />
Katholische Messe Michael Haydn A<br />
Herz-Jesu Messe Florian Pedarnig A<br />
Sechs Choräle<br />
Johann Sebastian Bach/ Arr,<br />
Adi Rinner<br />
Festmusik <strong>Nr</strong>. 1 Karl Pilß A<br />
Drei Meditationen Alfred Bösendorfer A<br />
Der Festtag Sepp Tanzer B<br />
Bruckner Chorale Anton Bruckner A<br />
Gloria Dei/ Lux Dei Franz Watz A<br />
Wachet auf, ruft uns<br />
die Stimme<br />
Johann S. Bach/ Arr. Sparke<br />
A<br />
B/C<br />
Ave Maria Anton Bruckner B/C B/C<br />
Herzlich tut mich verlangen William P. Latham B/C<br />
Yorkshire Ballad James Barnes A<br />
B/C<br />
Choralia Bert Appermont A/B<br />
Lied ohne Worte Rolf Rudin B/C B/C<br />
Canterbury Chorale Jan van der Roost C<br />
O Magnum Mysterium Morten Lauridsen C/D C/D<br />
Konzertstücke Komponist/Arr. Stufe<br />
Signature Jan van der Roost C<br />
Pique Dame Ouverture Franz von Suppé C<br />
Olandese Giovanni Orsomando C<br />
Folk Song Suite R. Vaughan Williams C<br />
The Battle of Varlar Rob Goorhuis B<br />
White Field Armin Kofler C<br />
Roller Coaster Otto M. Schwarz B/C<br />
Prinz Eugen Kampfruf Joseph Messner arr. Hans Eibl B/C<br />
Pertusia, Ouverture M. Bartolucci B/C<br />
Gold und Silber, Walzer Franz Lehár, op. 79 B/C B/C<br />
Crown Imperial,<br />
Konzertmarsch<br />
William Walton, arr. Jay Bocook<br />
La Storia Jacob de Haan B<br />
Lord Of The Seven Seas Kees Vlak C<br />
All Glory Told James Swearingen B<br />
Fanfare and Flourishes James Curnow C<br />
Die Felsenmühle Carl Reissiger C<br />
Fanfare, Romance and Finale<br />
Philip Sparke<br />
Milano Gran Marcia A. Ponchielli C<br />
Fate Of The Gods Steven Reineke C<br />
Ivanhoe Bert Appermont C<br />
Festmusik der Stadt Wien Richard Strauss<br />
Heimatland-Ouverture Jindrich Pravecek C<br />
Zigeunerchor Giuseppe Verdi B/C<br />
Concensus Jan van der Roost C<br />
Festa Paesana Jacob de Haan B/C<br />
Orient Express Philip Sparke D<br />
El Camino Real Alfred Reed D<br />
Saga Candida Bert Appermont D<br />
Banja Luka Jan de Haan D<br />
Irish Tune From Country<br />
Derry<br />
Percy Aldrige Grainger<br />
The Hounds of spring Alfred Reed D<br />
Resurgam Eric Ball D/E<br />
Appalachian Ouverture James Barnes C<br />
Armenian Dances Alfred Reed D<br />
Ouverture on Russian and<br />
Kirgihiz Folk Songs<br />
Dimitri Shostakovich<br />
Russian Christmas Music Alfred Reed<br />
C<br />
C<br />
C<br />
B<br />
D<br />
D<br />
6<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Aus Verband und Bezirken<br />
Blasmusik<br />
Großer Zuwachs bei den<br />
JMLA-Prüfungen<br />
Erstmals auch Leistungsabzeichen für „Musiker 30+“<br />
Ein Plus von 50% bei den Goldprüfungen<br />
sowie ein Plus von 25% bei den<br />
Silberprüfungen<br />
Die Jungmusiker-Leistungsabzeichen<br />
stellen seit ihrer Einführung im Jahr 1971<br />
nach wie vor einen der wichtigen Be-<br />
reiche in der Jugendförderung im Verband<br />
Südtiroler Musikkapellen dar. Da<br />
die Inhalte und Anforderungen ständig<br />
im Steigen sind, muss auch die Prüfungsliteratur<br />
von Zeit zu Zeit angepasst<br />
werden. Im September dieses Jahres<br />
wurden gemeinsam mit den einzelnen<br />
Fachgruppen Anpassungen und kleine<br />
Korrekturen vorgenommen. So gibt es<br />
Änderungen bei den Spielanweisungen<br />
die Tonleitern betreffend; diese wurden<br />
zum Teil angepasst oder vereinheitlicht.<br />
Musiker-Leistungsabzeichen erfolgreich eingeführt<br />
Erstmals vergeben wurden heuer auch die Musiker-Leistungsabzeichen. Diese ermöglichen es, Musikantinnen und<br />
Musikanten, die bereits ihr 30-stes Lebensjahr überschritten haben, die Prüfung in Bronze, Silber und Gold abzulegen.<br />
Die hierzu verwendete Prüfungsliteratur und Richtlinien sind dieselben wie jene für die Jungmusiker-Leistungsabzeichen.<br />
Die ersten fünf Musikanten, die sich dieser Prüfung gestellt haben, sind:<br />
Werner Pitterle<br />
(MK Toblach, Posaune)<br />
im Jahr 2013 (Silber)<br />
Elisabeth Nischalke<br />
(MK Toblach, Tenorhorn)<br />
im Jahr <strong>2014</strong> (Bronze)<br />
Gottfried Steinmayr<br />
(SK Pichl, Tuba)<br />
im Jahr <strong>2014</strong> (Bronze)<br />
Josef Unterfrauner<br />
(MK St. Georgen, Posaune)<br />
im Jahr <strong>2014</strong> (Silber)<br />
Bernhard Mairhofer<br />
(MK Proveis, Bariton)<br />
im Jahr <strong>2014</strong> (Silber)<br />
Die JMLA-Literatur, die zugleich als Prüfungsliteratur<br />
dient, hat ihren festen Platz<br />
im Instrumentalunterricht und trägt so wesentlich<br />
zum Bildungskonzept der Musiklehrerinnen<br />
und –lehrer bei. An dieser Stelle<br />
möchte ich mich bei allen bedanken, die<br />
bei der Auswahl der Literatur mitgearbeitet<br />
haben. Diese begleitet die Schüler durch<br />
alle drei Leistungsstufen und führt sie so<br />
von den ersten Schritten bis hin zur solistischen<br />
Reife.<br />
Die Prüfungen wurden, wie in den vergangenen<br />
Jahren, im Laufe des Schuljahres im<br />
März und Juni in Bruneck, Brixen, Eppan,<br />
Lana, Schlanders und Auer abgenommen.<br />
Zudem gab es heuer die Möglichkeit, gleich<br />
bei zwei Jungbläserwochen die Prüfungen<br />
in Bronze abzulegen. Insgesamt wurde 503-<br />
mal das Jungmusiker-Leistungsabzeichen<br />
in Bronze, 211-mal in Silber und 41-mal<br />
in Gold verliehen.<br />
Meinhard Windisch,<br />
Verbandsjugendleiter<br />
Hier vorausgeschickt die Prüfungstermine für 2015:<br />
Termin Stufe Ort/e<br />
Sa, 28. März 2015 Bronze - Silber Musikschule Bruneck<br />
Mo, 02. Juni 2015 Bronze - Silber Musikschulen Schlanders, Lana, Eppan, Toblach, Brixen<br />
Sa, 06. Juni 2015 Gold Musikschule Auer<br />
Juli 2015 Bronze Jungbläserwoche<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 7
Aus Verband und Bezirken<br />
220 Jungmusikanten aus ganz<br />
Südtirol bilden sich fort<br />
Keine Zukunft für die Jungbläserwoche C mit Silberniveau<br />
2600 Finger übten im heurigen Sommer<br />
fleißig auf den Instrumenten, denn bei den<br />
vier Jungbläserwochen des VSM wurden insgesamt<br />
220 Jungmusikanten aus ganz Südtirol<br />
von 45 Fachlehrern und den vier Kursleitern<br />
Wolfgang Schrötter, Hannes Zingerle,<br />
Georg Lanz und Sonya Profanter betreut.<br />
Aufgrund der immer größer werdenden<br />
Schwierigkeiten, genügend Teilnehmer für<br />
die Jungbläserwoche C mit Silberniveau<br />
zu finden, wird diese ab dem nächsten<br />
Jahr nicht mehr stattfinden, d.h. es wird<br />
nur mehr eine Jungbläserwoche für fortgeschrittene<br />
Schüler geben (ab Bronze).<br />
Denn für den heurigen Sommer konnte für<br />
die Jungbläserwoche C nur ein 36-köpfiges<br />
Jugendblasorchester gebildet werden,<br />
welches vom 12. Juli bis 19. Juli in<br />
der Landwirtschaftsschule in Dietenheim<br />
probte. Den Jungmusikanten stand ein<br />
kompetentes und engagiertes 8-köpfiges<br />
Lehrerteam für technische Feinheiten am<br />
Instrument, Einzelunterricht und Ensemblespiel<br />
zur Seite. Das Jugendblasorchester,<br />
welches den Schwerpunkt der Woche<br />
bildete, wurde von dem Lehrerteam musikalisch<br />
geleitet, die organisatorischen Zügel<br />
hielt Bezirksjugendleiter Hannes Zingerle<br />
in seinen Händen. Am Vormittag des<br />
Abschlusskonzertes fand bereits ein internes<br />
Kammermusik-Konzert statt, bei dem<br />
die teilnehmenden Jungmusikanten ihr Erlerntes<br />
präsentieren durften.<br />
Mit dem<br />
Abschlusskonzert<br />
am 19. Juli im<br />
Vereinshaus<br />
von Percha<br />
ist nach nur<br />
sechs Jahren<br />
die Ära der<br />
"Jungbläserwoche<br />
(C) mit Silber-<br />
Niveau" zu Ende<br />
gegangen.<br />
Das Abschlusskonzert, zu dem unter anderem<br />
die Teilnehmer der Jungbläserwoche<br />
A zu Gast waren, fand heuer im Vereinshaus<br />
von Percha statt. Zuerst präsentierten<br />
die Jugendlichen vor dem Vereinshaus eine<br />
tolle Marschshow unter der gekonnten Leitung<br />
von Franz Plangger und Harald Weber.<br />
Anschließend erklang im Saal u. a. originale<br />
Blasmusik von Jakob de Haan und Jan Van<br />
der Roost sowie auch das Werk „Alm“ des<br />
Südtiroler Komponisten Armin Kofler. Die<br />
Begeisterung der Zuhörer spiegelte sich<br />
in einem wohl verdienten Applaus wider.<br />
Vom 19. bis 26. Juli fanden die zwei<br />
zeitgleich laufenden Bronzewochen statt:<br />
eine im Vinzentinum in Brixen unter der<br />
Leitung von Verbandsjugendleiterstellvertreterin<br />
Sonya Profanter und die zweite in<br />
der Lichtenburg in Nals unter der Leitung<br />
von Bezirksjugendleiter Wolfgang Schrötter.<br />
Insgesamt 22 Lehrer spornten die 122<br />
Jungmusikanten zu Höchstleistungen an,<br />
und mit großer Freude und Genugtuung<br />
konnten am Ende der Woche fast alle Kinder<br />
das Jungmusikerleistungsabzeichen in<br />
Bronze in ihren Händen halten. Zusätzlich<br />
Termine der Jungbläserwochen 2015<br />
zur bestandenen Prüfung überzeugten die<br />
Jungmusikanten bei den Abschlusskonzerten<br />
mit gelungenen Marschmusikparaden,<br />
die von den Bezirksstabführern Frank<br />
Malfertheiner bzw. Valentin Domanegg einstudiert<br />
wurden, sowie mit flotten Ensemblestücken<br />
und Orchesterwerken.<br />
Georg Lanz leitete die Jungbläserwoche<br />
für Fortgeschrittene mit Bronze, welche<br />
vom 05. Juli bis 12. Juli ebenfalls im Vinzentinum<br />
in Brixen stattfand. Die 56 Teilnehmer<br />
wurden von 11 Lehrkräften unterrichtet.<br />
Hauptaugenmerk legte man auf die<br />
instrumentenspezifische technische und<br />
musikalische Schulung, auf das Ensemblespiel<br />
und auf die verfeinerte Arbeit im Jugendblasorchester.<br />
Außerdem hatten die Jugendlichen<br />
die Möglichkeit, Solostücke mit<br />
Klavier-Korrepetition zu erarbeiten, welche<br />
in einem internen Konzert zur Aufführung<br />
kamen. Für das Abschlusskonzert wurden<br />
die Grundkenntnisse im Marschieren und<br />
der Musik in Bewegung vom Landesstabführer<br />
Toni Profanter aufgefrischt und zusätzlich<br />
dazu eine kleine Marschmusikshow<br />
präsentiert. Anschließend überzeugten die<br />
Jungmusikanten im Innenhof des Vinzentinums<br />
mit vielen Ensemblestücken, bis das<br />
Konzert mit symphonischer Musik (u.a.<br />
„Sedona“-Steven Reineke) und rockigen<br />
Klängen („Rock the Future“ – Mario Bürki)<br />
unter großem Beifall ausklang.<br />
Natürlich kam bei allen Wochen der<br />
Spaß nicht zu kurz, dafür sorgten die kreativen<br />
Betreuer: Es wurden Olympiaden, Lagerfeuer<br />
und viele andere Veranstaltungen<br />
organisiert. Was aber vielleicht ein Leben<br />
lang hält, sind die Freundschaften, die in<br />
dieser Zeit geschlossen werden.<br />
Sonya Profanter<br />
11.-18.Juli: ... für Fortgeschrittene (ab Bronze) in Dietenheim<br />
18.-25.Juli: ... zur Erlangung des Bronzeabzeichens in Brixen (Vinzentinum) und<br />
Nals (Lichtenburg)<br />
8<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
Latsch - ein Tag im<br />
Zeichen der Blasmusik<br />
22. Bezirksmusikfest des VSM-Bezirkes Schlanders<br />
Das erste Augustwochenende stand in<br />
Latsch ganz im Zeichen der Blasmusik.<br />
Geschätzte 700 Musikanten trafen sich<br />
am Sonntag, den 3. August, beim traditionellen<br />
Bezirksmusikfest des VSM-Bezirkes<br />
Schlanders zum gemeinsamen Marschieren,<br />
zu Konzerten und zum gemütlichen Beisammensein.<br />
Latsch wurde für diesen Tag gleichsam<br />
das Zentrum der Vinschger Blasmusik.<br />
Nach dem „Lederhosenfest“ am vorhergehenden<br />
Samstag gehörte der Sonntag<br />
ganz den Musikantinnen und Musikanten<br />
der 16 teilnehmenden Kapellen.<br />
Eröffnet wurde der Festtag mit dem Empfang<br />
der Verbandsfahne des VSM durch<br />
die MK Goldrain-Morter. Nach dem anschließenden<br />
Sternmarsch zum Lacusplatz<br />
wurde dort gemeinsam die heilige Messe<br />
gefeiert. Die MK Karthaus/Unser Frau umrahmte<br />
unter der Leitung von Kapellmeister<br />
Dietmar Rainer die Messfeier mit passenden<br />
Klängen.<br />
Im Anschluss an den Gottesdienst<br />
folgten die Grußworte der Verbandsfunktionäre<br />
und der Vertreter aus der<br />
Politik. Mit dem Marsch „Mein Heimatland"<br />
wurde der erste Teil des Festes abgeschlossen.<br />
Für den zweiten Höhepunkt des Tages<br />
nahmen alle Kapellen Aufstellung zum<br />
Festumzug in Richtung des Festplatzes.<br />
Mit der Verleihung der Jungmusikerleitungsabzeichen<br />
in Bronze und Silber<br />
und den beeindruckenden Konzerten<br />
von mehreren Kapellen nahm das Bezirksmusikfest<br />
ein stimmungsvolles Ende.<br />
Den Organisatoren, der Bürgerkapelle<br />
Latsch und dem VSM-Bezirk Schlanders<br />
ist es gelungen, einen unterhaltsamen<br />
und schönen Tag der Begegnung für<br />
die Bevölkerung und die Musikanten zu<br />
gestalten. Dafür gebührt ihnen allen ein<br />
großes Kompliment.<br />
VSM Bezirk Schlanders<br />
Der traditionelle Musikantengruß am<br />
Ende des Festaktes<br />
Die Musikkapelle Kastelbell beim Festumzug.<br />
Beim Bezirksmusikfest wurden auch<br />
die Jungmusiker-Leistungsabzeichen in<br />
Silber verliehen.<br />
Gemeinschaftschor zum Abschluss des Festaktes<br />
Sichtlich zufriedene Gastgeber beim Bezirksmusikfest<br />
in Latsch: (v.l.) VSM-Bezirksobmann<br />
Manfred Horrer, Maria Kuppelwieser,<br />
Obfrau der Bürgerkapelle Latsch,<br />
VSM-Verbandsobmann Pepi Fauster<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 9
Aus Verband und Bezirken<br />
Ein Fest der Blasmusikjugend<br />
Die Jugendkapellen des Pustertales trafen sich in St. Lorenzen<br />
Am 14. September hat der Bezirk Bruneck<br />
des Verbandes Südtiroler Musikkapellen<br />
(VSM) zum Jugendkapellentreffen nach<br />
St. Lorenzen eingeladen. Nach Sand in Taufers<br />
im Jahr 2008 und Percha im Jahr 2010<br />
war es das dritte Treffen dieser Art im Pustertal.<br />
Rund 500 junge Musikantinnen und Musikanten<br />
aus 13 Pusterer Jugendkapellen haben<br />
einen ganzen Tag lang die Blasmusik von<br />
ihrer jugendlichen Seite gezeigt.<br />
Das Jugendkapellentreffen ist ein Höhepunkt<br />
in der Jugendarbeit der Musikkapellen<br />
des Pustertals. Die Idee dazu war 2008<br />
geboren, um bereits bestehenden Jugendkapellen<br />
die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam<br />
und öffentlich zu präsentieren und<br />
um weitere Kapellen anzuspornen, eigene Jugendkapellen<br />
zu gründen. Mittlerweile haben<br />
fast alle Kapellen entweder eine eigene Jugendkapelle<br />
oder haben sich mit Nachbarkapellen<br />
dazu zusammengeschlossen. Im<br />
Gsieser Tal, im Ahrntal, im Hochpustertal sowie<br />
im oberen und unteren Gadertal organisieren<br />
die Kapellen talweise die Jugendarbeit<br />
gemeinsam.<br />
Dieser blasmusikalische Sonntag wurde<br />
von den Jugendkapellen von St. Lorenzen<br />
(JukaStL), Pfalzen/Stegen, Gsies, Mühlbach<br />
und Luttach/Weißenbach mit einem<br />
Sternmarsch eröffnet. Nach einer beeindruckenden<br />
Marsch-Show der gastgebenden Jugendkapelle<br />
am Kirchplatz präsentierten sich<br />
die 13 Jugendkapellen den ganzen Tag hindurch<br />
mit Kurzkonzerten am Musikpavillon.<br />
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und<br />
Gäste sorgte die Musikkapelle St. Lorenzen.<br />
VSM-Bezirksobmann Johann Hilber dankte<br />
dem Bezirksjugendleiter Hannes Zingerle und<br />
seiner Stellvertreterin Stefanie Watschinger<br />
sowie Obmann Toni Erlacher von der gastgebenden<br />
Musikkapelle für die Vorbereitung und<br />
gratulierte zur erfolgreichen Veranstaltung.<br />
Stephan Niederegger<br />
Jugendkapelle St. Lorenzen (JukaStl)<br />
Leitung: Viktoria Erlacher<br />
Jugendkapelle Gsies<br />
Leitung: Joachim Schwingshackl<br />
Jugendkapelle Luttach/Weißenbach<br />
Leitung: Patrick Künig<br />
Jugendkapelle Hochpustertal<br />
Leitung: Stefanie Watschinger,<br />
Korbinian Hofmann<br />
Jugendkapelle Sand in Taufers<br />
(young sound)<br />
Leitung: Manfred Eppacher<br />
Jugendkapelle Pfalzen/Stegen<br />
Leitung: Stephanie Hopfgartner,<br />
Samuel Gatterer, Simon Plangger<br />
Jugendkapelle Mühlwald - Leitung:<br />
Klemens Mair und Felix Außerhofer<br />
Jugendkapelle Vintl (y.m.b.)<br />
Leitung: Hannes Zingerle<br />
Jugendkapelle Antholzertal<br />
Leitung: Dietmar Huber<br />
Jugendkapelle Toblach und Niederdorf<br />
Leitung: Thomas Kiniger und Matthias Baur<br />
10<br />
Jugendkapelle Reischach/Percha<br />
(Muskitos) – Leitung: Pepi Fauster,<br />
Vigil Kronbichler<br />
Jugendkapelle St. Georgen<br />
Leitung: Maximilian Messner<br />
Jugendkapelle Unteres Gadertal<br />
(Musiga di Jogn Bassa Val Badia)<br />
Leitung: Georg Plazza<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik International<br />
Blasmusik<br />
Südtiroler zu Gast bei den<br />
Wiener Philharmonikern<br />
Salzburger Festspiele <strong>2014</strong> - 9. Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker mit<br />
jungen Blasmusiktalenten aus Salzburg und Südtirol<br />
Blasmusiktalente aus Südtirol und Salzburg<br />
zeigten am 24. August in der Felsenreitschule<br />
im Rahmen der Salzburger Festspiele<br />
ihr Können. Es war das Abschlusskonzert<br />
der dreitägigen Akademie mit den Wiener<br />
Philharmonikern.<br />
Vom 18. Juli bis 31. August war Salzburg<br />
eine Art Weltkulturhauptstadt mit<br />
allem, was dazugehört: Weltstars, überraschende<br />
Klangerlebnisse, erlesene Tradition,<br />
Spiritualität und Avantgarde sowie<br />
die Entdeckung jugendlicher Talente. Und<br />
hier hakt ein musikalisches Projekt ein,<br />
das im Mozartjahr 2006 als einmalige<br />
Idee begonnen hatte und mittlerweile zu<br />
einem fixen Programmpunkt geworden<br />
ist: das Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker<br />
mit Blasmusiktalenten aus<br />
Salzburg. Jedes Jahr sind zudem junge<br />
Musikantinnen und Musikanten aus jeweils<br />
einem anderen österreichischen<br />
Bundesland und den Partnerverbänden<br />
des Österreichischen Blasmusikverbandes<br />
(ÖBV) dazu eingeladen. Bei der<br />
heurigen neunten Ausgabe waren Mitglieder<br />
des Südtiroler Jugendblasorchesters<br />
(SJBO) zu Gast. In einer dreitägigen Akademie<br />
probte das rund 70-köpfige Orchester<br />
gemeinsam mit neun Mitgliedern der<br />
Wiener Philharmoniker (Wolfgang Breinschmid/Flöte,<br />
Alexander Öhlberger/Oboe,<br />
Hannes Moser/Klarinette, Michael Werba/<br />
Fagott, Lars Michael Stransky/Horn, Walter<br />
Singer/Trompete-Flügelhorn, Markus<br />
Pichler/Posaune, Robert Schweiger/Tuba<br />
und Thomas Lechner/Schlagwerk) unter<br />
der Leitung von Karl Jeitler. Der mittlerweile<br />
pensionierte Posaunist der Wiener<br />
Philharmoniker und selbst leidenschaftlicher<br />
Blasmusiker ist einer der Initiatoren<br />
dieses einmaligen Jugendförderungsprojektes:<br />
„Durch den persönlichen Kontakt<br />
und das gemeinsame Musizieren auf<br />
der Bühne mit Berufsmusikern ist der<br />
erzieherische Wert enorm hoch.“<br />
Das Konzert mit vorwiegend Musik von<br />
Johann Strauß erfährt seit der Premiere ungebrochen<br />
großen Zuspruch bei den Besuchern,<br />
freute sich auch die Festspielpräsidentin<br />
Helga Rabl-Stadler. Alle Zählkarten<br />
waren bereits nach wenigen Tagen ausgegeben.<br />
Die Spielfreude und Motivation der<br />
jungen Musiker waren hörbar und das Publikum<br />
in der vollbesetzten Felsenreitschule<br />
sparte nicht mit Applaus und gab sich erst<br />
nach drei Zugaben zufrieden.<br />
Finanziell unterstützt wurde das Konzert<br />
vom Land Salzburg und vom Land Südtirol,<br />
von der Region Trentino Südtirol, von<br />
den Blasmusikverbänden aus Salzburg<br />
und Südtirol sowie von der Stiftung Südtiroler<br />
Sparkasse.<br />
Stephan Niederegger<br />
9. Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker mit jungen<br />
Blasmusiktalenten aus Salzburg und Südtirol in der imposanten<br />
Kulisse der Salzburger Felsenreitschule<br />
VSM-Obmann Pepi Fauster (links) bedankte sich beim<br />
Dirigenten Karl Jeitler für dieses einmalige Erlebnis.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 11
Blasmusik international<br />
Gruppenfoto der Südtiroler Teilnehmer mit Dirigent Kurt Jeitler (vorne Bildmitte), Kulturlandesrat Philipp Achammer (vorne<br />
rechts), Landesschuldirektorin Irene Vieider (dahinter) und VSM-Obmann Pepi Fauster (vorne links)<br />
v.l.: Neben Familienangehörigen und Freunden der Südtiroler<br />
Teilnehmer mischten sich auch VSM-Verbandsjugendleiter<br />
Meinhard Windisch, Kulturlandesrat Philipp Achammer,<br />
Matthäus Rieger (Präsident des Österreichischen<br />
Blasmusikverbandes und Obmann des Salzburger<br />
Blasmusikverbandes), die Salzburger Landtagspräsidentin<br />
Brigitta Pallauf und (rechts) VSM-Obmann Pepi Fauster unters<br />
Publikum im vollbesetzten Konzertsaal – im Bild mit dem<br />
Dirigenten Karl Jeitler (Zweiter von rechts).<br />
„Dieses Projekt soll die seit 1877 bestehende Verankerung<br />
unseres Orchesters mit Salzburg demonstrieren. Es freut mich,<br />
dass diese wichtige Institution Anlass meines letzten offiziellen<br />
Auftritts als Vorstand der Wiener Philharmonikern ist.“<br />
Clemens Hellsberg, der scheidende Vorstand der Wiener<br />
Philharmoniker, im Bild mit VSM-Obmann Pepi Fauster und<br />
VSM-Jugendleiter Meinhard Windisch (v.l.)<br />
12<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
Karl Jeitler –<br />
In Frack & Lederhose<br />
Aus dem Leben eines Wiener Philharmonikers<br />
nikern teilgenommen, das mit dem Festkonzert<br />
in der Salzburger Felsenreitschule abgeschlossen<br />
wurde (siehe eigener Bericht).<br />
Initiator und Leiter dieser 2006 ins Leben<br />
Vom Musikanten einer Blaskapelle bis zu den Wiener Philharmonikern – das Buch<br />
über Karl Jeitler erzählt eine musikalische Lebensgeschichte.<br />
Im Rahmen der Salzburger Festspiele haben<br />
heuer Mitglieder des Südtiroler Jugendblasorchesters<br />
(SJBO) an der dreitägigen<br />
Musikakademie mit den Wiener Philharmogerufenen<br />
Initiative zur Förderung junger<br />
Blasmusiktalente ist der mittlerweile pensionierte<br />
Posaunist der Wiener Philharmoniker<br />
Karl Jeitler. Seine Tochter Maria hat<br />
anlässlich seiner Pensionierung vor zwei<br />
Jahren seine Lebensgeschichte im Buch<br />
mit dem treffenden Titel „In Frack & Lederhose“<br />
aufgezeichnet.<br />
Die Blech- und Bläserkultur zieht sich<br />
wie ein roter Faden durch Karl Jeitlers Leben.<br />
Der 1947 Geborene wurde im Alter<br />
von 15 Jahren Mitglied der Blasmusikkapelle<br />
im heimatlichen Grafenbach (Niederösterreich).<br />
Aus Liebe zur Musik brach<br />
er 1964 seine Lehrerausbildung ab und<br />
studierte in Wien Posaune. Sein Weg als<br />
Profimusiker begann 1969 an der Wiener<br />
Volksoper. Ab 1970 wirkte er bei den Wiener<br />
Symphonikern, 1974 wurde er Mitglied<br />
des Orchesters der Wiener Staatsoper und<br />
in weiterer Folge der Wiener Philharmoniker<br />
und der Wiener Hofmusikkapelle. Anfang<br />
der 1980-er Jahre hatte er einen Lehrauftrag<br />
an der Universität für Musik und<br />
darstellende Kunst.<br />
Während er mit den Wiener Philharmonikern<br />
die Bühnen dieser Welt eroberte,<br />
verlor er nie den Bezug zu seinen (blas)<br />
musikalischen Wurzeln und engagiert sich<br />
auch heute noch im Bereich der Volks- und<br />
Blasmusik. Mit seinem unermüdlichen Engagement<br />
für die Blasmusik begeistert er<br />
auch immer noch viele Menschen.<br />
Das Buch erzählt die außergewöhnliche<br />
Geschichte eines Musikers, der trotz seines<br />
Erfolges bodenständig geblieben ist.<br />
Und genauso haben wir ihn auch bei unserer<br />
Begegnung in Salzburg erlebt. Seine<br />
Freude an der Begegnung mit jungen<br />
Musikern begleitet ihn sein ganzes Leben.<br />
Neben seiner Liebe zur Musik und<br />
seiner Leidenschaft für den Charme der<br />
Wiener Musik kommt er ins Schwärmen,<br />
wenn man mit ihm über Blasmusik philosophiert.<br />
Wann immer es ihm die Zeit erlaubt,<br />
spielt er immer noch in seiner Heimatkapelle<br />
mit.<br />
Das Buch ist im Grazer STYRIA-Verlag<br />
erschienen. Dem Buch liegt eine CD<br />
bei, mit über 70 Minuten „Best of Karl<br />
Jeitler“. Die Aufnahmen verschiedener<br />
Bläserensembles sollen die 16 Kapitel<br />
für Musiker und Musikliebhaber auch<br />
akustisch ergänzen: Blechbläser Ensemble,<br />
Trompetenchor, Junge Bläser-<br />
Philharmonie Wien, Ensemble „11“ und<br />
Hornquartett.<br />
Stephan Niederegger<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 13
Blasmusik International<br />
Zum 160. Geburtstag<br />
von John Philip Sousa<br />
John Philip Sousa, nicht nur<br />
musikalisch, sondern auch äußerlich<br />
eine beeindruckende Erscheinung<br />
Als die im weltgeschichtlichen Kontext<br />
auch heute noch sehr jungen Vereinigten<br />
Staaten von Amerika noch keine 80 Jahre alt<br />
waren, wurde John Philip Sousa am 6. November<br />
1854 in Washington geboren. Passend<br />
zum Ausspruch des amerikanischen<br />
Dirigenten und Musikwissenschaftlers David<br />
Mason („In Amerika sind alle zugezogen.<br />
Die Indianer zuerst.“) hatten auch Sousas<br />
Eltern einen Migrationshintergrund: Vater<br />
John Antonio Sousa stammte aus Portugal,<br />
die Mutter Maria Elisabeth Trinkaus war<br />
eine Deutsche aus Fränkisch-Crumbach,<br />
östlich von Darmstadt.<br />
Geboren wurde Sousa in unmittelbarer<br />
Nähe der Marine Barracks, wo sein Vater<br />
in der US Marine Band spielte. Nachdem<br />
der Sohn mit sieben Jahren seinen ersten<br />
Musikunterricht erhalten hatte, führte ihn<br />
der Vater bereits mit 13 Jahren als „Lehrling“<br />
ins Orchester ein. Parallel dazu erhielt<br />
er weiteren Musikunterricht auf verschiedenen<br />
Blasinstrumenten, auf der Geige, in<br />
Harmonielehre und Komposition. Mit 20<br />
Jahren verließ er das Orchester und trat<br />
als Geiger und Dirigent in verschiedenen<br />
Orchestern im Osten der USA auf.<br />
Ein Deutsch-Portugiese aus den USA<br />
1880 kehrte er als musikalischer Leiter<br />
zur US Marine Band zurück, blieb zwölf<br />
Jahre in dieser Position und formte das<br />
Orchester in dieser Zeit zu einer der besten<br />
Militärkapellen der Welt. Erstmals ging<br />
er 1891 mit dem Orchester auf Tournee<br />
durch die USA. Diese von Sousa begründete<br />
Tradition wird bis heute fortgeführt.<br />
In seiner Zeit bei der Marine Band entstand<br />
u.a. der Marsch „The Washington<br />
Post“. Ein britischer Musikjournalist, begeistert<br />
von dieser Komposition, sagte damals:<br />
„Wenn Johann Strauß der Walzerkönig ist,<br />
dann ist Sousa der Marschkönig.“ Sousa<br />
wollte sich allerdings nie darauf festlegen<br />
lassen. Auch wenn seine 136 Märsche<br />
das wichtigste sind, das von ihm bleiben<br />
wird, so hat er als Komponist und Arrangeur<br />
doch viel mehr geschaffen. Allein<br />
seine Konzertsuiten wie „The Last Days of<br />
Pompeji“, Looking upward“, „Dwellers of<br />
the Western World“ oder „At the Moovies“<br />
sind es wert, wiederentdeckt zu werden.<br />
Nach der zweiten Tournee 1892 schlug<br />
sein Manager David Blakely vor, dass Sousa<br />
ein eigenes ziviles Blasorchester gründen<br />
solle. Sousa ging darauf ein und leitete dieses<br />
Orchester bis kurz vor seinem Tod. Er<br />
ging regelmäßig auf Tournee: zweimal im<br />
Jahr durch die USA, fünfmal war er in Europa<br />
zu Gast und einmal auf Welt-Tournee<br />
(1910/11). Schätzungen besagen, dass<br />
das Orchester im Laufe der Jahre 1,2 Millionen<br />
Meilen (fast 2 Millionen Kilometer)<br />
zurückgelegt habe.<br />
Nach anfangs reservierten Reaktionen in<br />
der Presse häuften sich die anerkennenden<br />
Kommentare über die Sousa-Band. Der<br />
„Philadelphia Enquirer“ nannte das Ensemble<br />
einen Kompromiss zwischen Sinfonieorchester<br />
und Marschkapelle. Sousas<br />
Fähigkeiten als Dirigent wurden im<br />
„Worcester Telegram“ gelobt: „Ein simpler<br />
Wimpernschlag oder die Bewegung<br />
seines kleinen Fingers reichten aus, um<br />
die richtigen Melodien aus einem der besten<br />
Klangkörper der Welt herauszuholen.“<br />
Das Repertoire der Sousa Band bestand<br />
zu einem großen Teil aus Kompositionen<br />
des Dirigenten, aus zahlreichen populären<br />
Liedern, aber auch aus klassischen<br />
Bearbeitungen aus Sousas Feder. Sousa<br />
lehnte eine einseitige Gestaltung der Konzertprogramme<br />
(nur „unterhaltend“ bzw.<br />
nur „klassisch“) ab. Es sei närrisch, über<br />
die Köpfe seiner Zuhörer hinweg zu spielen.<br />
Eine Vorreiterrolle spielte Sousa mit<br />
seiner Band allemal, denn er hatte Musik<br />
von Richard Wagner bereits im Programm,<br />
als diese noch nicht in der New Yorker Carnegie<br />
Hall erklungen war.<br />
Neu war durchaus auch sein Selbstverständnis<br />
als Dirigent. Da er – gerade<br />
aufgrund der vielen Tourneen – viel länger<br />
mit seinen Musikern zusammen war<br />
als es heute üblich ist, kümmerte er sich<br />
auch um zwischenmenschliche Belange.<br />
So wurden bei Bewerbern neben den musikalischen<br />
Fähigkeiten immer auch die sozialen<br />
Kompetenzen in Augenschein genommen.<br />
Auch nahm er Rücksicht auf die<br />
religiösen Gefühle seiner Musiker und versuchte<br />
daher, sonntags keine Konzerttermine<br />
anzunehmen. Wenn es einmal gar<br />
nicht anders ging, wurden solche Auftritte<br />
dann als „geistliche Konzerte“ verkauft.<br />
Sousa war mit seinem Engagement das,<br />
was man heute als „Workaholic“ bezeichnen<br />
würde. Entsprechend plötzlich kam<br />
sein Tod im März 1932 in Reading / Pennsylvania.<br />
Am Abend zuvor hatte er sich als<br />
Gastdirigent der Ringgold Band noch auf<br />
ein Konzert vorbereitet, als ihn am frühen<br />
Morgen in seinem Hotelzimmer ein Herzanfall<br />
ereilte.<br />
CD-Tipp:<br />
Wer sich eine Sousa-Anthologie auf CD<br />
zulegen will, dem sei eine Reihe des Labels<br />
NAXOS empfohlen. In der Reihe<br />
„American Classics“ sind unter dem<br />
Namen „John Philip Sousa – Music for<br />
Wind Band“ inzwischen mehr als ein<br />
Dutzend CDs erschienen. Keith Brion,<br />
einer der führenden Sousa-Experten<br />
unserer Zeit, leitet verschiedene europäische<br />
Orchester: die Royal Artillery<br />
Band, die Marinemusikkorps aus Norwegen<br />
und Schweden und die Central<br />
Band of the Royal Air Force.<br />
Joachim Buch<br />
14<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Zur Person<br />
Blasmusik<br />
Toni Profanter 60<br />
… im Schritt! Marsch! ...<br />
Die VSM-Spitze gratuliert zum 60er: Geschäftsführer Florian Müller,<br />
Verbandskapellmeister Sigisbert Mutschlechner, das „Geburtstagskind“<br />
Toni Profanter und Verbandsobmann Pepi Fauster (v.links)<br />
Am vergangenen 24. Juli feierte Verbandsstabführer<br />
und Kapellmeister Toni Profanter<br />
seinen 60. Geburtstag. In verschiedenen<br />
Feiern ließen ihn seine Familie und seine<br />
Angehörigen, seine Freunde und Musikkameraden<br />
verschiedener Musikkapellen, des<br />
Bezirkes Brixen und des Verbandes Südtiroler<br />
Musikkapellen hochleben und erinnerten<br />
sich gerne an wichtige Stationen<br />
im Leben des Jubilars.<br />
Toni wurde am 24. Juli 1954 am Proderhof<br />
in Villnöß geboren und wuchs dort<br />
im Kreise seiner Familie mit Mutter Anna,<br />
Vater Anton und seinen drei Brüdern Meinhard,<br />
Hansjörg und Ludwig auf. Mit 16<br />
Jahren stieg er in seinen Beruf als Mitarbeiter<br />
der Firma Durst in Brixen ein, den<br />
er 40 Jahre lang ausübte. Daneben engagierte<br />
er sich bereits in jungen Jahren als<br />
Leiter der Jungschargruppe Villnöß, gründete<br />
die Pfadfinder und war in der Landesleitung<br />
der Katholischen Werktätigen<br />
Jugend (KWJ) tätig. Im Jahre 1981 heiratete<br />
er seine Frau Elisabeth, die ihm drei<br />
Kinder schenkte. Seit 2011 ist er stolzer<br />
Opa. Im Jahre 2012 wurde er zum Pfarrgemeinderatspräsidenten<br />
gewählt.<br />
In Tonis Leben nahm die Musik von klein<br />
auf eine zentrale Rolle ein. Seine Mutter<br />
Anna war Lehrerin, spielte Gitarre, sang<br />
zu Hause sehr viel mit den vier Buben<br />
und förderte dadurch ganz besonders die<br />
Freude und die Begeisterung für Musik<br />
und Gesang. Toni trat bereits mit 11 Jahren<br />
in den Kirchenchor ein und lernte bei<br />
Altmusikanten Klarinette. Zu Hause und<br />
in verschiedenen Gruppen und Ensembles<br />
wurde viel musiziert.<br />
Mit 22 Jahren begann seine Laufbahn<br />
als Kapellmeister, in der er – abwechselnd<br />
bzw. teilweise gleichzeitig - die Musikkapellen<br />
Waidbruck, Gufidaun, Latzfons<br />
und Vahrn leitete. Seine größten Erfolge<br />
konnte er aber mit seiner Heimatkapelle,<br />
der Musikkapelle Villnöß, feiern, die er 30<br />
Jahre lang dirigierte. Mit viel Fleiß, Einsatz<br />
und musikalischer Fachkenntnis gab er<br />
beachtenswerte Konzerte und führte sie<br />
bei Wertungsspielen bis in der Stufe E zu<br />
überzeugenden Ergebnissen. Der Bezirk<br />
Brixen wählte ihn von 1989 – 2001 zum<br />
Bezirkskapellmeister.<br />
Neben der Konzerttätigkeit trat Toni mit<br />
seiner MK Villnöß oft bei Veranstaltungen<br />
und Wettbewerben mit „Musik und Bewegung“<br />
auf und erzielte dabei in der<br />
Höchststufe hervorragende Leistungen.<br />
Als feuriger Verfechter dieser Art der Musik<br />
wählten ihn die Musikkapellen Südtirols<br />
im Jahre 1999 zum Verbandsstabführer,<br />
dessen Amt er bis heute innehat. Er<br />
erwarb sich dabei viele Verdienste, in dem<br />
er immer wieder neue Ideen zur Marschmusik<br />
einbrachte, die Ausbildung der Stabführer<br />
vorantrieb und Musikkapellen zum<br />
Mitmachen bei Wettbewerben vorbereitete<br />
und motivierte. Im Österreichischen Blasmusikverband<br />
beteiligte er sich maßgeblich<br />
in der Fachgruppe Stabführer bei der<br />
Erstellung von Büchern und Unterlagen<br />
zur Stabführerausbildung. Ohne Übertreibung<br />
kann Toni als langjähriger, fleißiger,<br />
motivierter Verbandsfunktionär bezeichnet<br />
werden, der unübersehbar die<br />
tolle Entwicklung der Blasmusik in Südtirol<br />
und darüber hinaus mitgestaltet und<br />
mitgeprägt hat. Als Zeichen der Anerkennung<br />
und des Dankes erhielt er 2006 die<br />
Verdienstmedaille des Landes Tirol sowie<br />
2012 das Verdienstkreuz in Silber des Österreichischen<br />
Blasmusikverbandes.<br />
Der Vorstand des VSM gratuliert sehr<br />
herzlich zum 60.Geburtstag und bedankt<br />
sich ganz aufrichtig für die vielen verdienstvollen<br />
Tätigkeiten, ganz besonders<br />
für den großen Einsatz als Verbandsstabführer.<br />
Möge daneben noch etwas Zeit<br />
für die Familie und die persönlichen Hobbys<br />
bleiben! Für die nächsten Jahrzehnte<br />
wünscht viel Glück und Segen, Gesundheit<br />
und Freude an der Musik im Namen<br />
aller Musikkameraden.<br />
Pepi Fauster,<br />
Verbandsobmann<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 15
Blasmusik International<br />
Alberto Promberger,<br />
Kapellmeister der<br />
Musikkapelle St. Lorenzen<br />
„Wenn man sich Ziele setzt,<br />
dann sollte man sie auch ernst nehmen.“<br />
<strong>KulturFenster</strong>: Sind Sie durch Ihre Familie<br />
musikalisch „vorbelastet“?<br />
Alberto Promberger: In unserer Familie<br />
wurde immer schon viel musiziert,<br />
vor allem wurde viel und oft gesungen.<br />
Vom Vater habe ich das „freie“ Singen<br />
erlernt, also das Musizieren aus dem<br />
Bauch heraus, ohne Noten. Mütterlicherseits<br />
wurde mehr nach Noten gespielt<br />
– mein Großvater war langjähriger<br />
Organist und Kirchenchorleiter und eine<br />
Zeit lang auch Kapellmeister der Musikkapelle<br />
Welschellen. Die Verbindung dieser<br />
beiden verschiedenen Zugänge zur<br />
Musik hat mich somit geprägt.<br />
KF: Wer ist Ihr Vorbild?<br />
A. Promberger: Vorbilder sind für mich<br />
jene Menschen, die ehrgeizig sind und<br />
genaue Ziele haben, die sie auch unter<br />
schwierigen Umständen zu erreichen versuchen,<br />
z.B. als Blinder auf den Mount<br />
Everest zu klettern. Ich lebe nach dem<br />
Motto: Man kann vieles im Leben erreichen,<br />
wenn man nur fest davon überzeugt<br />
ist.<br />
KF: Welche Charakterzüge schätzen Sie<br />
bei ihren Mitmenschen am meisten?<br />
A. Promberger: Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft<br />
sind für mich die wichtigsten<br />
Charaktereigenschaften.<br />
KF: Was möchten Sie noch erlernen bzw.<br />
wer oder was hätten Sie sein mögen?<br />
A. Promberger: Ich bin der Meinung,<br />
dass man nie ausgelernt hat. Zudem bin<br />
ich der Typ Mensch, der eine gewisse<br />
Portion an Herausforderung braucht.<br />
Deshalb hoffe ich, dass ich auf meinem<br />
Lebensweg noch vieles dazulernen werde,<br />
und das nicht nur in musikalischer Hinsicht.<br />
KF: Ihre Lieblingsgestalt/en in der Geschichte?<br />
A. Promberger: Leonardo da Vinci. Er war<br />
zu seiner Zeit den Menschen in allen Bereichen,<br />
ob Kunst oder Technik, meilenweit<br />
voraus und hatte solch fortschrittliche<br />
Ideen, dass er dafür nur belächelt wurde.<br />
Erst hunderte Jahre später erkannte man<br />
die wahre Genialität dahinter.<br />
KF: Ihre Lieblingsgestalt/en in der Dichtung?<br />
A. Promberger: Julia Engelmann. Sie ist<br />
eine Poetry-Slammerin, auf gut deutsch<br />
eine Erzählerin selbst geschriebener poetischer<br />
Texte. Sie berührt durch die tiefen<br />
Inhalte der Gedichte und trifft mit relativ<br />
einfachen Wortspielen die Herzen<br />
der Zuhörer.<br />
KF: Ihre Lieblingskomponisten?<br />
A. Promberger: Grundsätzlich habe ich<br />
keine Lieblingskomponisten, weil ich der<br />
Meinung bin, dass jeder Komponist gute<br />
und weniger gelungene Werke geschrieben<br />
hat. Um aber doch ein paar Namen zu<br />
nennen: Es beeindrucken mich die Werke<br />
von Orlando di Lasso und Giovanni Gabrieli,<br />
später dann von G.F. Händel. In der heutigen<br />
Zeit sind wohl Eric Whitacre und Samuel<br />
R. Hazo meine Favoriten.<br />
KF: Wie gehen Sie mit dem Thema „Klangarbeit“<br />
um?<br />
A. Promberger: In letzter Zeit lege ich<br />
sehr viel Wert auf das Einspielen und nutze<br />
diese Phase, um möglichst viel Klang aus<br />
jedem einzelnen Instrument herauszuholen.<br />
Einspielen ist für mich nicht nur ein<br />
„Warmblasen“ der Instrumente, sondern<br />
stellt bereits die eigentliche Klangarbeit dar.<br />
KF: Gehen Sie beim Einstimmen nach einer<br />
bestimmten Methode vor?<br />
A. Promberger: Beim Einstimmen verwende<br />
ich das Stimmgerät nur für den<br />
Referenzton, dann verlasse ich mich ausschließlich<br />
auf mein Gehör. Mir ist vor allem<br />
wichtig, dass jedes Register in sich intoniert<br />
ist. Außerdem lege ich bei den Proben<br />
sehr viel Wert darauf, dass jeder Musikant<br />
die Ohren offen halten und selbständig<br />
den Ton regulieren soll.<br />
KF: Wie würden Sie als Dirigent Ihren Führungsstil<br />
bezeichnen?<br />
A. Promberger: Ich würde mich nicht als<br />
strengen Kapellmeister bezeichnen, aber<br />
ich verlange von den Musikanten Disziplin<br />
bei Proben und Auftritten. Wenn man sich<br />
Ziele setzt, dann sollte man sie auch ernst<br />
nehmen und gemeinsam bestmöglich darauf<br />
hinarbeiten. Allerdings wünsche ich<br />
mir von jedem einzelnen auch Selbständigkeit<br />
und Eigenverantwortung<br />
KF: Wie gehen Sie vor, wenn Sie beim<br />
Einstudieren eines neuen Stücks längerfristig<br />
Widerstände von Seiten der Musiker<br />
spüren?<br />
A. Promberger: Grundsätzlich gebe ich<br />
jedem Musikanten die Chance, sich bei<br />
der Programmauswahl zu beteiligen und<br />
nehme Vorschläge auch gerne an. Ist ein<br />
Konzertprogramm einmal definiert, wird es<br />
16<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Zur Person<br />
Blasmusik<br />
prinzipiell bis zum Konzertauftritt so belassen.<br />
Der einzige Grund für das vorzeitige<br />
Weglegen eines Werkes besteht für mich<br />
darin, wenn ich erkenne, dass das Stück<br />
nicht dem Niveau der Kapelle entspricht.<br />
KF: Welches Blasmusikwerk führen Sie<br />
am liebsten auf und warum?<br />
A. Promberger: Da ich ein noch relativ<br />
„frischer“ Kapellmeister bin, habe ich noch<br />
kein Lieblingswerk für mich entdeckt. Allerdings<br />
kann ich mich immer mehr für die<br />
klassischen Werke begeistern.<br />
KF: Welche Rolle spielen neuere Komponisten<br />
aus „Gesamttirol“ in Ihrer dirigentischen<br />
Arbeit?<br />
A. Promberger: Ich wähle meine Konzertprogramme<br />
eigentlich nicht nach Komponisten<br />
aus, sondern primär nach der Musik.<br />
So spielte ich in den letzten Jahren<br />
durchaus auch Tiroler Komponisten wie<br />
Armin Kofler usw.<br />
KF: Wie sieht es andererseits mit der sogenannten<br />
Tiroler Schule (Ploner, Thaler,<br />
Tanzer) im Repertoire Ihrer Kapelle aus?<br />
A. Promberger: Für traditionelle Konzerte<br />
und Auftritte eignen sich die Stücke<br />
der Komponisten der „Tiroler Schule“<br />
sehr gut und finden auch beim Publikum<br />
großen Gefallen.<br />
KF: Was war Ihr bislang einschneidendstes<br />
Blasmusikerlebnis?<br />
A. Promberger: Mein einschneidendstes<br />
Blasmusikerlebnis war mein erstes Wertungsspiel<br />
als Kapellmeister in Vöran im<br />
Jahr 2013, als ich mich zum ersten Mal<br />
einer Fachjury gestellt und sehr positive<br />
Rückmeldungen erhalten habe. Allerdings<br />
wurde mir bewusst, dass ich die Kapelle<br />
zu höheren Leistungen hätte führen können,<br />
wenn ich als Kapellmeister bereits<br />
mehr Erfahrung bei der Stückauswahl besessen<br />
hätte. Für ein nächstes Wertungsspiel<br />
habe ich in dieser Hinsicht sehr viel<br />
dazugelernt.<br />
KF: Ihre Lieblingsbeschäftigung, abgesehen<br />
von der Musik?<br />
A. Promberger: Am liebsten halte ich<br />
mich in den Bergen auf, fernab von allem<br />
Tourismus – im Sommer beim Wandern<br />
und Klettern und im Winter beim Skitouren<br />
gehen. Die Natur holt mich vom Alltag<br />
runter und lädt gleichzeitig immer wieder<br />
meine Batterien auf.<br />
KF: Welche Hoffnungen und Wünsche<br />
haben Sie für die Zukunft der Blasmusikszene?<br />
A. Promberger: Ich wünsche mir, dass<br />
zwischen den Kapellen immer eine gesunde<br />
Konkurrenz bestehe, die die Musikanten<br />
in ihrer musikalischen Entwicklung<br />
antreibt, aber auf keinen Fall<br />
in Feindschaft übergeht. Der Spaßfaktor<br />
am Musizieren soll jedoch immer an<br />
erster Stelle stehen.<br />
Interview Joachim Buch<br />
KF: Gibt es ein Stück, dass Sie aufführen<br />
möchten und dessen Noten Sie bisher<br />
vergeblich gesucht haben?<br />
A. Promberger: Vergbelich habe ich<br />
bisher nach einer Brassband-Fassung<br />
des „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin<br />
Rodrigo gesucht. Das Stück taucht zwar<br />
im Soundtrack von „Brassed off“ auf (mit<br />
Solo für Flügelhorn). Mir wurde gesagt,<br />
dass die Witwe des Komponisten die weitere<br />
Inverlagnahme des Stückes untersagt<br />
habe. Keine Ahnung, ob das so stimmt.<br />
Kapellmeister Alberto Promberger beherrscht das Musizieren „aus dem<br />
Bauch heraus“, er möchte aber noch viel dazulernen.<br />
Zur Person:<br />
Alberto Promberger, Jahrgang 1981,<br />
stammt aus Welschellen im Gadertal.<br />
Bezüglich seiner musikalischen Ausbildung<br />
ist er einerseits Autodidakt, andererseits<br />
aber auch Absolvent des Kapellmeisterkurses<br />
des VSM. Seit 2011<br />
leitet er die Musikkapelle St. Lorenzen<br />
als Kapellmeister.<br />
Alberto Promberger ist zudem Gründer<br />
und Leiter der Pustertaler Brassband<br />
„Brässknedl“. Von 2000 bis<br />
2010 war er Posaunist bei der Musikkapelle<br />
Welschellen und seit dem<br />
Jahr 2008 spielt er dieses Instrument<br />
bei der Musikkapelle Villnöß.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 17
Komponisten im Porträt<br />
Mit Blasmusik durch die EU<br />
Komponisten aus den EU-Ländern – 11. Teil<br />
In dieser Ausgabe begleiten wir Joachim Buch auf der 11. Etappe seiner blasmusikalischen Europareise nach Großbritannien und<br />
Italien. Dabei stellt er uns wieder jeweils einen namhaften Komponisten aus den betreffenden Ländern vor.<br />
(21) Großbritannien – Nigel Clarke<br />
Land<br />
Fläche<br />
Großbritannien (Insel)<br />
219.331 km²<br />
Einwohner ca. 60.463.000<br />
Hauptstadt<br />
London<br />
Nigel Clark entwickelte im Laufe der<br />
Jahre immer mehr Begeisterung für das<br />
Komponieren.<br />
Die St. John’s Secondary School im britischen<br />
Margate ist normalerweise keine<br />
Adresse für Kinder, die einen höheren Bildungsabschluss<br />
anstreben. Der 1960 geborene<br />
Nigel Clarke hatte jedoch Glück, dass<br />
das Programm der Schule sehr an der Musik<br />
orientiert war und man speziell die Blechbläser<br />
förderte. Für Clarke, der zusätzlich<br />
noch an Legasthenie litt, reichte es aus, um<br />
als Militärmusiker eingestellt zu werden und<br />
von dort aus den Sprung zum Kompositionsstudium<br />
zu schaffen. Leicht selbstkritisch<br />
beschreibt er seine damaligen instrumentalen<br />
Fertigkeiten: „Ich war ein ganz ordentlicher<br />
2. oder 3. Kornettspieler, hätte<br />
es aber nie zum Solisten geschafft.“<br />
Clarke blieb neun Jahre bei der Militärmusik<br />
und spielte zuletzt in der Band of<br />
Her Majesty’s Irish Guards. Die letzten vier<br />
Jahre konnte er an der Royal Academy of<br />
Music studieren, was er als ausgesprochenes<br />
Glück empfand. Da seine instrumentalen<br />
Fähigkeiten gut, aber nicht exzellent<br />
waren, strebte er erst gar nicht eine<br />
Laufbahn als Orchestermusiker an, sondern<br />
studierte Komposition bei Paul Patterson.<br />
„Komponieren hat mich schon immer<br />
fasziniert und die Begeisterung dafür<br />
steigerte sich im Laufe der Jahre.“ Patterson<br />
hatte daran großen Anteil, auch weil<br />
er ihn mit vielen ganz Großen der Musikgeschichte<br />
zusammenbrachte: Messiaen,<br />
Berio, Penderecki und Ligeti, um nur einige<br />
zu nennen.<br />
Komponieren sei für ihn das Wichtigste<br />
im Leben – mit Ausnahme der Familie -,<br />
sagte Clarke in einem Interview mit einem<br />
englischen Musikmagazin. Eifersüchteleien<br />
scheint es seitens seiner Frau Stella, die<br />
bei der EU in Brüssel arbeitet, und seiner<br />
Söhne Joshua und Emile nicht zu geben.<br />
Beide Söhne sind musikalisch aktiv, auch<br />
wenn sie sich ansonsten eher für Politik<br />
oder Fußball interessieren. „Sie und Stella<br />
tolerieren mein manchmal exzentrisches<br />
Leben und ermuntern mich immer wieder,<br />
Neues zu wagen.“<br />
Paul Patterson selbst war mit „The Mighty<br />
Voice“ in den Blasmusik-Katalogen vertreten,<br />
jedoch zum regelmäßigen Schreiben<br />
für größere Bläserbesetzungen wurde<br />
Clarke eher von einem anderen Lehrer motiviert:<br />
James Watson. Der langjährige Dirigent<br />
der Black Dyke Band war zwar kein<br />
Komponist, aber er hatte in Clarkes Augen<br />
die Fähigkeit „zunächst als kompliziert erachtete<br />
Dinge einfach erscheinen zu lassen<br />
und auch aus mittelprächtigen Werken<br />
große Musik zu machen.“<br />
Mit „Samurai“ entstand 1995 das erste<br />
Werk Clarkes für Blasorchester, beeinflusst<br />
durch den Besuch des Konzerts einer japanischen<br />
Trommlergruppe. „Als ich diese<br />
sah, suchte ich sofort nach einer Möglich-<br />
keit, deren Energie in eines meiner Werke<br />
einfließen zu lassen.“ Außer japanischer<br />
Musik finden sich auch andere Einflüsse<br />
in Clarkes Werken, sei es aus China, vom<br />
Balkan, aus den USA oder aus Russland.<br />
„Ich liebe es, eine musikalische Elster zu<br />
sein“, gesteht er.<br />
Auch von außermusikalischen Einflüssen<br />
lässt sich Clarke gerne inspirieren, so<br />
z.B. von den Themen Weltraum und Science<br />
Fiction. „Gagarin“, eine Hommage<br />
an den ersten Menschen im Weltall, entstand<br />
2004 für ein Universitätsblasorchester<br />
in Minnesota. Neil Armstrong, der erste<br />
Mann auf dem Mond, sei damals noch<br />
in aller Munde gewesen, aber niemand<br />
mehr in den USA habe Gagarin gekannt.<br />
Nach dem 2010/11 geschriebenen „Earthrise“,<br />
inspiriert durch ein vom Mond aus<br />
geschossenen „Erdaufgangs“-Foto, spielt<br />
er zur Zeit mit dem Gedanken, ein drittes<br />
Werk dieser Art Neil Armstrong zu widmen.<br />
In jüngster Zeit schreibt Clarke wieder<br />
etwas häufiger für Brassband, angeregt<br />
durch seine nach eigenen Worten künstlerische<br />
sehr befriedigenden Zusammenarbeit<br />
mit der belgischen Spitzenformation<br />
Brassband Buizingen und ihrem Dirigenten<br />
Luc Vertommen.<br />
Nach einem Stück für Flügelhorn und<br />
Streichorchester schreibt Clarke derzeit<br />
an einem größeren Werk für Erzähler und<br />
Blasorchester. Das Middle Tennessee State<br />
Wind Orchestra unter seinem Dirigenten Dr.<br />
Reed Thomas soll im kommenden Frühjahr<br />
die Uraufführung spielen.<br />
18<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
(22) Italien – Lorenzo Della Fonte<br />
Land<br />
Fläche<br />
Italien<br />
(Repubblica Italiana)<br />
301.338 km²<br />
Einwohner ca. 60.800.000<br />
Hauptstadt<br />
Rom<br />
Lorenzo della Fonte hat sich<br />
als Komponist ganz dem<br />
Blasorchester verschrieben.<br />
Eigentlich halte er sich nicht in erster<br />
Linie für einen Komponisten, sagt Lorenzo<br />
Della Fonte. Der diplomierte Klarinettist beließ<br />
es aber nicht bei diesem einen Studiengang,<br />
sondern ergänzte diesen noch um<br />
Instrumentation für Blasorchester und verschiedene<br />
Dirigierkurse im In- und Ausland.<br />
Die Liste seiner Lehrer liest sich wie ein<br />
„Who is who“ der Blas- und der klassischen<br />
Musik: Jo Conjaerts, Henk van Lijnschooten,<br />
Robert Reynolds, Eugene Corporon,<br />
Gianluigi Gelmetti, Jan Cober und Andreas<br />
Spörri. Da war es klar, dass er sich auch<br />
im Fach Komposition weiterbilden wollte.<br />
Schon mit seiner ersten Kompositionsübung<br />
während des Studiums war der 1960<br />
in Berbenno geborene Musiker zumindest<br />
so zufrieden, dass er guten Gewissens auch<br />
einige weitere Werke folgen lassen konnte.<br />
Feste Kompositionszeiten hat der vielseitige<br />
Künstler nicht. Wenn jedoch ein Kompositionsauftrag<br />
an ihn ergangen ist, vertieft er<br />
sich ganz in diese Arbeit. „Dann sitze ich<br />
den ganzen Tag über an diesem Stück, bis<br />
es beendet ist.“<br />
Sein längstes Werk (siehe Tabelle) ist<br />
ihm auch am meisten ans Herz gewachsen:<br />
die fünfsätzige „Leo Ripanus Suite“.<br />
„Sie lehnt sich eng an die wunderschöne<br />
Stadt Ripatransone in der Provinz Marche<br />
an. Ich habe meine ganze Liebe für diesen<br />
Ort in die Musik gelegt“, erklärt Della<br />
Fonte, der seit vielen Jahren das Jugendorchester<br />
dieser Stadt leitet.<br />
Schon seit 1987 hat sich Della Fonte<br />
ganz dem Blasorchester verschrieben und<br />
sich nach und nach einen Ruf auch außerhalb<br />
seines Heimatlandes erworben. Seit<br />
1991 leitet er das Orchestra di Fiati della<br />
Valtellina, das er über die Grenzen Italiens<br />
hinaus bekannt gemacht hat. Zahlreiche<br />
CD-Aufnahmen und Auftritte bei internationalen<br />
Festivals (u.a. bei der WASBE-<br />
Konferenz 2001 in Luzern) zeugen von<br />
seiner Arbeit. Von 1994 bis 1998 leitete<br />
er das Civica Orchestra di Fiati di Milano,<br />
das einzige zivile Berufsblasorchester seines<br />
Landes, mit dem er Ende 1996 u.a. als<br />
eines der wenigen ausländischen Ensembles<br />
bei der Midwest Clinic in Chicago gastierte.<br />
Della Fonte gestaltete mit diesem<br />
Orchester italienische Erstaufführungen<br />
von Werken einiger amerikanischer Komponisten,<br />
wie beispielsweise Alfred Reed,<br />
Karel Husa oder Frank Ticheli. Er führte<br />
Originalwerke für Blasorchester<br />
aber auch ebenso Ensemblewerke von<br />
Komponisten wie Strawinsky, Ligeti oder<br />
Franco Donatoni auf; klassische Transkriptionen<br />
fehlten ebenso wenig in den Konzertprogrammen.<br />
Der Dirigent, Lehrer und Komponist<br />
Della Fonte, hat in jüngster Vergangenheit<br />
eine weitere kreative Ader an sich<br />
entdeckt: die Schriftstellerei. Nach einem<br />
Buch über die aktuelle Situation des Blasorchesters<br />
(„La Banda: Orchestra del nuovo<br />
millennio“)dreht sich sein jüngstes Buchprojekt<br />
um einen aus Italien stammenden<br />
Musiker, der im 19. Jahrhundert in den<br />
USA Karriere gemacht hat. Hauptperson<br />
in „L’infinita musica del vento“ ist Francis<br />
Sala, der etwa zwei Jahrzehnte vor John<br />
Philip Sousa die US Marine Band „The<br />
President’s Own“ dirigierte.<br />
A little Legend – Tre parti su tema die Clementi 1987 4’30<br />
Quiete stanze – Suite in tre parti 1989 6’00<br />
How came we ashore? – Soprano e banda, su testo di Shakespeare 1992 5’00<br />
Exortus - Symphonic Movement<br />
(1. Preis „Concorso Europeo“ Luxemburg 1994)<br />
Domine Jesu Christe – Marcia da processione su tema di Mozart 1994<br />
1993 6’30<br />
An Italian Shepherd Song – Variazione su tema popolare italiano 1994 5’30<br />
Il lago era immobile (4. Preis Concorso Internazionale Arge-Alp 1997) 1996 8’00<br />
Think of Horn – Corno solista e banda 1997 7’30<br />
Inno e Danza 1998 5’00<br />
Voci da Brescia (Menzione Concorso I. Capitanio Brescia 1999) 1998 14’00<br />
Verdi Variations 2000 11’00<br />
Adieu Montagnes Valdôtaines 2002<br />
Suoni del Tempo 2002 5’30<br />
Movenze di Festa 2003 8’00<br />
Leo Ripanus Suite (5 movimenti) 2003 18’00<br />
Ikuvium Suite (3 movimenti) 2005 11’00<br />
Suite „Arogno“ (5 movimenti) 2006 16’00<br />
Wind in May – Marcia )<br />
1. Preis Concorso Internazionale Città di Gubbio 2009)<br />
2009 4’00<br />
Status Mentis 2009 7’00<br />
Fanfara CLXXV <strong>2014</strong> 5’00<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 19
Vorschau<br />
Erster Teil des Landesmusikfestes<br />
am 1. und 2. Mai 2015 in Brixen<br />
Einladung zur Teilnahme an der Konzertwertung<br />
Wie bereits angekündigt, veranstaltet der<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen in Zusammenarbeit<br />
mit dem VSM-Bezirk Brixen im<br />
Rahmen des Landesmusikfestes eine Konzertwertung,<br />
zu der alle Musikkapellen des<br />
Verbandes zugelassen sind.<br />
Termin: FREITAG, 1. MAI,<br />
und SAMSTAG, 2. MAI 2015,<br />
IM FORUM BRIXEN<br />
Jede teilnehmende Musikkapelle wählt<br />
eines der in der Ausschreibung vorgegebenen<br />
Pflichtstücke und ein Selbstwahlstück<br />
der gleichen Schwierigkeitsstufe. Folgende<br />
Pflichtstücke zum Thema „Overture<br />
für Blasorchester“ wurden für die Konzertwertung<br />
2015 in Brixen festgelegt:<br />
Der Österreichische Blasmusikverband (ÖBV) hat seine Pflichtliteratur für die<br />
Konzertwertungsspiele 2015/16 auf einer Dreifach-CD veröffentlicht."<br />
Stufe Titel Komponist<br />
A Unterstufe Big Sky Overture Philipp Sparke<br />
B Mittelstufe Commemoration Overture Robert Sheldon<br />
C Oberstufe Overture on an Early American<br />
Claude T. Smith<br />
Folk Hymn<br />
D Kunststufe The Hounds of Spring Alfred Reed<br />
E Höchststufe Rumanian Overture Thomas Doss<br />
Die Pflichtstücke können auf der Homepage des VSM angesehen und angehört werden. Die Mitgliedskapellen erhalten zudem ein<br />
eigenes Rundschreiben mit allen Informationen zu den Konzertwertungsspielen.<br />
Die Anmeldungen und die Besetzungslisten sind bis spätestens 31.01.2015 mittels den dafür<br />
vorgesehenen Formularen per E-Mail an das VSM-Büro in Bozen zu senden.<br />
Sigisbert Mutschlechner<br />
Verbandskapellmeister<br />
20<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
•Programmvorschau<br />
Ablauf der Blasmusiktage<br />
Donnerstag, 6. November <strong>2014</strong>:<br />
15.30 - 18.30 Uhr (Konservatorium):<br />
Beginn der Komponistenwerkstatt<br />
mit Oliver Waespi<br />
20.00 - 22.00 Uhr (Konservatorium):<br />
Komponistenwerkstatt<br />
Freitag, 7. November <strong>2014</strong>:<br />
09.00 - 12.00 Uhr (Konservatorium):<br />
Komponistenwerkstatt<br />
14.30 - 18.00 Uhr (Konservatorium):<br />
Komponistenwerkstatt<br />
20.00 Uhr (Konzerthaus „Joseph Haydn“):<br />
Ofizielle Eröffnung der Blasmusiktage<br />
Festkonzert mit Verleihung des<br />
Blasmusikpreises des Landes Südtirol<br />
Mitwirkende Musikkapelle:<br />
Mk Villnöß (Leitung: Hans Pircher)<br />
Südtiroler Blasmusiktage <strong>2014</strong><br />
6. bis 8. November <strong>2014</strong> in Bozen<br />
Das Südtiroler Forum<br />
für Komponisten, Dirigenten, Musiker und Musikkapellen<br />
verband<br />
südtiroler<br />
musikkapellen<br />
Samstag, 8. November <strong>2014</strong>:<br />
09.00 - 12.00 Uhr (Kolpinghaus):<br />
Kapellmeister-Tagung<br />
09.00 - 12.00 Uhr (Pfarrheim):<br />
Jugendleiter-Tagung<br />
13.30 - 14.30 Uhr (Kolpinghaus):<br />
Kapellmeister-Tagung und Begegnung<br />
mit Komponisten<br />
09.00 - 12.00 Uhr (Pfarrheim):<br />
Jugendleiter-Tagung<br />
15.00 - 16.30 Uhr (Konservatorium):<br />
Werkstattkonzert mit Oliver Waespi<br />
und dem JuBoB<br />
18.00 Uhr (Konzerthaus „Joseph Haydn“):<br />
Jubiläumskonzert „10 Jahre Südtiroler<br />
Jugendblasorchester“ mit<br />
CD-Vorstellung und Uraufführung<br />
der Siegerwerke des<br />
VSM-Kompositionswettbewerbes<br />
Dreimonatskalender<br />
Datum Veranstalter Veranstaltung Ort Haus Beginn<br />
Fr-Sa, 10.-11. <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> VSM 4. Seminar für Führungskräfte, 1.Modul Brixen Cusanus Akademie 14:30<br />
OKT.<br />
Fr-So, 24.-26. <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> ÖBV / VSM Bundeswettbewerb Musik in kleinen Gruppen Toblach Grand Hotel<br />
Sa, 25. <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> VSM Konzert des SJBO Toblach Grand Hotel 20,00<br />
Mi, 5. November <strong>2014</strong> Bezirk Meran Stammtisch Stabführer Wird bekannt gegeben 20.00<br />
Do-So, 06.-08. Nov. <strong>2014</strong> VSM Südtiroler Blasmusiktage <strong>2014</strong> Bozen<br />
Do-Sa, 06.-08. Nov. <strong>2014</strong> VSM Komponistenwerkstatt mit Oliver Waespi Bozen Konservatorium<br />
DEZ. NOVEMBER<br />
Sa, 8. November <strong>2014</strong> VSM Jubiläumskonzert "10 Jahre SJBO" Bozen Konzerthaus "Joseph Haydn" 20.00<br />
Sa, 8. November <strong>2014</strong> VSM Jugendleitertagung Bozen Pfarrheim 09.00<br />
Sa, 8. November <strong>2014</strong> VSM Kapellmeistertagung Bozen Kolpinghaus 09.00<br />
Fr-So, 14.-16. Nov. <strong>2014</strong> Bezirk Bruneck Kapellmeister-Fortbildung mit Maurice Hamers Wird bekannt gegeben<br />
Sa, 15. November <strong>2014</strong> Bezirk Bozen Bezirkskegeln Bozen Sportzone Pfarrhof 17.00<br />
Fr-Sa, 28.-29. Nov. <strong>2014</strong> VSM 4.Seminar für Führungskräfte, 2. Modul Nals Lichtenburg 09.00<br />
So, 14. Dezember <strong>2014</strong> Bezirk Brixen Adventkonzert „Spiel in kleinen Gruppen“ Milland Freinademetz-Kirche 17.00<br />
So, 14. Dezember <strong>2014</strong> Bezirk Schlanders Konzert des Bezirksjugendblasorchesters Schlanders Karl Schönherr Saal 18.00<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 21
Neues<br />
RUNDEL feiert<br />
50-sten Geburtstag<br />
Das Werk des Verlagsgründers Siegfried Rundel lebt weiter<br />
Der Musikverlag<br />
RUNDEL feiert<br />
heuer sein<br />
50-jähriges<br />
Jubiläum.<br />
unerlaubte Vervielfältigung, Vermietung,Sendung!All<br />
RUNDEL<br />
COMPACT<br />
EXCERPT VERSION<br />
SAMPLE · NOT FOR SALE<br />
© + ® <strong>2014</strong><br />
rights of the manufacturer and of<br />
© 08/<strong>2014</strong> Musikverlag Rundel. Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Kein Verleih! Keine<br />
the<br />
the EU.<br />
owner<br />
RUNDEL<br />
Musik für Blasorchester<br />
Music for Concert Band<br />
Musique pour Harmonie<br />
Muziek voor Harmonie<br />
Musica per Banda<br />
the recorded work prohibited. Made in<br />
of the work producedreserved. Unauthorized<br />
GEMA<br />
1. Jubiläumsfanfare · 2. Panta Rhei · 3. Klang der Alpen · 4. Trailermusik · 5. Mountain Wind · 6. Giudita<br />
7. Crossbreed · 8. Patria · 9. Mosaichoralmente · 10. Paidushko · 11. Arethusa · 12. Crith Mhonadh<br />
13. Marche des Janissaires · 14. Annen-Polka · 15. Ode »An die Freude« · 16. Scarborough Fair · 17. Bésame Mucho<br />
18. Funky Afternoon · 19. Got It ? - Flaut It ! · 20. Purple Rain · 21. Hard Rock Stones · 22. Music<br />
23. Modern Girl · 24. The Living Years · 25. Goldene Kameraden · 26. Venezia · 27. Ungarns Kinder<br />
28. Ferienfahrt · 29. Unterm Kirschbaum · 30. Uschi-Polka · 31. Ein Denkmal für die Blasmusik<br />
32. Schöne Ferienzeit · 33. Von Freund zu Freund<br />
Vario: 34. Young Concert Collection · 35. Fun Train · 6. The Old Fortress<br />
37. Cat Walk · 38. Song for the Memory · 39. Tijuana Station<br />
Musik zur Weihnachtszeit: 40. O Sanctissima ! · 41. Mentis<br />
42. Veni Emmanuel · 43. La Nuit des Cloches<br />
44. Bethlehem · 45. Cinderella's Dance<br />
PRCD 2/<strong>2014</strong><br />
performance and broadcasting of<br />
copying, hiring, lending, public<br />
Musik für Blasorchester | Music for Concert Band | Musique pour Harmonie | Muziek voor Harmonie | Musica per Banda<br />
www.rundel.de www.rundel.at www.rundel.ch www.rundel.nl www.rundelmusic.com<br />
Titelblatt des RUNDEL-Jubiläumskatalogs<br />
Auch viele Kapellmeisterkollegen meiner<br />
Generation sind mit diesem Verlag im<br />
Allgemeinen und mit der persönliche Beratung<br />
des leider allzu früh verstorbenen Verlagsgründers,<br />
Komponisten und Arrangeurs<br />
Siegfried Rundel „aufgewachsen“.<br />
Zum Jubiläumsjahr hat RUNDEL einen<br />
Katalog vorgestellt, der eine ganz besonders<br />
vielseitige Zusammenstellung an<br />
neuen Blasorchesterwerken für alle Besetzungen,<br />
Schwierigkeitsstufen und Anlässe<br />
anbietet.<br />
Das Titelbild des Katalogs zeigt einen handschriftlichen<br />
Violinschlüssel aus einem<br />
Manuskript von Siegfried Rundel, der den<br />
Musikverlag 1964 gegründet und mit viel<br />
Herzblut und unermüdlichem Einsatz aufgebaut<br />
hat. Gott sei Dank ist es der Familie<br />
Rundel gelungen, sich aller Globalisierung<br />
zum Trotz gegen die übermächtigen<br />
Großverlage zu behaupten.Ein besonderes<br />
„Geburtstagsgeschenk“ stellen die zwei<br />
Jubiläums-CDs „Panta Rhei“ und „Ein<br />
Halbes Jahrhundert“ dar.<br />
22<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
PANTA RHEI<br />
In unserer schnelllebigen Zeit besinnen<br />
sich die Menschen immer mehr auf Traditionen<br />
und heimische Kultur zurück. Geprägt<br />
durch den modernen Zeitgeist öffnet<br />
sich dadurch ein ganz neuer Zugang zum<br />
kulturellen Erbe.<br />
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in<br />
der CD „Panta Rhei“ wider, die vom Musikkorps<br />
der Deutschen Bundeswehr unter<br />
der Leitung von Oberstleutnant Christoph<br />
Scheibling eingespielt wurde. In den<br />
zwölf Titeln werden Elemente alter Musikformen<br />
zeitgemäß und kunstvoll in neue<br />
Klänge eingebunden und versprechen<br />
eine klanggewaltige Symbiose von Tradition<br />
und Moderne.<br />
Oberstleutnant Christoph Scheibling<br />
hat mit dem Musikkorps der deutschen<br />
Bundeswehr 18 ausgewählte Titel<br />
aus dem RUNDEL-Verlagsprogramm<br />
eingespielt.<br />
EIN HALBES JAHRHUNDERT<br />
Weil die volkstümliche Blasmusik seit<br />
der Verlagsgründung wichtiger Bestandteil<br />
war und ist, präsentiert die zweite Jubiläums-CD<br />
„Ein Halbes Jahrhundert“ mit<br />
18 ausgewählten Musikstücken eine vielfältige<br />
und historisch angelegte Mischung<br />
aus der RUNDEL-Geschichte.<br />
Stücke von Siegfried Rundel sind dabei<br />
ebenso vertreten wie solche von Komponisten,<br />
die das Verlagsprogramm stark<br />
geprägt haben, sowie von jungen Komponisten,<br />
die mit ihren frischen Ideen<br />
begeistern.<br />
NACHSCHLAGEWERK DER<br />
VOLKSTÜMLICHEN BLASMUSIK<br />
Zum runden Jubiläum hat der Musikverlag<br />
RUNDEL zudem ein Nachschlagewerk der<br />
volkstümlichen Blasmusik erstellt, das als<br />
handliches und übersichtliches Verzeichnis<br />
alle Polkas, Walzer, Märsche, volkstümliche<br />
Solo-Stücke und Potpourris auflistet,<br />
die in der 50-jährigen Verlagsgeschichte<br />
veröffentlicht wurden. Dieses Verzeichnis<br />
ist damit nicht nur trockenes Nachschlagewerk,<br />
sondern historisches Dokument<br />
der RUNDEL-Geschichte.<br />
Stephan Niederegger<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 23
„Verkehrte Welt“ im ersten<br />
Musikvideo von „Tante Frieda“<br />
Die Südtiroler Band stellt die Welt auf den Kopf.<br />
Anstatt den Tag einfach hinzunehmen,<br />
dem gewohnten Trott durch seine Vorhersehbarkeit<br />
mit den üblichen Emotionen zu<br />
folgen, verdreht „Tante Frieda" mit ihrem<br />
neuen Song „Verkehrte Welt“ die Perspektiven<br />
des Alltags, und das ohne Rücksicht<br />
auf Verluste. Die Musik stammt von Thomas<br />
Mahlknecht, der Autor des Songtextes ist<br />
Harald Wieser. Zur Musik gibt es nun auch<br />
das Video. Gedreht wurde in Klausen und<br />
Brixen mit der Regisseurin Nancy Camaldo,<br />
die selbst aus Klausen stammt.<br />
„In unserer verkehrten Welt gibt es weder<br />
richtig noch falsch und nichts braucht<br />
der Logik Rechnung zu tragen", so Evi Mair,<br />
Sängerin und Frontfrau der Band. "Es geht<br />
um die Betrachtung der Welt aus einem<br />
anderen Blickwinkel, z.B. von der Musik<br />
gehört zu werden, anstatt sie zu hören<br />
oder mal den Spieß umzudrehen und die<br />
Spatzen auf Kanonen schießen zu lassen.<br />
Kopfkino dieser Art bringt Schwung und<br />
Farbe ins Alltagsgrau."<br />
Und genau so ist auch die Musik von<br />
„Tante Frieda": frisch, gut gelaunt, überraschend!<br />
„Tante Frieda" sind eine Frau<br />
und sieben Männer, musikalisch gesprochen:<br />
eine Stimme, fünf Blasinstrumente<br />
plus Schlagzeug und Gitarre. In dieser ausgefallenen<br />
Besetzung spielt die Band eigene<br />
Kompositionen mit einer unverwechselbaren<br />
Mischung von Pop und Rock bis<br />
hin zu Funk und Techno, versehen mit der<br />
richtigen Portion Blasmusik. Dabei begeisterte<br />
die Band bereits im In- und Ausland,<br />
unter anderem als Vorgruppe von LaBrass-<br />
Banda oder als Act beim „Woodstock der<br />
Blasmusik“.<br />
Ab sofort ist das Video auf<br />
Youtube verfügbar!<br />
(https://www.youtube.com/verkehrtewelt)<br />
Mit Pop, Rock, Funk, Techno und der richtigen Portion Blasmusik begeistert die Gruppe „Tante Frieda“ – im Bild bei einem ihrer<br />
Liveauftritte.<br />
24<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Musikpanorama<br />
Blasmusik<br />
Südtiroler Klänge in Nordbayern<br />
Stadtkapelle Bozen zu Gast in Roth bei Nürnberg<br />
Am 24. und 25. Mai <strong>2014</strong> war die Stadtkapelle<br />
Bozen zu Gast beim Blasmusikfest<br />
in Roth, im Fränkischen Seenland bei<br />
Nürnberg. Auf die Wertungsspiele, welchen<br />
sich zahlreiche Orchester stellten,<br />
folgte als Höhepunkt des Festivals das<br />
Galakonzert am Samstagabend, zu dem<br />
die Stadtkapelle Bozen als internationaler<br />
Vertreter eingeladen war. Um den internationalen<br />
Charakter des Festivals und<br />
insbesondere des Galakonzertes zu unterstreichen,<br />
hatten die Organisatoren neben<br />
der Stadtkapelle Bozen auch die Nordbayerische<br />
Brass Band, ein Auswahlensemble<br />
des Nordbayerischen Musikbundes, für<br />
das Konzert gewinnen können. Das begeisterte<br />
Publikum belohnte beide Blasorchester,<br />
die am Ende des Galakonzertes auch<br />
ein Werk gemeinsam darboten, mit Standing<br />
Ovations.<br />
Am Sonntagvormittag gestaltete die<br />
Stadtkapelle Bozen zudem den ökumenischen<br />
Gottesdienst auf der Rother Seebühne<br />
mit geistlichen Werken.<br />
Marschmusik und Marschformation<br />
standen am Sonntag ebenfalls auf dem<br />
Programm. Mit einem Sternmarsch und<br />
einem Gemeinschaftskonzert aller beteili-<br />
gten Musikkapellen fand das Blasmusikfestival<br />
auf dem Stadtplatz von Roth seinen<br />
festlichen Abschluss.<br />
Stadtkapelle Bozen<br />
Große Begeisterung erntete die Stadtkapelle Bozen bei ihren Auftritten in<br />
Roth – Bayern.<br />
Jungmusikanten musizieren auf der Alm<br />
Jugendkapelle Naturns + Jugendkapelle Schnals = Jugendkapelle „Marzon“<br />
Am Freitag, 4. Juli <strong>2014</strong>, brachen rund<br />
30 motivierte Jungmusikanten aus Naturns<br />
und Schnals zum heurigen Sommercamp<br />
auf.<br />
Kaum auf der Marzoner Alm am Kastelbeller<br />
Freiberg angekommen, wurde schon<br />
zu den Instrumenten gegriffen und so startete<br />
in den „Unterrichtsräumen“ der wunderbaren<br />
Natur sofort die intensive Probenphase.<br />
Auch Gruppenspiele standen<br />
auf dem Programm, sodass der Teamgeist<br />
nicht nur beim Musizieren gestärkt wurde.<br />
Die „Regen-Intermezzi“ ließen alle Teilnehmer<br />
unbeeindruckt und so vergingen die<br />
Stunden im Flug. Am Sonntag ging dann für<br />
die begeisterten Jungmusikantinnen und –<br />
musikanten der „Alm-Vorhang“ auf. Unter<br />
der Leitung von Charlotte Rainer und Daniel<br />
Götsch brachte die Jugendkapelle „Marzon“<br />
das abwechslungsreiche und „peppige“<br />
Programm zur Aufführung. Der kräftige<br />
Applaus des Publikums zeigte, dass<br />
sich das Proben ausgezahlt hat. Die erlebnisreichen<br />
Tage werden allen Beteiligten sicherlich<br />
noch lange im Gedächtnis bleiben.<br />
Jugendkapelle Schnals und Naturns<br />
(Rudi Mair)<br />
Die Marzoner Alm gab der sichtlich gut gelaunten Jugendkapelle von Naturns–<br />
Schnals den Namen.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 25
Musikpamorama<br />
Neue Vereinsfahne für Musikkapelle Trens<br />
Segnung und Festakt unter dem Motto „Musik verbindet“<br />
Am 27. Juli dieses Jahres wurde in der<br />
Wallfahrtskirche von Maria Trens im Rahmen<br />
eines Festgottesdienstes und in Anwesenheit<br />
zahlreicher Abordnungen der<br />
Musikkapellen aus den umliegenden Gemeinden<br />
die neue Fahne der Musikkapelle<br />
Trens von Pater Pius gesegnet und<br />
ihrer Bestimmung übergeben. Bereits vor<br />
40 Jahren, zum 25-jährigen Bestandsjubiläum,<br />
hatte die MK Trens eine Fahne<br />
bekommen. Die im Laufe der Zeit aufgetretenen<br />
Abnutzungserscheinungen<br />
ließen jedoch den Wunsch aufkommen,<br />
eine neue Fahne anzuschaffen. Nach<br />
einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit<br />
sowie einem einstimmig gefassten<br />
Beschluss der Mitglieder der MK<br />
Trens wurde die Fahnenstickerei Gärtner<br />
in Mittersill (Österreich) mit der Herstellung<br />
der neuen Fahne beauftragt. Motive<br />
des Wallfahrtsortes Maria Trens und<br />
ein Bild der Hl. Cäcilia zieren die Fahne<br />
ebenso wie der Leitspruch „Musik verbindet“.<br />
Unter diesem Motto wurde auch<br />
der Festakt begangen, zu dem Obmann<br />
Andreas Saxl die Ortsbevölkerung und<br />
eine Reihe von Ehrengästen begrüßen<br />
konnte. Bürgermeister Armin Holzer, VSM-<br />
Verbandsobmann-Stellvertreter Thomas<br />
Hölzl und VSM-Bezirksobmann Meinhard<br />
Oberhauser brachten in ihren Grußbotschaften<br />
ihre Freude und Anerkennung<br />
über die hochwertige neue Fahne zum<br />
Ausdruck. Mit einem zünftigen Musikfest<br />
wurde die Neuerwerbung gebührend<br />
gefeiert.<br />
„Musik verbindet“, dieser Leitspruch ziert die neue Vereinsfahne der MK Trens – im<br />
Bild mit Fähnrich Michael Wild und den Fahnenpatinnen Helena Wild und Priska<br />
Hochrainer.<br />
Stimmungsvolles Sommernachtskonzert<br />
der MK Naturns<br />
Gesangseinlagen von Solisten aus eigenen Reihen<br />
Als hätte Petrus es gewusst- dieses Konzert<br />
durfte nicht ins Wasser fallen – und es<br />
tat es auch nicht. Bei gutem Wetter waren<br />
zahlreiche Besucher in die stimmungsvolle<br />
Freilichtarena geströmt und begleiteten die<br />
Musikantinnen und Musikanten auf eine<br />
musikalische Reise in die Film- und Musicalwelt.<br />
Kapellmeister Dietmar Rainer<br />
hatte mit seiner Programmauswahl wieder<br />
einmal ein glückliches Händchen bewiesen.<br />
Mit humorvollen Dialogen führte<br />
das Moderatorenpaar Julia Leiter und Daniel<br />
Götsch durch den Abend. Der musikalische<br />
Bogen spannte sich von Soundtracks<br />
berühmter Filmkomponisten bis<br />
hin zu Ohrwürmern aus Musicals wie „Elisabeth“<br />
oder „The Lion King“; mit E- Piano<br />
und E- Bass sowie mit einem fein abgestimmten<br />
Ton –und Lichtdesign wurde<br />
das Konzert zusätzlich akustisch wie optisch<br />
aufgewertet. Beeindruckend und<br />
überzeugend waren sämtliche Gesangseinlagen-<br />
wohlgemerkt alles Solisten aus<br />
den eigenen Reihen: Anna Platzgummer,<br />
Thomas Moriggl, Emma Nischler und Veronika<br />
Schnitzer meisterten ihre Soloparts<br />
mit Bravour. Der tosende Schlussapplaus<br />
brachte es zum Ausdruck: Das Experiment<br />
Sommernachtskonzert der MK Naturns<br />
war gelungen.<br />
Rudi Mair<br />
Ein strahlender Kapellmeister Dietmar Rainer mit den Solisten Veronika Schnitzer,<br />
Anna Platzgummer, Thomas Moriggl und Emma Nischler (v.l.)<br />
26<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Blasmusik<br />
3. Aulage von „music.project.auer“<br />
Acht Vereine beim gemeinsamen Musik- und Theaterprojekt auf der Bühne<br />
Rund 200 Akteure aus acht verschiedenen<br />
Vereinen führten am Abend des 30.<br />
Mai das Stück "Der Traum eines österreichischen<br />
Reservisten" auf. Das 3.music.<br />
project.auer der Musikkapelle Auer entpuppte<br />
sich dabei zu einem Hör- und Seherlebnis<br />
sondergleichen.<br />
Nach zwei Musikstücken, der Begrüßung<br />
durch Obmann Manfred Abram und<br />
einer Einführung durch Sprecherin Barbara<br />
Raich konnte das Spektakel am Eislaufplatz<br />
von Auer beginnen. In einem Zusammenspiel<br />
aus Musik, Theater, Licht und<br />
Bild präsentierten die Musikkapelle Auer,<br />
die Musikkapelle Petersberg, die Heimatbühne<br />
Auer, die Schützenkompanie Auer,<br />
die Tiroler Kaiserjäger 2. Regiment Süd-Tirol,<br />
die Volkstanzgruppe Auer, die Freiwillige<br />
Feuerwehr Auer und die Jägerschaft<br />
aus Auer das 1890 entstandene Stück<br />
„Der Traum eines österreichischen Reservisten“.<br />
Das große Tongemälde von Carl<br />
Michael Ziehrer (1843-1923), das wegen<br />
des großen Aufwandes nur selten auf die<br />
Bühne gebracht wird, kam in beeindruckender<br />
Weise unter der musikalischen<br />
Leitung von Kapellmeister Arnold Leimgruber<br />
und der Regie von Toni Kofler zur<br />
Aufführung. Das zahlreich erschienene<br />
Publikum - es waren an die 800 Gäste -<br />
dankte mit viel Applaus. Für die anschließende<br />
Bewirtung sorgte schließlich Verein<br />
Nummer 9: der Carnevalverein Auer.<br />
MK Auer<br />
Ehrensalve der Schützenkompanie Auer für einen stilechten Kaiser – im Hintergrund<br />
die MK Auer<br />
Grenzüberschreitende musikalische Freundschaft<br />
Jungmusikanten-Hüttenlager in Antholz Niedertal<br />
Musikalischer Freundschaft und Partnerschaft<br />
standen im Vordergrund, als<br />
vom 29. bis zum 31. August die Jugendleiter<br />
der Musikkapellen Antholz, Josef<br />
Leitgeb Antholz-Niedertal und der Bundesmusikkapelle<br />
Oberlangkampfen (A)<br />
ein gemeinsames Hüttenlager für Jungmusikanten<br />
organisierten. In den 3 Tagen<br />
voller Spiel, Spaß und Abenteuer haben<br />
die Jungmusikanten aus Antholz mit<br />
den Jungmusikanten aus Oberlangkampfen<br />
viel Gemeinschaft erlebt und so sind<br />
nun Freundschaften auch unter den Jugendlichen<br />
entstanden. Vor allem stand<br />
aber die Musik im Mittelpunkt dieses Projektes.<br />
Dietmar Huber, Kapellmeister der<br />
Musikkapelle Josef Leitgeb, hat mit den<br />
Jungmusikanten ein sehr abwechslungsreiches<br />
Programm einstudiert, welches<br />
von „Smoke on the water“ über „Summernightrock“<br />
bis zur „Vogelwiese“ reichte.<br />
Ebenso wurden mit den einzelnen Registern<br />
weitere Stücke einstudiert und voller<br />
Stolz und Freude den Eltern, Geschwistern<br />
und Freunden beim Abschlusskonzert auf<br />
der Hofstattalm präsentiert. Die Jugendleiterinnen<br />
Veronika Rieder (MK Antholz),<br />
Barbara Lackner (BMK Oberlangkampfen)<br />
und Marlies Feichter (MK Josef Leitgeb)<br />
wollen das Projekt im kommenden Jahr<br />
fortführen und das Hüttenlager vielleicht<br />
sogar in Oberlangkampfen veranstalten.<br />
MK Josef Leitgeb - Antholz Niedertal<br />
Das Hüttenlager auf der Alm trug zum freundschaftlichen Kontakt der<br />
Jungmusikanten aus Antholz und Oberlangkampfen bei.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 27
Musikpanorama<br />
Schützenkapelle Pichl-Gsies beim 1. Karlsbader<br />
Blasmusikfestival in Tschechien<br />
Besuch in der mondänen Kurstadt Karlsbad<br />
Vom 29. bis 31. August <strong>2014</strong> war<br />
die Schützenkapelle Pichl zu Gast beim<br />
1. Karlsbader Blasmusikfestival. Gemeinsam<br />
mit zwei weiteren Blaskapellen aus<br />
Polen und Udine wurde auf den Straßen<br />
und Plätzen von Karlsbad musiziert.Es<br />
gab aber auch ausreichend Gelegenheit,<br />
die weltweit bekannte Kurstadt mit ihren<br />
unzähligen Sehenswürdigkeiten zu erkunden.<br />
Ein besonderes Erlebnis war es,<br />
gemeinsam mit der „Tschechischen Majorettenunion“<br />
durch die Straßen Karlsbads<br />
zu marschieren. Höhepunkt der<br />
Reise war jedoch der Galaauftritt am Samstagabend<br />
im Konzertsaal des „Grand Hotel<br />
Pupp“, wobei die mitwirkenden Musikkapellen<br />
jeweils mit einem Kurzauftritt<br />
dem Publikum eine Kostprobe Ihres Könnens<br />
boten.<br />
Schützenkapelle Pichl-Gsies<br />
Die Schützenkapelle Pichl-Gsies vor dem historischen Grand Hotel Pupp<br />
Jubiläumsjahr für die Musikkapelle Schabs<br />
30 Jahre Aufschwung<br />
Vor 30 Jahren haben einige musikbegeisterte<br />
Dorfbewohner von Schabs die<br />
Initiative ergriffen und eine eigene Musikkapelle<br />
gegründet. Seitdem befindet sich<br />
der Klangkörper im steten Aufschwung.<br />
Grund genug also, das 30-jährige Jubiläum<br />
in diesem Jahr gebührend zu feiern.<br />
Ein erster Höhepunkt wurde bereits<br />
im März gesetzt, als Obmann Stefan Gasser<br />
und die derzeit 56 aktiven Musikantinnen<br />
und Musikanten unter der Leitung<br />
von Kapellmeister Stephan Obexer zum<br />
Jubiläumskonzert einluden.<br />
Das Fest zum runden Jubiläum folgte<br />
dann im Juli, bei dem gleichzeitig das<br />
30-jährige Bestehen der Partnerschaft der<br />
Gemeinde Natz-Schabs mit der Gemeinde<br />
Fritzens (A) gefeiert werden konnte.<br />
Als krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres<br />
wird die Musikkapelle Schabs anlässlich<br />
eines Kirchenkonzertes am 8. November<br />
um 18.00 Uhr in der Stiftskirche<br />
von Neustift gemeinsam mit den Kirchenchören<br />
von Schabs, Natz, Raas und Aicha<br />
die „Missa Katharina“ von Jacob de Haan<br />
aufführen.<br />
Musikkapelle Schabs<br />
Die Musikkapelle Schabs wird unter der Leitung von Kapellmeister Stephan Obexer<br />
die „Missa Katharina“ von Jacob de Haan aufführen.<br />
28<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Vorweg<br />
Heimatplege<br />
Kreise ziehen<br />
Kleine Beiträge, die Großes bewirken<br />
Medium entzünden, solche Funken können<br />
Sie mit Ihrem Beitrag entzünden. Irgendwo<br />
fängt jemand Feuer und ermöglicht<br />
es, dass die Thematik Kreise zieht und<br />
die Gemeinschaft Gleichgesinnter wächst.<br />
Sich angesprochen fühlen<br />
Einem aufmerksamen und respektvollen Beobachter können sich im Kleinen<br />
wunderbare Ausblicke erschließen wie zum Beispiel dieses mit Tauperlen besetzte<br />
Frauenmäntelchen.<br />
Unlängst erreichte mich der Anruf einer<br />
Leserin unseres Kulturheftes. Sie habe<br />
sich in den im August abgedruckten Zeilen<br />
wiedergefunden und sei dankbar, in<br />
den Heimatpflegern Menschen mit gleicher<br />
Haltung und Gesinnung anzutreffen.<br />
Prompt hat sie sich bereit erklärt, zu<br />
dem ihr am Herzen liegenden Thema einen<br />
Beitrag zu verfassen. Unter der Rubrik<br />
„informiert & reflektiert“ erfahren Sie<br />
dank dieser glücklichen Fügung einiges<br />
über Heilkräuter, was Sammeln wirklich<br />
bedeutet und wie man sich der Natur bedienen<br />
kann, ohne ihr Schaden zuzufügen.<br />
Aufforderung<br />
Wenn man sich tagtäglich in einem ähnlichen<br />
Radius bewegt, läuft man Gefahr, der<br />
Routine zum Opfer zu fallen und – wie kann<br />
man es am besten ausdrücken? – „heimatblind“<br />
zu werden. Kleine Impulse reichen<br />
oft aus, um den Blick wieder zu klären und<br />
an Offenheit zu gewinnen.<br />
Seit nunmehr einem Jahr kümmere<br />
ich mich um die publizistischen Aktivitäten<br />
des Heimatpflegeverbandes. Ich<br />
habe zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen<br />
und meinen Informationsfundus<br />
um ein Vielfaches erweitert. Jener Aspekt<br />
aber, der mein Leben am nachhaltigsten<br />
prägt und prägen wird, ist die gewonnene<br />
Sensibilität für die Belange der Heimatpflege,<br />
die Einsicht, dass der Erhalt und<br />
der Schutz unserer Heimat nicht nur eine<br />
Handvoll Traditionalisten etwas angeht,<br />
sondern mich. Ich fühle mich angesprochen,<br />
identifiziere mich und will, ja muss<br />
meinen Beitrag leisten. Und sei es einfach<br />
nur, die Umwelt mit anderen Augen<br />
zu betrachten.<br />
Interessen teilen<br />
Ist es nicht so, dass wir oftmals derart<br />
mit uns selbst beschäftigt sind, mit Arbeit<br />
oder Familie, dass wir kaum Zeit und Energie<br />
haben, uns mit allerlei Themen zu<br />
befassen? Wir dosieren folglich und filtern<br />
aus dem reichen Angebot nur jenes heraus,<br />
welches auf unserer Prioritätenliste angestrichen<br />
ist. Und hier und da ein Funke,<br />
der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht.<br />
Solche Funken wollen wir mit unserem<br />
Die Seiten im Kulturfenster sind zwar<br />
knapp bemessen, die Rubriken klar definiert,<br />
aber für Anliegen, Vorhaben, Beobachtungen<br />
und Stellungnahmen seitens<br />
unserer Leserschaft wird immer und überaus<br />
gerne Platz eingeräumt. Fühlen Sie<br />
sich also frei, uns Ihre Gedanken – Ihren<br />
Funken – mitzuteilen.<br />
Dieser Austausch erst lässt die Gemeinschaft<br />
der Heimatpfleger zusammenwachsen<br />
und macht sie lebendig.<br />
Ihre<br />
Sylvia Rottensteiner<br />
Ihre Beiträge senden Sie bitte an: rottensteiner.sylvia@gmail.com<br />
Für etwaige Vorschläge und Fragen<br />
erreichen Sie mich unter folgender Nummer: 347 0325027 (Sylvia Rottensteiner)<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 29
Das Thema<br />
Küchelbergtunnel<br />
Großer landschaftlicher Eingriff in sensible Zone<br />
Die Kapelle der Zenoburg oberhalb der<br />
Gilfschlucht (Foto: Daniel Vicentin)<br />
Schöne raue Natur: die tosenden Gewässer in der Gilfschlucht<br />
(Foto: Daniel Vicentin)<br />
Über den Küchelbergtunnel und die Lösung<br />
der Meraner Verkehrsprobleme wird<br />
seit Jahren heftig diskutiert. Kürzlich hat<br />
die Architektengruppe PAM (Plattform Architektur<br />
Meran) darauf hingewiesen, dass<br />
das Ausführungsprojekt des zweiten Bauloses<br />
der Nord-West-Umfahrung im Bereich<br />
des Nordportals des Küchelbergtunnels einen<br />
untragbaren landschaftlich-kulturellen<br />
Eingriff erforderlich macht.<br />
Heimatplegeverband fordert<br />
umweltverträgliche Alternative<br />
Die geplante Tunnelausfahrt liegt an einer<br />
steilen Hanglage unterhalb der Zenoburg,<br />
an einer problematischen Stelle in<br />
unmittelbarer Nähe der Passer und gegenüber<br />
der Naherholungszone Lazag.<br />
Bis zu 15 Meter hohe Stützmauern, eine<br />
225 Meter lange Hangbrücke und eine<br />
neue, abgesenkte Passeirer Brücke haben<br />
schwere Eingriffe in eine sensible Landschaft<br />
zur Folge.<br />
Die Zenoburg hoch über der<br />
Gilfschlucht der Passer<br />
Die Zenoburg erhebt sich auf einem Felsvorsprung<br />
des Küchelberges am nordöstlichen<br />
Rand von Meran. Im 8. Jahrhundert<br />
hat man hier eine dem Hl. Zeno geweihte<br />
Kapelle gebaut, in der die Heiligen Valentin<br />
und Korbinian bestattet waren. Der Landesfürst<br />
König Heinrich von Böhmen, Vater<br />
von Margarethe Maultasch, residierte meistens<br />
auf der Zenoburg. Die Burg wurde<br />
1347 im Krieg mit Karl von Böhmen bis<br />
auf die Ringmauer, den Bergfried und die<br />
Kapelle zerstört. Am Kapellenportal kann<br />
man nach wie vor die älteste Reliefdarstellung<br />
des Tiroler Adlers bewundern.<br />
Bessere landschaftliche<br />
Einbindung gefordert<br />
Oberhalb der Gilfschlucht, gegenüber<br />
dem Burghügel, liegt am Ufer der Passer<br />
der Rest eines Auwaldes. Dieses vielfältige<br />
Ökosystem in der Lazag weist einen schützenswerten<br />
Erlenbestand auf und stellt<br />
ein unschätzbares Habitat vieler Vogelarten<br />
in Stadtnähe dar. Auch dieses Naherholungsgebiet<br />
von Meran ist vom Küchelbergtunnel<br />
betroffen.<br />
Die Architektengruppe PAM schlägt<br />
zwei Alternativlösungen vor, die bereits in<br />
der Presse veröffentlicht wurden. Aus der<br />
Sicht des Heimatpflegeverbandes Südtirol<br />
sind größere bauliche Eingriffe sowohl<br />
am geschichtsträchtigen Burghügel der<br />
denkmalgeschützten Zenoburg, als auch<br />
im Bereich des Auwaldes der Lazag entschieden<br />
abzulehnen. Die Heimatpfleger<br />
unterstützen daher das Anliegen der Plattform<br />
Architektur Meran, die eine Überarbeitung<br />
des Tunnelprojektes fordert, um<br />
eine bessere landschaftliche Einbindung<br />
zu erzielen.<br />
Peter Ortner<br />
30<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Heimatplege<br />
Gefährdetes Habitat<br />
Einwand zum Änderungsvorschlag<br />
betreffend Abänderung der Grenze des "Naturparks Drei Zinnen"<br />
Der Heimatpflegeverband Südtirol spricht<br />
sich aus diversen unten angeführten Gründen<br />
gegen die geplante Änderung der Grenze<br />
des „Naturparks Drei Zinnen“aus.<br />
Die Abänderung des Natura-2000-Gebietes<br />
– wenn auch am Rande des Naturparks<br />
– bringt in der geplanten Fassung<br />
große Änderungen mit sich und ist<br />
dem Habitat nicht zuzumuten. Der bestehende<br />
Skiweg ist bereits eine Belastung<br />
für den Naturpark. Durch die geplante<br />
Änderung würde sicherlich die Belastung<br />
in Zahl und Qualität zunehmen, was nicht<br />
im Sinne eines Natura-2000-Gebietes ist.<br />
Die zum „Tausch“ angebotene Fläche, obwohl<br />
unberührt, befindet sich in unmittelbarer<br />
Nähe einer bestehenden Skipiste<br />
und ist dadurch nicht geeignet, als Ausgleichsfläche<br />
dem Habitat-Gebiet gerecht<br />
zu werden, weil diese Fläche als „vorbelastet“<br />
anzusehen ist. Die geplante Mittelspannungsleitung<br />
könnte unterirdisch verlegt<br />
werden, was dem Habitat nur Vorteile<br />
bringen würde. Der Heimatpflegeverband<br />
Südtirol spricht sich aus den oben genannten<br />
Gründen vehement gegen eine Änderung<br />
der Naturparkgrenzen aus und ersucht<br />
die Verantwortlichen der Gemeinde<br />
Sexten und ganz besonders die Entscheidungsträger<br />
der Naturparkverwaltung, sich<br />
für die Beibehaltung der bestehenden Naturparkgrenzen<br />
einzusetzen.<br />
Peter Ortner<br />
Naturpark rund um die Drei Zinnen<br />
<strong>KulturFenster</strong><br />
Blasmusik, Chorwesen und Heimatplege in Südtirol<br />
Redaktion <strong>KulturFenster</strong><br />
Richtigstellung<br />
In der letzten Ausgabe des Kulturfensters wurde zusammen mit dem Bericht über<br />
den Fachbeirat für Baukultur ein falsches Foto von Architekt Bernhard Lösch veröffentlicht.<br />
Die Redaktion bittet für dieses Versehen um Entschuldigung und möchte<br />
mit dem beigefügten – nun richtigen – Lichtbild den Fauxpas korrigieren.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 31
Informiert & Relektiert<br />
Wie gehen wir mit der Natur<br />
respektvoll um<br />
"Die Erde ist unsere Mutter, sie nährt uns; was wir in sie hineinlegen,<br />
gibt sie uns zurück." Indianisches Sprichwort<br />
Die Pusteblume – der Löwenzahn ist im<br />
Frühjahr leicht zu finden und eignet sich<br />
hervorragend als Salat.<br />
Da es in den letzten Jahren immer stärker<br />
in Mode gekommen ist, Kräuter, Heilkräuter<br />
und Wildgemüse selbst zu sammeln, möchte<br />
ich in diesem Beitrag über unseren Umgang<br />
mit und in der Natur schreiben. Ich weiß,<br />
es werden Kurse über dieses Thema an allen<br />
Ecken und Enden angeboten. Die Literatur<br />
boomt. Wer nicht mindestens eine Kräuterzeitung<br />
im Abo hat, kann nicht mitreden.<br />
Es steht ja auch viel Interessantes drinnen.<br />
Mit Bedacht verwenden<br />
Ich selbst stamme aus einer Familie, in<br />
der altes Wissen über die Heilwirkung von<br />
Pflanzen tief verwurzelt ist. Als ich jung war<br />
und die Krankenpflegeschule besuchte,<br />
war das alles bei mir verpönt. Ich habe<br />
der Pharmaindustrie voll und blind vertraut.<br />
Mit den Jahren habe ich aber das<br />
Ganze immer mehr hinterfragt. Es gibt sicher<br />
Medikamente, die ihre Berechtigung<br />
haben, aber es gibt auch viele andere. Man<br />
schaue sich nur einmal die Werbung an.<br />
Für mich gilt: Je lauter etwas beworben<br />
wird, umso besser sollte man aufpassen.<br />
Wildkräuter und –gemüse<br />
auf dem Speiseplan<br />
Deswegen gehört jetzt meine ganze Zuwendung<br />
den Heilkräutern. Es ist eine wunderschöne<br />
Aufgabe! Damit eröffnen sich<br />
einfach ganz andere Perspektiven. Man<br />
hört immer wieder, dass gerade das Wildgemüse<br />
oft bitter schmeckt und die Familie<br />
nicht mitmacht. Da muss man manchmal<br />
halt z.B. den Löwenzahn oder den Giersch<br />
ganz klein in den Salat oder die Suppe hacken,<br />
sie sozusagen „unterjubeln“. Unsere<br />
Verdauung bedankt sich. Bitterstoffe sind<br />
Streicheleinheiten für Leber und Bauchspeicheldrüse.<br />
Wir haben sie wirklich „bitter<br />
nötig“! Durch die Züchtungen sind nämlich<br />
immer mehr Bitterstoffe aus unserer<br />
Ernährung verschwunden.<br />
Sammeln – aber wie?<br />
Was und wo man sammeln sollte, wissen<br />
ja die meisten, aber beim „Wie“ hapert<br />
es manchmal arg. Das Wichtigste ist,<br />
glaube ich, dass, wer sich in den Gärten<br />
des Schöpfers bewegt, wirklich die Achtsamkeit<br />
walten lässt. Sammeln heißt nicht<br />
ernten! Man sollte nur soviel nehmen wie<br />
man braucht (ihr werdet es nicht glauben,<br />
aber es ist viel weniger als man meint).<br />
Kräuter, die im nächsten Frühjahr noch<br />
übrig sind, kann man sehr gut als schöne<br />
Dekoration noch in Gläser füllen. Aus Holunderblüten<br />
oder Schafgarbe kann man<br />
z.B. noch einen guten Sirup herstellen.<br />
Keine Spuren hinterlassen<br />
Mir haben Bauern erzählt, dass sie im<br />
Frühjahr beizeiten Jauche ausbringen<br />
müssen, um die Schlüsselblumensammler<br />
davon abzuhalten, ihre Wiesen zu zertrampeln.<br />
Das darf nicht sein! Jetzt, wo<br />
die Zeit kommt, Wurzeln auszugraben,<br />
sollte man keinen „Golfplatz“ zurücklassen.<br />
Echte Kräutersammler hinterlassen<br />
keine Spuren!<br />
Natur Natur sein lassen<br />
Ich möchte noch eine kurze Geschichte<br />
frei nacherzählen, die ich einmal gehört<br />
habe: Da ging ein Mann mit einer Rosskastanie<br />
zu einem Chemiker und beauftragte<br />
ihn, sie „nachzubauen“ mit allen Inhaltsstoffen.<br />
Der Chemiker nahm die Herausforderung<br />
an und übergab schließlich die<br />
„künstliche“ Rosskastanie dem Mann. Der<br />
nahm sie und setzte sie neben der echten<br />
in die Erde. Er hegte und pflegte beide<br />
gleich. Nach einer Woche keimte die echte<br />
Rosskastanie, die andere war zerfallen. Da<br />
eben wirkt das Quäntchen Göttlichkeit, das<br />
es braucht, um etwas wachsen zu lassen<br />
und wo der Mensch, Gott sei Dank, nicht<br />
dreinpfuschen kann.<br />
Helene Ambach-Eller<br />
Sammeln heißt nicht zertrampeln<br />
32<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Aus Verband und Bezirken<br />
Heimatplege<br />
Terrassenbau für Steinegg<br />
Lokalaugenschein der Verbandsspitze mit Bauleitung und Gemeindevertretern<br />
Die Luftaufnahme zeigt das langgezogene Dorf Steinegg mit dem für das Wohnprojekt<br />
ausgewiesenen Areal.<br />
Durchsicht der Baupläne: v.l.<br />
Architekt Matthias Vieider, Obmann<br />
des Heimatpflege verbandes Peter<br />
Ortner, Gemeindereferent Rudolf<br />
Lantschner, Bauherr Martin Resch und<br />
Verbandsgeschäftsführer Josef Oberhofer<br />
In einem Gebiet, das wie die Gemeinde<br />
Karneid zu 97 Prozent von Steillagen geprägt<br />
ist, führt die Suche nach geeigneten<br />
Baugründen unweigerlich zu Diskussionen<br />
und letztendlich zu Kompromissen. Neben<br />
der bürokratischen Wegbereitung muss demzufolge<br />
auch um die Zustimmung und Akzeptenz<br />
der Bevölkerung, vornehmlich der Anrainer,<br />
gebuhlt werden. Eine weitere Hürde hin<br />
zur Umsetzung wurde Ende Juni mit einem<br />
positiven Gutachten seitens des Heimatpflegeverbandes<br />
genommen.<br />
Im Zuge der Vertragsurbanistik der Gemeinde<br />
soll ein Areal nahe dem Ortskern<br />
als Erweiterungszone mit einem beachtlichen<br />
Kubaturrahmen deklariert werden.<br />
Dort soll nun ein Wohnkomplex mit etwa<br />
20 Einheiten unterschiedlicher Größe entstehen.<br />
Bis dato ist die Ortschaft vorwiegend<br />
von Ein- und Mehrfamilienhäusern<br />
im ländlichen Stil geprägt, nachvollziehbar<br />
also, wenn sich angesichts des modernen<br />
Konzeptes auch kritische Stimmen zu<br />
Wort melden, vor allem jene einiger Anrainer,<br />
die ihre Wohn- und Lebensqualität bedroht<br />
sehen. Hinzu kommt die Sorge, wen<br />
dieses Angebot letzten Endes nach Steinegg<br />
locken wird.<br />
Für und Wider<br />
Das Wohnhaus soll entlang der Hauptstraße<br />
am südlich abfallenden Hang des sogenannten<br />
„Pstosser Bühls“ errichtet werden,<br />
wenige Gehminuten vom Dorfzentrum<br />
mit sämtlichen Infrastrukturen entfernt. Für<br />
die Interessenten ist dies offenkundig ein<br />
nicht von der Hand zu weisender Vorteil,<br />
auch die Gemeindeverwaltung befürwortet<br />
Lage und daran geknüpftes Vorhaben, seien<br />
doch, laut Aussage des Bürgermeisters, Albin<br />
Kofler, sämtliche Wohnbauzonen im Dorfgebiet<br />
bereits erschöpft. Zudem seien in diesem<br />
Falle keine Erschließung und die Erhebung<br />
zusätzlicher Kosten notwendig. Dem entgegen<br />
handelt es sich bei besagtem Waldstück<br />
um eine gern besuchte Naherholungszone<br />
mit identitätsstiftendem Charakter.<br />
Feingefühl bei der Planung<br />
Diesem Umstand sei mit äußerstem Feingefühl<br />
begegnet worden, so Architekt und<br />
Bauherr, beides ortsansässige Fachleute. Es<br />
gelte, mit einem entsprechenden Konzept die<br />
Attraktivität des Landschaftsbildes zu erhalten<br />
und den öffentlichen Raum zu respektieren.<br />
Entstehen soll folglich ein großflächig<br />
begrünter Terrassenbau, welcher sich stufenförmig<br />
an den Hang reiht. Aufgrund dieser<br />
Bauweise fällt nur ein schmaler Waldstreifen<br />
der Säge zum Opfer; die dahinter<br />
liegende Hügelkuppe bleibt zur Gänze erhalten<br />
und einsehbar. Laut Peter Ortner, Obmann<br />
des Heimatpflegeverbandes Südtirol,<br />
haben sich Architekt und Bauherr sehr darum<br />
bemüht, in Steinegg ein Wohnobjekt<br />
zu erstellen, das sich gut in die Landschaft<br />
und in die unmittelbare Umgebung einfügt.<br />
Durch den Terrassenbau sind keine größeren<br />
Materialbewegungen erforderlich. Die geplante<br />
Wohnbauzone liegt in der Nähe des<br />
Dorfzentrums und ist daher mit allen Infrastrukturen,<br />
einschließlich Zufahrt, ausgestattet.<br />
Das Gebiet am Südabhang des „Pstosser<br />
Bühls“ ist bereits heute ein beliebtes und<br />
von der Bevölkerung viel aufgesuchtes Naherholungsgebiet.<br />
Diese und andere Kriterien<br />
sind ausschlaggebend für ein positives Gutachten<br />
seitens des Heimatpflegeverbandes.<br />
Bürgernähe zeigen<br />
Im Rahmen einer Bürgerversammlung<br />
wurden sämtliche relevanten Informationen<br />
an die Bevölkerung weitergegeben.<br />
Gemeinde, vornehmlich Ausschuss und<br />
Baukommission, befürworten aus oben genannten<br />
Gründen das Großprojekt. Bislang<br />
halten sich die kritischen Einwände in Grenzen,<br />
so der Bürgermeister Albin Kofler und<br />
der Bauherr Martin Resch, die Wirtschaftlichkeit<br />
des Bauwerkes sei unbestreitbar.<br />
Die Konventionierung aller Wohneinheiten<br />
sowie die Möglichkeit, Vorstellungen gemäß<br />
persönlicher Bedürfnisse und dem verfügbaren<br />
Kreditrahmen einzubringen, kommen<br />
auch jungen Bauherren zugute. Allem<br />
und jedem könne man nie gerecht werden,<br />
so Martin Resch, aber man müsse ein offenes<br />
Ohr für Klagen und Einwände haben<br />
und mit entsprechenden Maßnahmen reagieren.<br />
Nur auf diese Weise könne die Realisierung<br />
angepeilt werden.<br />
Sylvia Rottensteiner<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 33
Aus Verband und Bezirken<br />
Sichtbare Geschichte<br />
Einweihung des restaurierten Elektrizitätswerkes mit Turbine<br />
der ehemaligen Brauerei in Vilpian<br />
verlor die Bierbrauerei langsam ihre Bedeutung.<br />
1924 fusionierte die Brauerei Vilpian<br />
mit jener von Blumau.<br />
Geschichte zum Bestaunen<br />
und zum Anfassen<br />
Die Segnung der Turbine am 14. September <strong>2014</strong><br />
Auch das geschriebene Wort überdauert<br />
die Zeit und hält Erinnerungen wach.<br />
Doch wie viel intensiver mag das Erleben<br />
von Geschichte über andere Sinneskanäle<br />
ausfallen. In Vilpian steht seit dem 14. September,<br />
dem Tag der Einweihung, das an<br />
die Brauerei angeschlossene Elektrizitätswerk<br />
samt massiver Pelton Turbine dem<br />
Publikum offen. Ein Stück Geschichte eines<br />
Dorfes und vieler Generationen!<br />
Irmgard Mitterer, zusammengestellt<br />
von Sylvia Rottensteiner<br />
Ein einmaliges Denkmal historischer Ingenieurbaukunst<br />
kehrt nach erfolgreicher<br />
Restaurierung durch Heinrich Erschbamer<br />
wieder an seinen ursprünglichen Einsatzort<br />
zurück und kann dort jederzeit besichtigt<br />
werden.<br />
Historischer Hintergrund<br />
Die Entstehung und Entwicklung des<br />
Brauereiwesens im südlichen Tirol des 19.<br />
Jahrhunderts steht in engem Zusammenhang<br />
mit der aus Hohenems in Vorarlberg<br />
stammenden jüdischen Familie Schwarz.<br />
Ernst Schwarz und seine Brüder Wilhelm,<br />
Moritz und Jakob unternahmen in Tirol<br />
weitreichende Aktivitäten. Sie pachteten<br />
das Bräuhaus in Gossensaß und das Carlische<br />
Brauhaus in Gries, die sogenannte<br />
Klösterle-Brauerei. 1849 gründeten sie die<br />
Dampfbierbrauerei in Vilpian. Die Familie<br />
Schwarz erwarb die Wiese am Kaltkelleranwesen<br />
und ließ darauf die Brauerei errichten.<br />
Betrieben wurde sie von Jakob<br />
Schwarz als gelerntem Bierbrauer. Ab 1863<br />
übernahm Wilhelm die Brauerei. Gebraut<br />
wurde nach "Münchnerart" das sogenannte<br />
Porter-Bier, das aus dem englischen Raum<br />
stammte. Zur Eröffnung der Bozen-Meran-<br />
Lokalbahn am 4. <strong>Oktober</strong> 1881 wurde am<br />
Bahnhof in Vilpian Bier aus der Bierbrauerei<br />
der Gebrüder Schwarz ausgeschenkt.<br />
Die Vilpianer Brauerei gehörte zu den<br />
größten in Südtirol, besaß eine eigene Mühle<br />
und wurde 1897 mit einem Elektrizitätswerk<br />
ausgestattet. Die Familie Schwarz gehörte<br />
zu den Pionieren auf dem Gebiet der<br />
technischen Erneuerung. Besonders technikbegeistert<br />
war Sigismund, einer der beiden<br />
Söhne von Ernst Schwarz. Sigismund<br />
wurde 1849 in Hohenems geboren und<br />
war später in Bozen ansässig, wo er 1919<br />
verstarb. Das Elektrizitätswerk wurde nach<br />
dem neuesten Stand der Technik mit einer<br />
Turbine der Marke Pelton errichtet. Sigismund<br />
Schwarz war auch einer der wichtigsten<br />
Promotoren des Lokalbahnbaues<br />
in Südtirol.<br />
1915 wurde die Bierbrauerei von den<br />
Brüdern Arnold und Sigismund Schwarz<br />
in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
(GmbH) umgewandelt. Mit dem Beginn<br />
des ersten Weltkrieges und nach dem<br />
Tod von Sigismund Schwarz im Jahr 1919<br />
Die nach dem amerikanischen Ingenieur<br />
Lester Pelton benannte Turbine<br />
entsprach Ende des 19. Jahrhunderts<br />
höchsten technischen Standards.<br />
34<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Ins Bild gerückt<br />
Heimatplege<br />
Kultur – Architektur – Literatur<br />
Heimatschutzverein Meran setzt markante Schwerpunkte<br />
Hätte Franz Innerhofer damals nicht<br />
überzeugen können, wäre das Vinschger<br />
Tor schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts<br />
geschliffen worden und hätte das<br />
Schicksal mit dem Ultner Tor geteilt. Im<br />
Laufe der vergangenen über 100 Jahre<br />
konnten zahlreiche Vorhaben und Entscheidungen<br />
des Heimatschutzvereines<br />
auf Umwelt und Stadtbild Einfluss nehmen.<br />
Beispielsweise wurde 1927 erfolgreich<br />
die Errichtung eines Stauwerkes in<br />
der Gilf verhindert; wie anders hätte die<br />
Zukunft Merans wohl ausgesehen, wäre<br />
dieses Vorhaben nicht geglückt? Auf der<br />
anderen Seite steht die Erhaltung: Das Hotel<br />
Merano, das Hotel Minerva, das Amorthaus,<br />
der Freihof, der Mendelhof und die<br />
Villa Bristol in der Freiheitsstraße zählen<br />
zu den Stationen erfolgreichen Einsatzes<br />
der jüngeren Zeit. Josef Vieider, Obmann<br />
des Heimatschutzvereins Meran seit 1995,<br />
bedauerte im Gespräch, dass dieses Engagement<br />
unweigerlich auch zu Interessenskonflikten<br />
führt. Bislang habe die<br />
sachliche und argumentative Vorgangsweise<br />
wenn nicht zur Zufriedenheit aller,<br />
doch aber zu Kompromissen geführt.<br />
Diskussionsbereitschaft und Beharrlichkeit<br />
zählen zum Beispiel in Bezug auf den<br />
seit über fünf Jahren im Bauleitplan verankerten<br />
Ensembleschutz zu unumgänglichen<br />
Tugenden.<br />
Gegenwärtiges<br />
Luftaufnahme von Meran<br />
Heimat nicht nur erhalten, sondern Heimat<br />
auch aktiv schaffen, Bestehendem und<br />
Neuem offen, aber auch mit kritischem<br />
Auge begegnen, so der Leitspruch der Meraner<br />
Heimatschützer. Mit diesem Grundsatz<br />
und zahlreichen in diesem Sinne gesetzten<br />
Maßnahmen erfüllt der Verein für<br />
die Kurstadt und deren Umwelt eine unverzichtbare<br />
Funktion.<br />
Historisches<br />
Der Heimatschutzverein Meran ist landesweit<br />
der älteste Verein im Verband.<br />
Seine Gründung im Jahre 1908 war vor<br />
allem der im 19. Jahrhundert beginnenden<br />
Bauwut geschuldet, die Meran – einem<br />
Phönix gleich – vom verschlafenen Bezirksstädchen<br />
zum mondänen Kurort erhob.<br />
Die wiederholten schweren Eingriffe in<br />
das Landschafts- und Stadtbild erzeugten<br />
Widerstand, denn nicht alle verdienten ihren<br />
Obolus mit dem Aufschwung, nicht alle<br />
Meraner waren dem blinden Fortschrittsglauben<br />
unterlegen. So bildete sich um<br />
den Arzt Franz Innerhofer eine Gruppe<br />
Gleichgesinnter und gründete den ersten<br />
Heimatschutzverein im damals noch geeinten<br />
Tirol. „Der Verein für Heimatschutz<br />
mit Sitz in Meran hat den Zweck, die Eigenheit<br />
unserer Heimat zu schützen und<br />
zu pflegen“, lautete die immer noch gültige<br />
Satzung.<br />
„Mittlerweile ist die globalisierte Welt<br />
zur übersichtlichen Heimat geworden.<br />
Wir sehen es als unsere Pflicht<br />
an, unser kleines Mosaikteilchen Heimat<br />
mitzugestalten und damit unseren<br />
Beitrag zum Gesamtbild zu leisten.“<br />
Josef Vieider<br />
Erfolgreiches<br />
Der mir vorliegende Tätigkeitsbericht<br />
gibt Punkt für Punkt Aufschluss über die<br />
rührige Teilnahme an der Stadtentwicklung.<br />
Dabei fallen vor allem Interesse an<br />
den Belangen der Stadtverwaltung und<br />
Einblick in diverse Sachverhalte auf. Darauf<br />
wird im Ausschuss vorwiegend mit<br />
souveränem Weitblick reagiert: Eventualitäten<br />
werden ein- und mögliche Reaktionen<br />
werden geplant. Dies zu gewährleisten ist<br />
möglich aufgrund der heterogenen Zusammensetzung<br />
des 15-köpfigen Vereinsvorstandes,<br />
der mit qualifizierten Fachleuten<br />
nahezu alle Bereiche, mit denen sich der<br />
Heimatschutz auseinandersetzt, abdeckt.<br />
Zur Diskussion stehen derzeit beispielsweise<br />
das Museum im Palais Mamming,<br />
die Grünflächen vor der Landesfürstlichen<br />
Burg oder die geplante Umgestaltung des<br />
Theaterplatzes.<br />
Literarisches<br />
Wissenschaftlich und literarisch hinterfragt<br />
wurde der Heimatbegriff anlässlich der<br />
90-Jahr-Feier. Namhafte Größen wie der<br />
Literaturhistoriker Max Siller von der Universität<br />
Innsbruck oder der Autor Joseph<br />
Zoderer näherten sich auf unterschiedliche<br />
Weise der Bedeutung des Wortes. Etymologisch<br />
stelle das Wort, so Siller, keine Probleme<br />
dar, Erklärungsbedarf stelle sich bei<br />
der Frage nach der Bedeutung ein. Mit<br />
einem Streifzug von der Literatur der Antike<br />
bis zu neueren salbungsvollen Versen<br />
erläutert der Historiker jenes Ungesagte,<br />
das bei jeder Nennung des Wortes Heimat<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 35
Ins Bild gerückt<br />
Die Landesfürstliche Burg Meran<br />
unwillkürlich mitschwingt: Iphigenie sucht<br />
es mit der Seele, Elend verspürt jeder, der<br />
es verliert und wer es findet, dem wird’s<br />
im Herzen warm. Heimat ist so vieles, für<br />
jeden etwas anderes, dass die Bedeutung<br />
unmöglich auf ein Wort reduziert werden<br />
kann, darum reflektierte Joseph Zoderer<br />
mit Prosa und Lyrik.<br />
„Ich weiß, dass Heimat für viele so etwas<br />
wie Nest bedeutet, also Sicherheit,<br />
Ruhe, Gewohnheit, vor allem aber<br />
dieses: Vertrautheit […]. In diesem<br />
gewachsenen Konsens ist jedoch oft<br />
Abwehr, ja Aggressivität enthalten gegen<br />
alles Neue, Fremde, auch Angst<br />
und Ohnmacht […].“<br />
Joseph Zoderer<br />
Umfassendes<br />
Sommerpromenade in der Gilf:<br />
Symbiose von Kultur und Natur<br />
(Foto: Daniel Vicentin)<br />
Zoderer nimmt es vorweg: Heimat und<br />
der Schutz der Heimat kann, nein darf<br />
nicht in kleinstrukturierten Dingen und Vorstellungen<br />
enden. Der Begriff ist dehnbar<br />
und soll durchaus weiter gefasst werden.<br />
So erschöpft sich Heimatschutz nicht nur<br />
in der Erhaltung gewachsener Baukultur,<br />
sondern setzt sich fort in zeitgemäßer Architektur.<br />
„Schule des Auges“ nennt Obmann<br />
Josef Vieider diese Sensibilisierung<br />
für das Neue, Fremde, oft auch Angst-Machende.<br />
Kulturreisen und Besuche im Meraner<br />
Kunsthaus sind nur einige seiner bildungsorientierten<br />
Maßnahmen. Tod und<br />
Geburt, Abriss und Aufbau drehen den<br />
Zeiger der Erdgeschichte. Dass nicht alles<br />
Bestand haben kann, gehört ebenso<br />
zum Selbstverständnis wie die Verpflichtung,<br />
jenes mit Respekt zu behandeln,<br />
was unsere Zeit überdauern kann. Unter<br />
Der Theaterplatz Meran<br />
diesem Grundsatz stand und steht ein Teil<br />
der publizistischen Initiative des Vereins:<br />
Der „Abriss“-Kalender erzählt von Verschwundenem,<br />
der in Planung begriffene<br />
„Aufbau“-Kalender will den Verlust wieder<br />
wettmachen und listet eine Fülle von wertvollen<br />
Gebäuden auf, die bewahrt, saniert<br />
und in die Zukunft gerettet wurden. Dabei<br />
wird auch vor historisch dunklen Epochen<br />
wie dem Faschismus nicht Halt gemacht,<br />
waren sie doch genauso prägend<br />
für die Entwicklung von Land und Gesellschaft<br />
wie freudvollere Tage.<br />
Zukunftsweisendes<br />
1993 wurde durch die Architektin Anntraud<br />
Torggler eine Initiative ins Leben gerufen<br />
mit dem hoffnungsvollen Wunsch<br />
„Gemeinsam planen wir Meran“, die vom<br />
Heimatschutzverein tatkräftig mitgetragen<br />
wurde. Es folgte eine ganze Reihe von Treffen<br />
und Veranstaltungen, darunter Begehungen<br />
zu Fuß oder mit dem Rad. Im<br />
Jahre 1998 schließlich wurde ein Prioritäten-Forderungskatalog<br />
des umfassenden<br />
Projektes mit Bürgerbeteiligung vorgelegt,<br />
um die Übernahme in den Bauleitplan zu<br />
erwirken. Aufgenommen wurde bis heute<br />
nur ein Teil des erarbeiteten Landschaftsleitplans,<br />
weitere Vorschläge harren noch<br />
ihrer Ausführung. Möge der Wunsch der<br />
Bevölkerung aber weiterhin Anregung<br />
sein, die Grundgedanken nicht zu vergessen.<br />
Papier ist geduldig, heißt es, und der<br />
Heimatschutzverein Meran wacht mit erhobenem<br />
Zeigefinger darüber, dass Flair<br />
und Charme der „mediterranen Alpenstadt“<br />
gewahrt werden.<br />
Sylvia Rottensteiner<br />
36<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Heimatplege<br />
Beispiel aus dem Tagesgeschäft<br />
Stellungnahme des Heimatschutzvereins Meran<br />
zur geplanten Bushaltestelle am Marconipark<br />
An dieser Stelle des Marconiparkes soll die neue Bushaltestelle errichtet werden.<br />
Am 13. November 2013 wurde die obere<br />
Freiheitsstraße in Meran von der Stadtverwaltung<br />
zur Fußgängerzone erklärt und für<br />
den motorisierten Verkehr gesperrt. Dabei<br />
erzeugte bei der betroffenen Bevölkerung<br />
besonders die improvisierte Verlegung der<br />
Bushaltestellen aus dem Stadtzentrum Probleme<br />
und rief verschiedene Protestaktionen<br />
wie zum Beispiel eine Unterschriftensammlung<br />
hervor.<br />
Asphalt statt Grünläche<br />
Die Stadtverwaltung beabsichtigt nun<br />
mittels Bauleitplanänderung an der unteren<br />
Cavourstraße, knapp oberhalb der<br />
denkmalgeschützten Heiliggeistkirche,<br />
eine neue Bushaltestelle einzurichten. Dafür<br />
soll ein 48 Meter langer Grünstreifen<br />
des ensemblegeschützten Marconiparks in<br />
eine Bushaltebucht umgewandelt werden.<br />
Der Heimatschutzverein hält eine Bushaltestelle<br />
an diesem Ort angesichts der<br />
Entfernung von den Fußgängerzentren für<br />
absolut sinnlos und daher unangebracht,<br />
zumal in nächster Nähe bereits 2 Haltestellen<br />
bestehen (Cavourstraße und Romstraße).<br />
Die Stadtverwaltung möge vielmehr<br />
ihr Vekehrskonzept so ausrichten,<br />
dass das Stadtzentrum funktionsgerecht<br />
mit öffentlichen Verkehrsmitteln bedient<br />
werden kann.<br />
Heimatschutzverein Meran<br />
steuert gegen<br />
Die geplante Verkleinerung des ensemblegeschützten<br />
Marconiparks wird vom<br />
Heimatschutzverein entschieden abgelehnt.<br />
Für die Kur- und Gartenstadt Meran<br />
haben der Schutz und die Weiterentwicklung<br />
der Parkanlagen und des Grünbestandes<br />
eine unverzichtbare Bedeutung.<br />
Umso unverständlicher erscheint die geplante<br />
Baumschlägerung und Verkleinerung<br />
eines Parks zu Gunsten eines fragwürdigen<br />
Verkehrskonzeptes.<br />
Josef Vieider für den<br />
Heimatschutzverein Meran<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 37
Rundschau<br />
Der nicht mehr gebrauchte Stall<br />
Der unter Denkmalschutz stehende Oberjufalhof<br />
in der Gemeinde Kastelbell-Tschars,<br />
Auch aus einem altehrwürdigen Ensemble<br />
oder einer alten Bausubstanz kann mit<br />
entsprechendes Objekt geschaffen werden;<br />
die Fotos von vorher und nachher unterstreichen<br />
oberhalb von Schloss Juval gelegen, wurde<br />
teilweise saniert. Im Vordergrund steht der<br />
Schafstall, dem das Innenleben samt meterhoher<br />
Mistansammlung entnommen und<br />
eine Wohnung einverleibt wurde. Im Hintergrund<br />
reckt sich der spätmittelalterliche,<br />
zweigeschossige Turm; der breite senkrechte<br />
Riss in der Außenmauer wurde fachmännisch<br />
geschlossen und ein neues Dach mit<br />
Schindeln aufgesetzt. Alles im allem handelt<br />
es sich um eine sehr gelungene Sanierung,<br />
Einfühlungsvermögen ein der heutigen Zeit<br />
dies.<br />
Franz Fliri<br />
auf jeden Fall nachahmenswert. vorher nachher (Fotos: Martin<br />
Ganner)<br />
Neuer Fahnenbrauch<br />
Früher wurden die Fahnen immer auf<br />
dem Söller montiert. Großteils wird das<br />
auch noch heute so praktiziert, doch einige<br />
Kreative haben neue Ideen gefunden:<br />
Man hängt die Tiroler Fahne einfach auf<br />
den Baukran, vielleicht als Sinnbild für die<br />
Verbauung des Landes, oder damit man<br />
von Weitem sieht, dass wir aufrechte Tiroler<br />
mit Herz und Hand sind.<br />
Michl Burger<br />
Erfolgreicher Beneiz-Heimatabend in Lana<br />
Sänger und Musikanten musizieren für einen guten Zweck<br />
Unter dem Motto „Musik, Gesang, Mundart<br />
und Tanz“ ging kürzlich − bereits zum<br />
12. Male − der traditionelle Benefiz-Heimatabend<br />
im Raiffeisenhaus über die Bühne.<br />
Alle Mitwirkenden stellten sich in den Dienst<br />
einer guten Sache.<br />
Der Erlös der Veranstaltung kam der<br />
„Stillen Hilfe im Dorf“ zugute, deren Verein<br />
es sich zur Aufgabe gemacht hat,<br />
notleidenden Menschen schnell und unbürokratisch<br />
zu helfen. Alle Sänger und<br />
Musikanten gaben ihr Bestes: die Jagdhornbläsergruppe<br />
Lana unter der Leitung<br />
von Norbert Breitenberger, der Burggräfler<br />
Viergesang unter der Leitung von Albert<br />
Seppi, die Zollweger Buabm mit Franz,<br />
Bernhard und Klaus Pfeifhofer, die „Dreisoatign“<br />
mit Walter Schönweger sowie Roswitha<br />
und Raimund Eisenstecken aus<br />
Ein buntes Stelldichein von Sänger und Musikanten auf der Bühne im Raiffeisenhaus<br />
von Lana (Foto Arthur Kofler)<br />
Vahrn, der Kapuzinerchor Lana, die Volkstanzgruppe<br />
Lana, Mundartdichterin Maria<br />
Sulzer und Sprecher Alfred Sagmeister. Mit<br />
dabei waren Luis Santer-Stadler, der Ideator<br />
dieser gemeinnützigen Veranstaltung,<br />
Rosa Pfattner vom Verein „Stille Hilfe im<br />
Dorf“ sowie die Gemeindereferenten Olav<br />
Lutz und Helmuth Holzner in Vertretung<br />
der Marktgemeinde Lana. Im Anschluss<br />
an dieses volksmusikalische Stelldichein<br />
kredenzte Sepp Pircher-Hofmann köstlichen<br />
Apfelsaft.<br />
38<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Arge Lebendige Tracht<br />
Heimatplege<br />
Silberne Edelweiß<br />
Anpezo Hayden lässt grüßen!<br />
„Die Tracht geht über die Jöcher“, heißt<br />
ein altes Sprichwort. Dies wird wohl auch<br />
der Grund dafür gewesen sein, dass die<br />
Edelweiß in Filigrantechnik aus dem benachbarten<br />
ladinischen Anpezo Hayden,<br />
wie Cortina d’Ampezzo zu altösterreichischer<br />
Zeit bis 1923 hieß, den Weg ins Gadertal<br />
gefunden haben. Heute noch zieren<br />
sie das Mieder der sogenannten „Manies<br />
blanches“, dieser einfachen, noblen Frauentracht<br />
mit den weißen Ärmeln.<br />
Was ist die Filigrana?<br />
Das Wort stammt aus dem Lateinischen<br />
„filum granum“, was so viel wie „körniger<br />
Faden“ heißt. Diese zarte Kunst der Edelmetallverarbeitung<br />
ist schon seit dem Altertum<br />
bekannt. Die Wiege vermutet man<br />
in Asien, von wo aus sie sich über den<br />
Orient im gesamten Mittelmeerraum verbreitet<br />
hat. Nach Anpezo brachten sie wohl<br />
schon im 18. Jahrhundert venezianische<br />
Goldschmiede. Vor allem in der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich<br />
Anpezo mit der Herstellung der Filigrana<br />
weit über die Grenzen hinaus einen Namen<br />
gemacht. Mit dem rasanten Ansteigen<br />
des Fremdenverkehrs um die Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts sah man zudem in<br />
der Herstellung von Souvenirs eine willkommene<br />
Einnahmequelle. Vor allem im<br />
Winter entstanden in Heimarbeit wunderschöne<br />
Stücke: Broschen, Haarnadeln,<br />
Schließen, kleine Döschen, Bilderrahmen<br />
und vor allem Blumen.<br />
Blumen als Vorlagen<br />
Die Anpezaner waren schon immer ein<br />
handwerklich begabtes Volk. Sie verfeinerten<br />
die Technik und erweiterten immer mehr<br />
die Produktpalette. Im Jahr 1874 wurde<br />
sogar in der bereits bestehenden Kunstschule<br />
im Ort eine eigene Sektion für Filigrantechnik<br />
eingerichtet. Die folgenden<br />
20 Jahre kann man wohl als die Hochblüte<br />
der Filigrana bezeichnen. Die Anpezaner<br />
überflügelten sogar die Venezianer,<br />
was die Feinheit der Arbeiten betraf. Als<br />
Feinste Filigrana auf Gadertaler Tracht<br />
Vorlage dienten vor allem die Blumen vor<br />
Ort, die man detailgetreu nachzuahmen<br />
versuchte: Lilien, Maiglöckchen, Anemonen,<br />
Christrosen, Orchideen und natürlich<br />
Edelweiß.<br />
Filigrantechnik<br />
Das Herstellen der hauchfeinen Silberfäden<br />
war Aufgabe der Männer. Eine Kunst<br />
für sich! Nur 0,08 mm betrug der Durchmesser<br />
eines Silberfadens – dünner als<br />
ein Haar. Selbst gezogen natürlich. Zwei<br />
davon wurden zusammengedreht, sodass<br />
diese typische perlenartige Struktur entstand.<br />
Mit ruhiger Hand, guten Augen und<br />
größter Geduld setzten dann die Frauen,<br />
aber auch Jugendliche, mit spitzen Pinzetten<br />
die Fäden zu kunstvollen Gebilden<br />
zusammen. Zeit spielte dabei keine Rolle.<br />
In Umrisse aus etwas dickerem Silberdraht<br />
wurden die hauchfeinen Silberfäden eingesetzt,<br />
äußerst vorsichtig verschmolzen<br />
und mittels eigener Holzformen in die gewünschte<br />
Form gebracht. Gelbe Teile wurden<br />
vergoldet.<br />
Verfall des Kunsthandwerks<br />
Familiennamen wie Verocai, Ghedina,<br />
Alverà, Dinai, um nur einige zu nennen,<br />
erinnern an die kurze goldene Zeit der Filigrana.<br />
Die Schließung der Kunstschule<br />
im Jahr 1894, mangelnde künstlerische<br />
Weiterentwicklung, der Erste Weltkrieg,<br />
vor allem aber private Geschäftsinteressen<br />
führten zu einem raschen Verfall des<br />
Kunsthandwerks.<br />
Als letzter seiner Zunft in Anpezo stellt<br />
heute noch Stefano Verocai in 4. Generation<br />
Filigranarbeiten her. Aus Leidenschaft,<br />
allerdings mit dickerem Silberfaden. Sonst<br />
wäre die Arbeit unbezahlbar. Die Gadertalerinnen<br />
tragen wahre Schätze auf ihren<br />
„Manies blanches“.<br />
Agnes Andergassen<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 39
Arge MundArt<br />
Mundartdichterinnen in Aldein<br />
Literarisches und musikalisches Treffen<br />
Gut ein Dutzend Mundartdichterinnen aus<br />
Südtirol mit Landesvorsitzendem Martin Achmüller<br />
an der Spitze trafen sich kürzlich im<br />
idyllischen Unterlandler Dorf Aldein zu einer<br />
literarischen Begegnung.<br />
Gemeinsam besuchten die Literaturbeflissenen<br />
die Grabstätte von Professor Alfred<br />
Gruber, ehemals Präsident, Pionier<br />
und großer Förderer der Arbeitsgemeinschaft<br />
MundART im Südtiroler Heimatpflegeverband.<br />
Anschließend begab sich die<br />
„schreibende Zunft“ – Margit von Elzenbaum,<br />
Anna Lanthaler, Klothilde Oberarzbacher,<br />
Elisabeth Oberhofer, Anna Steinacher,<br />
Maria Mutschlechner , Theresia<br />
Nischler, Rita Zuegg, Martha Sulzer, Edith<br />
Ruedl, Zita Mitterrutzner, Heidi Plunger<br />
und Johanna Gamper – in den nahe gelegenen,<br />
historischen Gasthof „Krone“. Unter<br />
malerischem Gewölbe wurden heitere<br />
und besinnliche Gedichte und Geschichten<br />
vorgetragen. Zwischendurch erklangen<br />
Lied und Jodlergesang – begleitet von Maria<br />
Sulzer an der Gitarre. Im <strong>Oktober</strong> gibt es<br />
für die Mundart-Schreibenden den nächsten<br />
wichtigen Termin: Sie treffen sich zur<br />
„Schreibwerkstatt“ mit dem namhaften<br />
Pusterer Autor Wolfgang Sebastian Baur.<br />
Maria Sulzer<br />
Südtiroler Mundart-Schreibende am<br />
Dorfbrunnen von Aldein. V.l. stehend: Zita<br />
Mitterutzner, Heidi Plunger, Martha Sulzer,<br />
Elisabeth Oberhofer, Anna Steinacher,<br />
Theresia Nischler, Klothilde Oberarzbacher,<br />
Anna Lanthaler, Maria Mutschlechner, Rita<br />
Zuegg und Maria Sulzer; vorne sitzend:<br />
Edith Ruedl, Johanna Gamper, Margit von<br />
Elzenbaum und Martin Achmüller<br />
• Büchertisch •<br />
Reinhold Stecher<br />
Alles hat seine Zeit<br />
Eine Fundgrube an Lebensweisheiten<br />
Neues Lesevergnügen für die unzähligen<br />
Stecher-Fans<br />
Immer wieder kommen im Nachlass des<br />
Innsbrucker Bischofs Reinhold Stecher<br />
kleinere und größere Kostbarkeiten aus<br />
der Feder des vielseitigen Lehrers und<br />
Seelsorgers zum Vorschein: Gedichte,<br />
Karikaturen und Bilder, Betrachtungen<br />
und Ansprachen, die in Summe deutlich<br />
machen: Der Geist des Evangeliums ist<br />
ein Elixier für alle Lebenslagen.<br />
Bischof Stecher hat in seiner Dissertation<br />
das biblische Weisheitsbuch Kohelet<br />
studiert und oft zitiert, in dem es heißt<br />
„Alles hat seine Zeit …“. Und diesen<br />
„Zeiten“ ordnet sein Freund und Nachlassverwalter<br />
Paul Ladurner die neuen<br />
Fundstücke zu: einer Zeit zum Lachen<br />
und einer Zeit zum Klagen, einer Zeit<br />
zum Nachdenken und einer Zeit zum<br />
Schmunzeln, einer Zeit zum Träumen,<br />
einer Zeit zum Wandern und einer Zeit<br />
zum Meditieren.<br />
Es ist bekannt, dass Bischof Stecher immer<br />
wieder offene Worte fand, wenn es<br />
darum ging, Irrwege oder Missstände in<br />
seiner Kirche zu benennen, etwa im Umgang<br />
mit Macht, bei der Rekrutierung von<br />
Führungskräften oder zum Thema Sexualität.<br />
Als kreativer Kopf brachte er – häufig<br />
in Karikaturen – Kritik und Lösungsvorschläge<br />
trefflich auf den Punkt. Diese<br />
teilweise auch scharfen Texte und Zeichnungen<br />
jetzt zu veröffentlichen, versteht<br />
Herausgeber Paul Ladurner als konstruktiven<br />
Beitrag zur Kirchenreform, um die<br />
sich Papst Franziskus bemüht. Mit dem<br />
Buch wird die Behindertenwohngemeinschaft<br />
„Arche Tirol“ unterstützt – ein Herzensanliegen<br />
Reinhold Stechers.<br />
Der Autor:<br />
Reinhold Stecher (1921–2013) war über<br />
dreißig Jahre in der Jugendseelsorge und<br />
als Religionspädagoge in seiner Heimatstadt<br />
Innsbruck tätig. Von 1981 bis 1997<br />
war er Bischof der Diözese Innsbruck und<br />
im Ruhestand erfolgreicher Autor, Zeichner<br />
und Maler. Er ist Träger zahlreicher<br />
Preise, u. a. Ökumenischer Predigtpreis<br />
2010 für sein Lebenswerk (Bonn). Jedes<br />
seiner Bücher – alle bei Tyrolia – ist<br />
zu einem Bestseller geworden.<br />
Texte, Bilder und Zeichnungen zum Lachen<br />
und Klagen, zum Träumen und Nachdenken.<br />
Aus dem Nachlass herausgegeben<br />
von Paul Ladurner. 160 Seiten,<br />
22 farb. und 49 sw. Abb.; Tyroliaverlag,<br />
Innsbruck/Wien, 19,95 Euro. Auch als<br />
E-Book erhältlich: 6,99 Euro.<br />
40<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Arge Volkstanz<br />
Heimatplege<br />
Volksmusik mit Niveau<br />
Hoangart auf Schloss Prösels<br />
Am 15. Juni <strong>2014</strong> war es wieder soweit –<br />
zum 29. Mal fand ein Hoangart auf Schloss<br />
Prösels statt, immer in der ersten Junihälfte<br />
und immer in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler<br />
Volksmusikkreis und dem Kuratorium<br />
Schloss Prösels.<br />
Von den 29 aktiven Jahren war es 17 Jahre<br />
lang Christine Rier, die den Volksmusikkreis<br />
vertrat, 12 Jahre lang war es der nunmehrige<br />
Obmann des SVMK Luis Rieder und von der<br />
Seite des Kuratoriums arbeitete die ganze<br />
Zeit der Kulturverantwortliche Reinhold Janek<br />
an der Organisation des Hoangarts mit<br />
– heuer allerdings zum letzten Mal, weil er<br />
nach 32 Jahren mit dem Jahr 2015 in den<br />
verdienten Ruhestand treten wird. Der Hoangart<br />
war immer ein großer Erfolg, wohl<br />
auch deshalb, weil die Veranstalter immer<br />
sehr darauf bedacht waren, echte und niveauvolle<br />
Volksmusik zu bieten.<br />
Buntes Allerlei<br />
Am 15. Juni wurde ab 15 Uhr gesungen,<br />
gespielt und getanzt und durch den Nachmittag<br />
begleitete wie schon seit vielen Jahren<br />
Nikolaus Köll. An verschiedenen Schauplätzen<br />
im Schloss spielten die Tanzlmusig Brun-<br />
eck, die Geigenmusik „Frisch g’strichn“ aus<br />
dem Pustertal und die Alphornbläser Tiers,<br />
die für die verhinderten „Stubenhocker“ aus<br />
Meran eingesprungen waren. Für den Gesang<br />
sorgten der Mädchendreigesang Haslach<br />
und der Kohlbründl Viergesang mit Peter<br />
Reitmeir an der Harfe. Die Sparte Volkstanz<br />
war durch die Volkstanzgruppe Sarntal glänzend<br />
abgedeckt. Die Stimmung der über 300<br />
Hoangart-Besucher war ausgezeichnet und<br />
man trennte sich mit dem beidseitigen Versprechen,<br />
den Termin im Jahr 2015 nicht<br />
zu versäumen.<br />
Christine Rier<br />
Tanzlmusig Bruneck<br />
Volkstanzgruppe Sarntal<br />
Kohlbründl Viergesang mit Peter Reitmeir an der Harfe<br />
Tierser Alphornbläser<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 41
Arge Volkstanz<br />
Bergmesse am Pfitscher Joch<br />
Tänzer und Tänzerinnen begaben sich auf das Pitscher Joch,<br />
um an der Messe teilzunehmen<br />
Am Sonntag, 7. September, war es wieder<br />
soweit: Am Pfitscher Joch fand die bereits<br />
zur Tradition gewordene Bergmesse der Arbeitsgemeinschaft<br />
Volkstanz statt.<br />
Nord- und Südtiroler Tänzer und Tänzerinnen<br />
feierten grenzübergreifend gemeinsam<br />
um 11.00 Uhr einen Wortgottesdienst.<br />
An die hundert Teilnehmer begaben sich<br />
trotz des ungünstigen Wetters auf das Pfitscher<br />
Joch, um an der Messe unter freiem<br />
Himmel teilzunehmen. Diakon Otto Ritsch<br />
aus Afers gestaltete würdevoll den Gottesdienst,<br />
welcher von den „Pflerer Gitschn“<br />
musikalisch mit Ziachorgl und Geigen feierlich<br />
umrahmt wurde.<br />
Monika Rottensteiner, Erste Vorsitzende<br />
der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol,<br />
freute sich sehr über die rege Teilnahme<br />
und Herr Kaspar Schreder, Vorsitzender<br />
der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz<br />
Tirol, betonte, dass es schon in früherer Zeit<br />
Brauch war, nach der Messe zum Tanz aufzuspielen.<br />
Und so wurde im Anschluss an<br />
die Messe auch fleißig getanzt; es wurden<br />
alte Kontakte neu aufgefrischt und dem<br />
ungemütlichen Wetter zum Trotz herrschte<br />
eine warme, freundschaftliche Stimmung.<br />
Bis in die Nachmittagsstunden wurde bei<br />
Musik und Tiroler Tänzen „gehoangortet.“<br />
Der Ursprung dieser Hl. Messe reicht<br />
bis in die 1980er Jahre zurück. Bei gemeinsamen<br />
Sitzungen zwischen Nordund<br />
Südtirol war diese Idee entstanden.<br />
Die Hl. Messe findet alle zwei Jahre am<br />
Pfitscher Joch statt.<br />
ARGE Volkstanz<br />
Die Teilnehmer bei der Hl. Messe<br />
Die Pflerer Gitschn<br />
Hereinspaziert<br />
• Kindertanzseminar – Teil von Modul 1<br />
am Samstag, 8. November <strong>2014</strong>, von 9 bis 16 Uhr im Vereinshaus Pfalzen. Weitere Infos im Büro der Arbeitsgemeinschaft<br />
Volkstanz – Tel. 0471-970555 oder info@arge-volkstanz.org<br />
• Landeskathrein-Tanzfest<br />
am Samstag, 15. November <strong>2014</strong>, im großen Saal des Meraner Kurhauses. Einlass ab 19 Uhr, Auftanz um<br />
20 Uhr. Zum Tanz spielt die „Laaser Böhmische“ und für die Pausengestaltung sorgen Volkstänzer aus dem<br />
Bezirk Eisacktal. Tracht oder festliche Kleidung erwünscht.<br />
Tischreservierungen und weitere Infos im Büro der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz – Tel. 0471-970555 oder<br />
info@arge-volkstanz.org<br />
• Volkstanz-Winterlehrgang<br />
von Freitag, 26. Dezember <strong>2014</strong>, bis Donnerstag, 1. Jänner 2015, im Haus der Familie/Lichtenstern am Ritten.<br />
Tanzen, Musizieren und Singen mit fachkundigen Referenten.<br />
Weitere Infos im Büro der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz – Tel. 0471-970555 oder info@arge-volkstanz.org<br />
42<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Vorweg<br />
Wohltat für Seele,<br />
Körper und Gemeinschaft<br />
Die Macht des Singens<br />
Erich Deltedesco<br />
Die Stimme gilt als ein Spiegelbild unserer<br />
Seele. Mit ihr reden, schreien, flüstern und<br />
krächzen wir. Unendlich viele Töne lassen<br />
sich ihr entlocken. Und manchmal, wenn<br />
wir singen, kann die Stimme andere Wesen<br />
verzaubern.<br />
So wie es Orpheus, der sagenhafte Sänger<br />
der Antike, konnte. In kaum einer anderen<br />
Erzählung wird die Macht des Singens<br />
so eindringlich beschworen wie im Mythos<br />
des Orpheus. Mit seiner Stimme und seiner<br />
Lyra konnte er Steine erweichen und<br />
Tiere zähmen, ja, er überwand sogar die<br />
Grenzen des Todes, als es ihm gelingt, in<br />
das Totenreich des Hades einzudringen.<br />
Aber Singen kann noch mehr als verzaubern.<br />
„Wer singt, lebt gesünder", ist<br />
Wolfram Seidner überzeugt, emeritierter<br />
Professor an der Klinik für Phoniatrie und<br />
Audiologie der Charité Berlin. Gesundheit<br />
wird von der Weltgesundheitsorganisation<br />
als „umfassendes geistiges, physisches und<br />
soziales Wohlbefinden“ definiert. Man weiß,<br />
dass aktives Singen dazu führt, dass Sängerinnen<br />
und Sänger sich deutlich besser<br />
fühlen, dass Singen in Gemeinschaft allgemein<br />
die Fähigkeiten als „soziales Wesen“<br />
steigert. Ganz ohne Worte rufen Musik<br />
und Gesang Gefühle hervor, verborgene<br />
Emotionen werden geweckt, Spannungen<br />
in Körper und Seele gelöst und verschüttete<br />
Kräfte wieder belebt.<br />
Wer singt, lebt gesünder<br />
Singen fördert also unser körperliches<br />
und seelisches Wohlbefinden. Bei vielen<br />
herausragenden Ereignissen an besonderen<br />
Orten unserer Heimat wie in der Eggentaler<br />
Schlucht, in den Gärten von Schloss<br />
Trauttmansdorff, in der Festung Franzensfeste<br />
oder auf Schloss Rodenegg haben<br />
viele hunderte, ja tausende Sängerinnen<br />
und Sänger in den letzten Monaten diese<br />
wichtige Botschaft wiederum wirkungsvoll<br />
verkündet, die Vielfalt und die Schönheit<br />
des Chorgesangs, sowie die Begeisterung<br />
für das Lied einem breiten Publikum nahegebracht.<br />
Dass Musik und Gesang unser<br />
Leben bereichern, wissen wir alle. Dass<br />
aber aktives Singen in einer Gemeinschaft<br />
unsere Lebensqualität in einem ganz besonderen<br />
Maße steigert und uns Geborgenheit<br />
und Heimat schenkt, das müssen<br />
wir uns und den anderen Menschen<br />
immer wieder bewusst machen. Solche<br />
Sängerfeste sind gerade in einer Zeit der<br />
Leistungslogik und der Vereinsamung der<br />
Menschen ein notwendiges Zeichen, eine<br />
gute Gelegenheit zu zeigen, dass Singen<br />
Freude bereitet, dass Chorgesang Gemeinschaft<br />
und Freundschaft bedeuten<br />
kann, dass Singen hilft unsere Persönlichkeit<br />
zu entfalten.<br />
Die Chorfeste, die in unserem Land mit<br />
so großem Erfolg veranstaltet werden, sind<br />
nicht überflüssiger „Luxus“, sondern geradezu<br />
notwendiger Bestandteil einer gelebten<br />
Kultur. Sie erinnern an Werte, die<br />
in einer Welt der Leistungslogik in Gefahr<br />
sind. Mögen die Chöre in unserem Land<br />
weiterhin Botschafter für die Freude des<br />
Singens sein!<br />
Erich Deltedesco<br />
Obmann des Südtiroler Chorverbandes<br />
Orpheus und Eurydice,<br />
Jean-Louis Ducis, 1826.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 43
Das Thema<br />
Singen fördert die<br />
Gehirn-Entwicklung<br />
Studien bestätigen immer wieder die große<br />
Bedeutung des Musikunterrichts<br />
Das Singen sollte auch in der Schule einen immer größeren Stellenwert bekommen, sind doch die Vorteile für die<br />
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder durch Studien immer wieder bestätigt worden.<br />
Das Gehirn ist ein komplexes System,<br />
das sich durch Lernen entwickelt. Die Bildung<br />
der Vernetzung im Gehirn bei Kindern<br />
- und auch Erwachsenen - kann also gefördert<br />
oder behindert werden. Längst hat die<br />
Pädagogik erkannt, dass es in der Schule<br />
nicht darauf ankommt, in die Kindergehirne<br />
möglichst viel Wissen zu „stopfen“, sondern<br />
dass es um Grundfertigkeiten geht, die jeder<br />
Mensch im Leben braucht, um sich zurechtzufinden.<br />
Um Grundfertigkeiten im Bereich<br />
des Denkens und Kombinierens, des Kreativen<br />
und des Umgangs mit sich selbst und<br />
mit anderen zu erlernen – und damit auch<br />
die Hirnentwicklung in diese Richtung zu<br />
lenken – brauchen die Kinder nicht Quantität,<br />
sondern Qualität. Das heißt nicht möglichst<br />
viele Informationen, sondern einen<br />
vertiefenden, persönlichen Umgang mit<br />
Informationen, schlussendlich eine Beziehung<br />
zum Gelernten, zu anderen Menschen.<br />
Diese Beziehungspflege erhöht auch die<br />
Beziehung der neuronalen Netzwerke, wie<br />
Prof. Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie<br />
in Göttingen, betont: „Indem Kinder<br />
gleichzeitig mit sich selbst, mit anderen<br />
Menschen und dem was sie umgibt, in<br />
Beziehung treten, stellen sie auch in ihrem<br />
Gehirn Beziehungen zwischen den dabei<br />
gleichzeitig aktivierten neuronalen Netzwerken<br />
her, erhöhen sie das Ausmaß der<br />
Konnektivität. Die Gelegenheiten, bei denen<br />
Kindern das gelingt, sind Sternstunden<br />
für Kindergehirne.“ Diese Sternstunden<br />
würden in einer von Effizienzdenken,<br />
Reizüberflutung, Verunsicherung und Anstrengung<br />
geprägten Lebenswelt leider immer<br />
seltener.<br />
Singen ist Kraftfutter<br />
für das Gehirn<br />
„Im gemeinsamen, unbekümmerten und<br />
nicht auf das Erreichen eines bestimmten<br />
Zieles ausgerichteten Singen erleben<br />
Kinder solche Sternstunden“. Singen sei<br />
Kraftfutter für das Gehirn, betont Hüther.<br />
Beim Singen werden im kindlichen Gehirn<br />
gleichzeitig sehr unterschiedliche<br />
Netzwerke aktiviert und miteinander verknüpft:<br />
Es komme beim Singen zu einer<br />
44<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Aus Verband und Bezirken<br />
Chorwesen<br />
Aktivierung emotionaler Zentren und einer<br />
gleichzeitigen positiven Bewertung der dadurch<br />
ausgelösten Gefühle. So werde das<br />
Singen mit einem befreienden emotionalen<br />
Zustand verkoppelt: „Singen macht das<br />
Herz frei“. Das gemeinsame, freie Singen<br />
führe auch zur Offenheit für die Gefühle<br />
und Äußerungen anderer. Die Erfahrung<br />
von „sozialer Resonanz“ ist nach<br />
Hüther eine der wichtigsten Ressourcen<br />
für die spätere Bereitschaft, gemeinsam<br />
mit anderen Menschen nach Lösungen<br />
für schwierige Probleme zu suchen. So ist<br />
auch das Sprichwort „wo man singt, das<br />
lass´ dich nieder, böse Menschen haben<br />
keine Lieder“ zu erklären. Gemeinsames<br />
Singen mit anderen aktiviere die Fähigkeit<br />
zur „Einstimmung“ auf die anderen und<br />
schaffe so eine emotional positiv besetzte<br />
Grundlage für den Erwerb sozialer Kompetenzen.<br />
Da das Singen am Anfang immer<br />
mit anderen und mit der dabei empfundenen<br />
positiven emotionalen Besetzung<br />
erfolgt, komme es zu einer sehr komplexen<br />
Kopplung, die später im Leben, auch beim<br />
Singen ganz allein für sich wieder wachgerufen<br />
wird. Beim Singen komme es individuell<br />
zu sehr komplexen Rückkopplungen<br />
zwischen erinnerten Mustern, etwa Melodie,<br />
Tempo, Takt, und dem zum Singen erforderlichen<br />
Aufbau sensomotorischer Muster,<br />
der Wahrnehmung und Korrektur der<br />
eigenen Stimme. Singen sei also ein ideales<br />
Training für Selbstreferenz, Selbstkontrolle,<br />
Selbststeuerung und Selbstkorrektur.<br />
Hüther weist auch darauf hin, dass Singen<br />
Integrationsprozesse, z.B.von Migranten<br />
und Behinderten, aber auch Wundheilung<br />
fördere, Generationen verbinde und<br />
den Spracherwerb erleichtere.<br />
Studie bestätigt: Musikschüler<br />
lernen leichter<br />
Dass Musik sich positiv auf die Entwicklung<br />
des kindlichen Gehirns und Sozialverhaltens<br />
auswirkt, bestätigte kürzlich auch eine<br />
Studie der Universitäten Heidelberg und<br />
Graz, bei der rund 150 Schüler mit und<br />
ohne Instrumentalunterricht über mehrere<br />
Jahre hinweg mit psychoakustischen Messungen,<br />
psychologischen Tests und Kreativitätstests<br />
sowie Kernspintomografie und<br />
Magnetenzephalografie untersucht wurden.<br />
Es zeigte sich, dass Kinder, die ein Instrument<br />
lernen, beim Zuhören, Lesen und<br />
Rechtschreiben Vorteile haben und sich<br />
selbst besser unter Kontrolle haben. Chorgesang<br />
bzw. das Lernen eines Instruments<br />
könnte so bei Hyperaktivität oder übersteigerter<br />
Impulsivität eingesetzt werden. Die<br />
Studie bestätigte auch, dass Kinder, die ein<br />
Instrument lernen, eine bessere Hörfähigkeit<br />
entwickeln und dass mit dem Musikunterricht<br />
eine Entwicklung der für Sprache<br />
und Hören zuständigen Gehirnareale<br />
einhergeht. Die Forscher stellten fest, dass<br />
bei musikalisch geübten Kindern die linke<br />
und rechte Gehirnrinde synchron auf akustische<br />
Reize wie Töne und Wörter reagieren.<br />
Bei untrainierten Kindern reagieren die<br />
Gehirnareale leicht zeitverschoben. Bei Kindern<br />
mit ADHS, also einem hyperaktiven<br />
Verhalten, das sich auf Sozial- und Lernverhalten<br />
negativ auswirken kann, reagieren<br />
die Hirnhälften markant zeitverschoben.<br />
Diese Entdeckung könnte erklären,<br />
warum ADHS oft mit einer Lese-Rechtschreibschwäche<br />
einhergeht.<br />
Aus diesen Überlegungen und Studien<br />
kann man also folgern, dass das Singen<br />
bzw. der praktische Instrumentalunterricht<br />
gerade als Korrektiv in einer Umgebung der<br />
Reizüberflutung eine immer größere Bedeutung<br />
bekommt, gerade auch um Störungen<br />
im Lern- und Sozialverhalten vorzubeugen<br />
bzw. um diese zu lindern.<br />
Südtiroler Chorverband und Verband der Kirchenchöre Südtirols<br />
Gemeinsame Ehrenurkunde<br />
Ab sofort können Chöre, die Mitglied beider Chorverbände sind, eine gemeinsame Ehrenurkunde beantragen.<br />
Die Ehrenurkunden werden von beiden Verbandsobleuten und vom zuständigen Pfarrer unterschrieben und werden in Gold (ab<br />
40 Jahre), in Silber (ab 25 Jahre) oder in Bronze (ab 10 Jahre Gesangstätigkeit) vergeben. Die gemeinsamen Ehrenurkunden<br />
können wahlweise beim Verband der Kirchenchöre Südtirols oder beim Südtiroler Chorverband beantragt werden.<br />
Es besteht keine Verpflichtung zur Verleihung der gemeinsamen Ehrenurkunden, sondern es ist ein Angebot der beiden Chorverbände,<br />
denn es können auch weiterhin, wie bisher, die eigenen Urkunden des jeweiligen Chorverbandes beantragt werden.<br />
Männerstimmen gesucht!<br />
Mixmelodium - Ritten<br />
Der Rittner Chorverein Mixmelodium sucht Männerstimmen: „Egal ob Tenor, Bariton oder Bass, ob jung oder junggeblieben - wir<br />
brauchen euch alle! Meldet euch bitte bei Chorleiterin Sandra unter Tel. 349 75 46 331!“ schreibt der Chorverein. Mixmelodium<br />
weist auch darauf hin, dass das Probelokal mit der Rittner Seilbahn von Bozen aus in 15 Minuten erreichbar ist<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 45
Aus Verband und Bezirken<br />
„Die alten Mauern zum<br />
Leben erweckt!“<br />
Bezirk Eisacktal-Wipptal: Chöre-Festival auf Schloss Rodenegg<br />
Der Kirchenchor Feldthurns<br />
„Die Mauern haben zu singen begonnen!“<br />
Mit diesen Worten drückte der Bürgermeister<br />
von Rodeneck Klaus Faller seine<br />
Freude über den Erfolg des Chöre-Festivals<br />
am Sonntag, 21. September, auf Burg Rodenegg<br />
aus, zu dem der Bezirk Eisacktal/<br />
Wipptal im Südtiroler Chorverband und im<br />
Verband der Kirchenchöre Südtirols geladen<br />
hatte. Eröffnet wurde das Chöre-Festival<br />
mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche<br />
von Rodeneck, der von P. Urban<br />
Stillhard zelebriert und von den Kirchenchören<br />
Mühlbach, Vals, Spinges und dem<br />
Vokalensemble „Gaudium“ sowie an der<br />
Orgel von Klaus Kohlhaupt und Armin Mitterer<br />
musikalisch mitgestaltet wurde. Ab<br />
11 Uhr bevölkerten dann Hunderte Sänger<br />
und Freunde der Chormusik die Schlossanlage,<br />
wo sie von Bezirksobmann Gottfried<br />
Gläserer und einem Bläserquartett<br />
festlich begrüßt wurden. 17 Chöre aus<br />
dem ganzen Eisack- und Wipptal sangen<br />
an stimmungsvollen Orten der Burg, so im<br />
Schlossgarten, im Hochzeitssaal oder im<br />
Schlosshof. Die Chöre stellten sich kurz<br />
vor und so erfuhren die interessierten Besucher<br />
auch einiges über das Chorleben<br />
im Bezirk, etwa dass viele Chöre auf eine<br />
mehrhundertjährige Geschichte zurückblicken<br />
können, dass sie mehr oder weniger<br />
jung im Durchschnittsalter sind oder wie<br />
oft sie im Jahr auftreten.<br />
Den Reigen begann der Kirchenchor<br />
Vals, der u.a. ein Volkslied aus Niederösterreich<br />
und eines aus Tirol sang, gleich<br />
danach stellte sich der Kirchenchor Teis<br />
auf humorvolle Art vor, indem die Sänger<br />
diskutierten, ob nun englisch oder traditionell<br />
gesungen werden soll. Beim Männerchor<br />
Schalders durfte weder ein Trinklied<br />
noch „etwas Romantisches“ fehlen,<br />
der Kirchenchor Mauls sang im Hochzeitssaal,<br />
der die Zuhörer kaum fassen<br />
konnte, drei Neue geistliche Lieder. 180<br />
Jahre lang gibt es schon den Kirchenchor<br />
Stilfes, der mit seinen 44 Sängern<br />
und Sängerinnen auftrat, und der Kirchenchor<br />
Schalders rührte die Zuhörer<br />
vor allem mit einem leidenschaftlichen<br />
Tirol-Bekenntnis: „Tirol, du meine Hei-<br />
mat!“ Dass es den Kirchenchor Feldthurns<br />
seit 1544 gibt, erfuhren die Zuhörer<br />
beim Auftritt dieses großen Chores<br />
im Schlossgarten, wo auch der Kirchenchor<br />
Villanders und der Männerchor Lajen<br />
auftraten und der Pfarrchor Lüsen<br />
die Auftritte im Garten u.a. mit dem Lied<br />
„Hoamgian“ abschloss. Im Schlosshof<br />
leiteten der Kirchenchor Gufidaun, der<br />
Gesangsverein Gasteig, der Kirchenchor<br />
Ridnaun und der Männergesangsverein<br />
Brixen auf die Abschlussfeier über. Dass<br />
die Zuhörer nicht müde waren, zeigte ihr<br />
Applaus und ihr Wunsch nach Zugaben,<br />
obwohl das schöne Wetter inzwischen Regenschauern<br />
gewichen war, was der guten<br />
Stimmung aber keinen Abbruch tat.<br />
So ertönten einen Tag lang in den alten<br />
Gemäuern klassische Lieder, Volkslieder,<br />
Heimat-, Wein- Liebes- und geistliche<br />
Lieder, sodass den Zuhörern der Reichtum<br />
und die Lebendigkeit der Südtiroler<br />
Chorszene bewusst wurde. Dies ist auch<br />
eines der Ziele eines solchen Chöre-Festivals,<br />
wie Verbandsobmann Erich Del-<br />
46<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Chorwesen<br />
Im Schlosshof lauschen die Zuhörer dem Gesang des Gesangsverein Gasteig.<br />
tedesco betont: „Wir wollen das Chorwesen<br />
wieder einmal in das Rampenlicht<br />
der Öffentlichkeit rücken und auf die Bedeutung<br />
des Singens hinweisen. Chorgesang<br />
ist ein Gemeinschaftserlebnis, das<br />
Freude macht.“ Bezirksobmann Gottfried<br />
Gläserer freute sich über die vielen Teilnehmer:<br />
„Es ist bemerkenswert und sehr<br />
erfreulich, dass 17 Chorgemeinschaften<br />
die Einladung zu diesem einmaligen Ereignis<br />
angenommen haben. Diese hohe<br />
Beteiligung ist ein deutlicher Beweis für<br />
die Lebendigkeit der Chorszene im Bezirk<br />
Eisacktal/Wipptal.“ Singen sei Kommunikation<br />
auf musikalischer Ebene,<br />
das Festival sei eine gute Möglichkeit<br />
Erfahrungen auszutauschen, sich näher<br />
kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen<br />
und Freundschaften zu vertiefen. Gelegenheit<br />
dazu gaben nicht nur die vielen<br />
Kurzkonzerte, die bis 16 Uhr die Zuhörer<br />
in ihren Bann zogen, sondern auch<br />
die Tänze und Schwertkämpfe der Ritter<br />
von Andrian im Schlossgarten oder das<br />
Zusammensitzen bei Knödeln und Tirtlan,<br />
die die Bäuerinnen von Rodeneck<br />
vorbereitet hatten.<br />
Dem Verband der Kirchenchöre Südtirols,<br />
im Besonderen Bezirksobmann Wolfgang<br />
Girtler, den vielen ehrenamtlichen<br />
Helfern, dem Kirchenchor Rodeneck<br />
für die Mithilfe bei der Organisation und<br />
nicht zuletzt allen teilnehmenden Chören<br />
galt der Dank von Bezirksobmann Gottfried<br />
Gläserer bei der Abschlussfeier im<br />
Schlosshof. Er dankte aber auch Bürgermeister<br />
Klaus Faller für die „unkomplizierte<br />
Art“ und die Gastfreundschaft, den<br />
Sponsoren und im Besonderen den Besitzern<br />
von Schloss Rodenegg, den Familien<br />
Wolkenstein und Thurn und Taxis,<br />
die beim Chöre-Festival durch Gräfin<br />
Mathilda Wolkenstein vertreten wurden.<br />
Diese zeigte sich in ihren Grußworten erfreut<br />
und dankbar über die gelungene<br />
Veranstaltung. Dem Dank schlossen<br />
sich Bürgermeister Klaus Faller, Theodor<br />
Rifesser, Vorsitzender des Verbandes<br />
der Kirchenchöre Südtirols, Verbandsobmann<br />
Erich Deltedesco und Landesrat<br />
Philipp Achammer an: „Ich habe gleich<br />
beim Betreten der Burg die Begeisterung<br />
gespürt!“ Voller Begeisterung erklangen<br />
dann auch die Schlusslieder,<br />
die Verbands- und Bezirkschorleiter Armin<br />
Mitterer dirigierte und die von allen<br />
gemeinsam gesungen wurden.<br />
Am Chöre-Festival des Bezirks Eisacktal-Wipptal im Südtiroler Chorverband und im Verband der Kirchenchöre Südtirols nahm<br />
auch der Männerchor Lajen teil.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 47
Aus Verband und Bezirken<br />
Ein Erlebnis für alle Sinne<br />
Tag der Chöre in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff<br />
Der Kirchenchor St. Leonhard gehörte auch zu den Chören, die die Gärten von Schloss Trauttmansdorff zum Erklingen brachten.<br />
Der Tag der Chöre in den Gärten von<br />
Schloss Trauttmansdorff soll zur Tradition<br />
werden: Dies betonten Heike Platter, Marketingleiterin<br />
der Gärten von Schloss Trauttmansdorff,<br />
und Erich Deltedesco, Obmann<br />
des Südtiroler Chorverbandes, beim Abschlusskonzert<br />
der Chöre, die am 7. September<br />
einen Tag lang die Gärten mit ihren<br />
Liedern zum Klingen gebracht hatten.<br />
„Der Chorgesang schenkt uns ein<br />
ganzheitliches Sinneserlebnis und dies<br />
entspricht der Philosophie der Gärten!“,<br />
betonte Platter. Dieses Sinneserlebnis<br />
wurde allen Besuchern zuteil, die sich im<br />
Laufe des Tages auf den Weg machten<br />
und am Pavillon, auf der Sissi-Terrasse,<br />
beim Seerosenteich, am Geologischen<br />
Mosaik, im Schlosshof oder auch im Restaurant<br />
einen der fünf Chöre erlebten:<br />
die Chorgemeinschaft Burggrafenamt –<br />
dazu gehören der Burggräfler Kinderchor<br />
„Vox Jubilans", der Algunder Frauenchor,<br />
der Kirchenchor Maria Himmelfahrt-Meran<br />
- unter der Leitung von Hans Schmidhammer,<br />
den Seniorenchor „Die Junggebliebenen“<br />
Bozen unter der Leitung von<br />
Anna Gasser, den Männerchor Raetia-<br />
St. Ulrich unter der Leitung von Claudio<br />
Kerschbaumer, den Kirchenchor St. Leonhard/Passeier<br />
unter der Leitung von<br />
Albrecht Lanthaler und den Pfarrchor<br />
Seis am Schlern unter der Leitung von<br />
Anton Schgaguler.<br />
So ertönten Heimatlieder, besinnliche<br />
und fröhliche Lieder aus den Palmenund<br />
Blumenhainen. Der Burggräfler<br />
Kinderchor Vox jubilans etwa sang ein<br />
dalmatinisches Volkslied, der Kirchenchor<br />
St. Leonhard berührte die Herzen<br />
mit einem schönen alpenländischen<br />
Obmann Erich<br />
Deltedesco<br />
dankte den<br />
teilnehmenden<br />
Chören.<br />
48<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Chorwesen<br />
Volkslied, in dem es heißt: „Hoamgian<br />
in mein stilles Tol, a schianers Gfühl gibs<br />
wohl net“ und der Männerchor Raetia<br />
aus St. Ulrich stimmte „La montanara“<br />
an. Der Südtiroler Chorverband hatte<br />
auch bei diesem Chorfest wieder dafür<br />
gesorgt, dass alle Sängerinnen und<br />
Sänger ein gutes Mittagessen erhielten.<br />
Für die „Weitsicht“ des Chorverbandes<br />
und die gute Organisation dankte Heike<br />
Platter dem Chorverband, insbesondere<br />
Josef Mair und Helga Huber von der Geschäftsstelle.<br />
Verbandsobmann Erich Deltedesco<br />
betonte vor dem gemeinsamen Schlusslied<br />
vor den rund 160 Sänger und Sängerinnen<br />
am Seerosenteich, dass es ein<br />
wunderschöner Tag gewesen sei und<br />
dankte den Chören für ihre Teilnahme.<br />
Im nächsten Herbst werden – in Zusammenarbeit<br />
mit der AGACH, der Arbeitsgemeinschaft<br />
Alpenländischer Chorverbände,<br />
deren Präsident Erich Deltedesco<br />
ist - Chöre aus dem ganzen Alpenraum in<br />
die Gärten kommen, um sie „zum Klingen“<br />
zu bringen und damit eine junge<br />
Tradition weiterführen.<br />
Hans Schmidhammer leitete den großen Gemeinschaftschor aller teilnehmenden Sänger und Sängerinnen am Ende des Tages<br />
der Chöre.<br />
Unter den teilnehmenden Chören waren auch Sänger und Sängerinnen des Algunder Frauenchors, des Pfarrchors Maria<br />
Himmelfahrt Meran und des Jugendchors Vox jubilans unter der Leitung von Hans Schmidhammer.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 49
Aus Verband und Bezirken<br />
Alle Erwartungen übertroffen<br />
Bezirk Bozen - Kulturfahrt nach Kufstein<br />
Die Teilnehmer an der Kulturfahrt des Bezirks Bozen werden die Eindrücke von<br />
der Aufführung noch lange in ihrer Erinnerung bewahren. Foto: Helga Dipoli<br />
Auch in diesem Sommer organisierte der<br />
Bezirk Bozen im Südtiroler Chorverband den<br />
Besuch einer besonderen kulturellen Veranstaltung.<br />
Nach dem großen Anklang, den<br />
die Kulturfahrten der letzten Jahre bei den<br />
Sängern und Sängerinnen gefunden haben,<br />
hat Bezirksobmann Georg Patauner mit seinem<br />
rührigen Ausschuss zu einer Busfahrt<br />
nach Kufstein im Tiroler Unterland eingeladen,<br />
wo die 9. Auflage des Operettensommers<br />
Kufstein stattfand. Während in den<br />
vergangenen Jahren Klassiker der Operettenliteratur<br />
auf dem Spielplan standen, gelangte<br />
mit My Fair Lady heuer erstmals ein<br />
Musical zur Aufführung. Etablierter Austragungsort<br />
ist die imposante Festung Kufstein,<br />
erstmals 1205 urkundlich erwähnt, Zeugin<br />
bewegter Jahrhunderte, jetzt Eigentum der<br />
Stadt und aufwendig saniert.<br />
Am späten Nachmittag des 2. August<br />
erreichte die Gruppe von 72 Sängerinnen<br />
und Sängern die Stadt am grünen Inn und<br />
hatte somit genügend Zeit für einen Bummel<br />
durch Straßen und Gassen der schmucken<br />
Altstadt, wo reges Treiben herrschte<br />
und in einer der zahlreichen Gaststuben<br />
zu traditionellen Schmankerln Einkehr gemacht<br />
werden konnte.<br />
Rechtzeitig stiegen die Sänger und Sängerinnen<br />
aus dem Bezirk Bozen zur beeindruckenden<br />
und geschichtsträchtigen<br />
Festungsanlage auf, genossen die herrliche<br />
Rundaussicht und erreichten die Festungsarena<br />
in der südlich vorgelagerten<br />
Josefsburg. Die mobile Überdachung bot<br />
einen einzigartigen Rahmen und gleichzeitig<br />
einen Schutz vor dem leider unbeständigen<br />
Wetter.<br />
Das Musical „My Fair Lady“ wurde vom<br />
weltweit bekannten Komponisten Frederick<br />
Loewe, basierend auf dem Theaterstück<br />
„Pygmalion“ von George Bernard Shaw,<br />
geschrieben. Melodien wie „Es grünt so<br />
grün“, „Ich hätt' getanzt heut' Nacht“ oder<br />
„Wart's nur ab!“ gingen um die Welt und<br />
avancierten nicht zuletzt dank der Verfilmung<br />
mit Audrey Hepburn und Rex Harison<br />
zu absoluten Klassikern.<br />
Das Stück spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.<br />
Zufällig läuft dem Sprachwissenschaftler<br />
Professor Henry Higgins das mittellose<br />
Blumenmädchen Eliza Doolittle über<br />
den Weg. Ihre vulgäre Aussprache weckt<br />
sein Interesse und veranlasst ihn zu einer<br />
Wette mit seinem Kollegen Oberst Pickering.<br />
Der Professor will beweisen, dass er<br />
Eliza in eine Dame der Gesellschaft umwandeln<br />
kann. Eliza sieht die Möglichkeit,<br />
ihre Lebensumstände zu verbessern, und<br />
nimmt Sprechunterricht beim Professor.<br />
Nach wochenlangem Martyrium scheint<br />
das Wunder vollbracht: Beim Diplomatenball<br />
absolviert Eliza einen glänzenden Auftritt.<br />
Der Professor hat seine Wette gewonnen.<br />
Eliza muss jedoch erkennen, dass sie<br />
für ihn nur als Wettgegenstand von Bedeutung<br />
war und flüchtet. Der eingefleischte<br />
Junggeselle Higgins stellt im Gegenzug<br />
fest, dass er sich sehr an das Mädchen<br />
gewöhnt hat und es vermisst.<br />
Regisseur Diethmar Straßer, bereits<br />
zum dritten Male Spielleiter beim Operettensommer<br />
Kufstein, inszenierte eine<br />
schwungvolle, kurzweilige „My Fair Lady“,<br />
wenngleich der zweite Teil des Musicals<br />
im Vergleich zum ersten deutlich abfällt.<br />
Die junge Sopranistin Anita Götz, das Blumenmädchen,<br />
spielt ihre Rolle hervorra-<br />
gend und mitreißend. Auch Axel Herrig,<br />
bekannter und prämierter Musical- Darsteller,<br />
agiert als Henry Higgins mit Bravour.<br />
Auch Peter Rühring alias Hugh Pickering<br />
sorgt immer wieder für Lacher.<br />
Schauspielerisch erfreuen die Leistungen<br />
der Solisten durchwegs. Das Bühnenbild<br />
wirkt sehr kreativ und gestattet mit wenigen<br />
Handgriffen den Umbau. Bunte Kostüme<br />
und wohl gewählte Accessoires<br />
runden den guten, farbenfrohen Gesamteindruck<br />
der Inszenierung ab.<br />
Die Vorstellung übertrifft alle Erwartungen<br />
und wird mit ihren beschwingten<br />
Melodien jedem noch lange im Ohr bleiben.<br />
Dies bezeugte der lang anhaltende<br />
Beifall, den das Publikum den Darstellern,<br />
dem Orchester, Ballett und Chor spendete.<br />
Mit dem Eindruck dieses besonderen Erlebnisses<br />
traten die Teilnehmer des Südtiroler<br />
Chorverbandes, Bezirk Bozen, ihre<br />
Rückreise an. Herzlichen Dank richteten<br />
sie an den Bezirksausschuss, an der Spitze<br />
Obmann Patauner, für die Ermöglichung<br />
und die vortreffliche Organisation des einmaligen<br />
Ausfluges.<br />
Thomas Terzer<br />
50<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Chorwesen<br />
Neue Chorleiter für das Land<br />
Chorleiterseminar des Südtiroler Chorverbandes und des VKS – Abschlusskonzert<br />
Beim Abschlusskonzert des Seminars für Chorleiter und Chorleiterinnen des Südtiroler Chorverbandes bewunderte das Publikum<br />
nicht nur das Können der Dirigenten, sondern auch das hohe Niveau des Chorgesangs.<br />
„Stellen Sie sich als Chorleiter den Chören<br />
zur Verfügung und helfen Sie damit, dass<br />
unsere Chöre singen und damit unsere Gesellschaft<br />
menschlicher machen!“ Mit diesem<br />
Appell von Chorverbandsobmann Erich<br />
Deltedesco an die angehenden Chorleiter<br />
endete das Abschlusskonzert des Seminars<br />
für Chorleiter und Chorleiterinnen des Südtiroler<br />
Chorverbandes und des Verbandes<br />
der Kirchenchöre Südtirols am 9. August.<br />
Ins Ragenhaus in Bruneck waren zahlreiche<br />
Musikinteressierte zum Konzert gekommen,<br />
darunter neben Erich Deltedesco<br />
auch Siegfried Fauster vom Verband der Kirchenchöre<br />
Südtirols. Eine Woche lang hatten<br />
die 42 Teilnehmer des Seminars unter<br />
der Gesamtleitung von Robert Göstl aus<br />
Regensburg Einblick in die Dirigiertechnik,<br />
Probengestaltung und Interpretation<br />
bekommen. In verschiedenen Gruppen<br />
erarbeiteten die Teilnehmer Werke unterschiedlicher<br />
Schwierigkeitsgrade, sangen<br />
im Plenum und bekamen konkrete Tipps<br />
zum Probenalltag.<br />
Das Konzert zeigte, dass es auch ein<br />
Ziel der Woche war, „die Teilnehmer mit<br />
möglichst vielen Epochen und Musikrichtungen<br />
in Berührung zu bringen“, wie Prof.<br />
Robert Göstl betonte. So sangen die „Arbeitschöre“<br />
und der Chor aller Teilnehmer<br />
beim Konzert geistliche und weltliche Lieder,<br />
klassische und moderne. Das Konzert begann<br />
mit einem Lied eines noch lebenden<br />
Komponisten und endete mit einem Werk<br />
von Bach. Dazwischen gab es Werke von<br />
Mendelssohn Bartholdy, Orlando di Lasso,<br />
Heinrich Schütz, Brahms, aber auch ein<br />
Jandl-Gedicht im Sprechchor war zu hören.<br />
Chorleiter und Sänger bewiesen ihr großes<br />
Können gerade auch bei anspruchsvollen<br />
Werken. Kreativität zeigte die Klasse der<br />
Musikerzieher, die in vier Liedern und un-<br />
ter Mithilfe von zwei Stoffpuppen eine Geschichte<br />
erzählten.<br />
Das Seminar für Chorleiter und Chorleiterinnen<br />
gibt es nun schon seit mehr als<br />
30 Jahren und stellt in Südtirol eine wichtige<br />
Möglichkeit dar, sich in diesem Bereich<br />
weiterzubilden. So betonte der Obmann des<br />
Südtiroler Chorverbandes, dass sich in der<br />
heutigen Zeit im Bereich der Chorleitung ein<br />
„Paradigmenwechsel“ vollziehe: „Chorleitung<br />
muss heute wertschätzende, ganzheitliche<br />
Chorpädagogik sein. Die Herausforderungen<br />
an die Sozialkompetenz und an die<br />
Fachkompetenz werden immer höher.“ Der<br />
Obmann dankte den Teilnehmern und Referenten,<br />
der Leitung der Fachschule für Landwirtschaft<br />
in Dietenheim, wo die Dirigenten<br />
untergebracht waren, aber auch dem Landesamt<br />
für Kultur und der Stiftung Südtiroler<br />
Sparkasse, die die Tätigkeiten des Chorverbandes<br />
finanziell unterstützen.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 51
Aus Verband und Bezirken<br />
Jugendliche im „Musical-Fieber“<br />
Abschlusskonzert der Schulung „Musical Fever“<br />
Mitreißende Choreografien und beeindruckende Soloauftritte bot auch heuer wieder das Abschlusskonzert der Schulung „Musical<br />
Fever“ des Südtiroler Chorverbandes.<br />
„Ist man vom Musical-Virus erst einmal<br />
angesteckt, lässt er einen nicht mehr los!“<br />
So brachte Carmen Seidner, Vorstandsmitglied<br />
des Südtiroler Chorverbandes, beim<br />
Abschlusskonzert der Schulung „Musical<br />
Fever“ am 30. August die Begeisterung<br />
der 19 Jugendlichen auf den Punkt, die<br />
eine Woche lang an der Schulung teilgenommen<br />
hatten.<br />
Auf der Bühne des Parzival-Saales im<br />
Vinzentinum in Brixen sangen und tanzten<br />
sie mit solchem Können und solchem Einsatz,<br />
dass auch die zahlreichen Besucher<br />
vom Musical-Fieber angesteckt wurden.<br />
Die 19 Teilnehmer – alle im Alter zwischen<br />
13 und 23 – zeigten im Ensemble, in Soloauftritten<br />
und in fesselnden Choreografien,<br />
was sie unter der Leitung von erfahrenen<br />
Referenten gelernt hatten.<br />
Stimmtechnisch wurden sie vom Musical-Solisten<br />
und Professor an der Folkwang<br />
Universität der Künste Essen Jack<br />
Poppell und Doris Warasin geführt, mit<br />
Karin Mairhofer studierten sie die Choreografien<br />
ein, begleitet wurden sie am Klavier<br />
von Liviu Petcu, an der Gitarre von<br />
Mattia Mariotti und am Schlagzeug von<br />
Marcel Lloyd. Die bewährte Leitung hatte<br />
wie auch in den vergangenen sechs Jahren<br />
Stephen Lloyd inne. Lloyd erinnerte<br />
daran, dass die Teilnehmer schon vor<br />
Kursbeginn zwei Lieder vorbereiten und<br />
dann vorsingen mussten. Auf dieser Basis<br />
wurde dann stimmtechnisch, interpretatorisch<br />
und choreografisch gearbeitet.<br />
„Heuer singen beim Abschlusskonzert<br />
zum ersten Mal alle Teilnehmer als Solisten“,<br />
sagte Lloyd, der darauf hinwies,<br />
dass das Musical eine sehr anspruchsvolle,<br />
wenn auch oft unterschätzte Kunstform<br />
ist: „Das Musical ist genau so tief<br />
gehend wie die Oper“. Es sei für jeden<br />
Sänger, und insbesondere für die Jugendlichen,<br />
eine große Herausforde-<br />
rung, auf der Bühne zugleich zu singen<br />
und zu tanzen.<br />
Die jungen Männer und Frauen meisterten<br />
die Herausforderung gut: Sie sangen<br />
Lieder aus berühmten Musicals wie<br />
„My Fair Lady“, „Mamma mia“, „We will<br />
rock you“, aber auch aus beliebten neueren<br />
Musicals, die zur Zeit in London und<br />
New York mit viel Erfolg aufgeführt werden,<br />
so „Next to Normal“, „Matilda“ oder<br />
„Kinky Boots“. Auch heuer waren wieder<br />
deutsche Musicals vertreten, und nicht nur<br />
bei diesen zeigte sich das große Einfühlungsvermögen<br />
der Teilnehmer und der<br />
professionelle Umgang mit der Stimme.<br />
„Gerade bei Musical, Pop und Rock ist<br />
Stimmbildung sehr wichtig, denn gerade<br />
in diesem Bereich kann man sich leicht<br />
die Stimme kaputt machen. Deshalb ist<br />
es wichtig, dass man gute Lehrer hat“,<br />
betonte Carmen Seidner. Der Südtiroler<br />
Chorverband biete daher regelmäßig Mu-<br />
52<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Chorwesen<br />
sical-Schulungen an. „Ich bin überwältigt<br />
vom Fortschritt der Teilnehmer und ich<br />
wüsste nicht, auf welchen Solisten ich<br />
hätte verzichten wollen!“, drückte Carmen<br />
Seidner ihre Begeisterung über die<br />
Aufführung aus.<br />
Die Zugabe widmeten die Jugendlichen<br />
ihren „wunderbaren Dozenten“: „Ohne euch<br />
hätten wir es nicht geschafft!“ Der Dank des<br />
Südtiroler Chorverbandes, dessen Obmann<br />
Erich Deltedesco unter den Zuhörern war,<br />
galt ebenfalls den Referenten, aber auch<br />
dem Priesterseminar, wo die Teilnehmer untergebracht<br />
waren, dem Vinzentinum und<br />
den Sponsoren Stiftung Südtiroler Sparkasse<br />
und Südtiroler Landesregierung, „ohne deren<br />
Unterstützung solche Schulungen nicht<br />
möglich wären“, wie Seidner betonte.<br />
Besonders spannend waren wieder die Soloauftritte der Teilnehmer.<br />
Neue Noten für Männerchöre<br />
Kostenloses Herunterladen möglich<br />
Musik und Musikerziehung zu fördern ist eines der Ziele der deutschen Werner Richard – Dr. Karl Dörken-Stiftung. Deshalb<br />
gibt es auf ihrer Internetseite www.doerken-stiftung.de seit Neuestem die Möglichkeit, kostenlos Noten für Männerchöre in unterschiedlichsten<br />
Schwierigkeiten herunterzuladen. Dabei handelt es sich um Werke, die von der Stiftung in Auftrag gegeben<br />
wurden. Die Komponisten hatten sich mit dieser Möglichkeit, sich kostenlos die Noten herunterzuladen, einverstanden erklärt.<br />
Die Sammlung von Partituren, Chorstimmen und Klavierstimmen soll kontinuierlich erweitert werden und richtet sich so vor<br />
allem an Männerchöre, die an neuerer Literatur interessiert sind bzw. Tradition und Moderne verbinden wollen.<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 53
Aus Verband und Bezirken<br />
Singen ist Jasagen zur<br />
Schöpfung<br />
Abschlusskonzert der Chor- und Stimmbildungswoche des Süd tiroler<br />
Chorverbandes in Burgeis<br />
„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“<br />
sangen die 77 Teilnehmer der Chorund<br />
Stimmbildungswoche des Südtiroler<br />
Chorverbandes als letztes Lied ihres Abschlusskonzertes<br />
am 2. August im Vereinshaus<br />
von Burgeis. Und sie sangen es mit<br />
solcher Begeisterung und echter Freude,<br />
dass die zahlreich erschienenen Zuhörer am<br />
liebsten mitgesungen und mitgetanzt hätten.<br />
Dieses letzte Pop-Lied war sicher ein<br />
Höhepunkt des Konzertes, das mit Werken<br />
von Schumann, Schubert, Rossini und anderen<br />
Klassikern begann und über das Volkslied<br />
in das 20. Jahrhundert führte.<br />
Unter der Leitung von Jan Schumacher<br />
und unter Mithilfe von sechs Einzelstimmbildnern<br />
hatten die Sänger und Sängerinnen<br />
„im Wechselbad zwischen Förderung<br />
und Forderung“, wie es der Obmann<br />
des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco<br />
ausdrückte, ein breites Repertoire<br />
erarbeitet und ein beachtliches Niveau erreicht.<br />
Vier Stunden am Tag sangen sie in<br />
Ensembles, die von den verschiedenen<br />
Stimmbildnern geleitet wurden, und die<br />
übrige Zeit im Plenum, das Jan Schumacher<br />
und Johannes Lang dirigierten.<br />
Der Chorklang und die Interpretation<br />
waren bei den meisten Liedern überzeugend<br />
und so war auch das Publikum begeistert,<br />
darunter der Abt von Marienberg<br />
Markus Spanier, der Bürgermeister<br />
von Mals Ulrich Veith, die Kulturreferentin<br />
von Mals Sibille Tschenett, der Landtagsabgeordnete<br />
Josef Noggler, der Dekan<br />
von Klausen Gottfried Fuchs sowieVer-<br />
treter des Südtiroler Chorverbandes und<br />
des Tiroler Sängerbundes. Der Obmann<br />
des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco<br />
bedankte sich bei der Leitung<br />
der Fürstenburg, aber vor allem bei der<br />
„hochmotivierten Sängerschar“. Sie würde<br />
beweisen, dass „Singen Ja-Sagen zur<br />
Schöpfung“ ist. Dass die Chöre im Lande<br />
bedeutende Fortschritte machten, sei zu<br />
einem großen Teil den Schulungen wie<br />
der Chorwoche in Burgeis zu verdanken,<br />
die es nun schon seit mehr als 30 Jahren<br />
gibt. Dass die Sänger und Sängerinnen<br />
sich mit der Fürstenburg und Mals verbunden<br />
fühlen, zeigte nicht zuletzt das<br />
Engagement für die Opfer des Brandes<br />
in Mals: Die freiwilligen Spenden für das<br />
Konzert gingen an die Betroffenen.<br />
Unbändiges Engagement zeigten die Teilnehmer der Chor- und Stimmbildungswoche beim Abschlusskonzert im Vereinshaus von<br />
Burgeis, hier dirigiert von Johannes Lang.<br />
54<br />
<strong>KulturFenster</strong>
Chorwesen<br />
Sänger besichtigen Bunker<br />
31. Sängerwanderung des Bezirks Burggrafenamt/<br />
Vinschgau in Reschen-Nauders<br />
Von Nauders nach Reschen führte die Sängerwanderung des Bezirks Burggrafenamt-Vinschgau.<br />
Auf Einladung des Kirchenchors St. Sebastian<br />
- Reschen fanden sich am 21. September<br />
Sänger und Sängerinnen des Südtiroler<br />
Chorverbandes - Bezirk Burggrafenamt-Vinschgau<br />
und des Tiroler Sängerbundes-Bezirk<br />
Landeck in Reschen zur traditionellen<br />
Sängerwanderung des Bezirks ein.<br />
Der Gottesdienst in der Pfarrkirche, den<br />
Pfarrer Anton Pfeifer zelebrierte, wurde von<br />
der großen Sängerschar unter der Leitung<br />
von Hans Erb musikalisch mitgestaltet. Im<br />
Anschluss begrüßte Bezirksobmann Robert<br />
Wiest die Teilnehmer und der Obmann<br />
des Kirchenchores Reschen, Ludwig Wilhalm<br />
gab seiner Freude Ausdruck, dass<br />
die Sängerwanderung in Reschen statt-<br />
fand. Gemeindereferent Franz Prieth informierte<br />
alle Teilnehmer über das Dorf<br />
Reschen und über den Verein Okulus, der<br />
die Führung der Sängerwanderung übernommen<br />
hatte.<br />
Nach einem Umtrunk wurden die Sänger<br />
zur Bergkastel-Bergbahn in Nauders<br />
gefahren, von wo nach einem guten Mittagessen<br />
die Wanderung zurück nach Reschen<br />
führte, vorbei an naturbelassenen<br />
Landschaften und an der Panzersperre. Die<br />
Wanderführer Florian Eller, Ludwig Schöpf<br />
und Franz Prieth beantworteten die vielen<br />
Fragen der interessierten Wanderer. Höhepunkt<br />
der Wanderung war die Besichtigung<br />
des Bunkers an der Etschquelle. So<br />
verband auch die 31. Sängerwanderung<br />
Gesang, Kultur und Natur und setzte die<br />
Tradition der Gesamttiroler Freundschaft<br />
im Bezirk fort.<br />
Reschen<br />
<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 55
Impressum<br />
Mitteilungsblatt des Verbandes Südtiroler<br />
Musikkapellen, des Südtiroler Sängerbundes<br />
und des Heimapflegeverbandes Südtirol<br />
Eigentümer und Herausgeber:<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen, Bozen<br />
Ermächtigung Landesgericht Bozen<br />
<strong>Nr</strong>. 27/1948<br />
Schriftleiter und im Sinne des Pressegesetzes<br />
verantwortlich:<br />
Dr. Alfons Gruber<br />
Als Pressereferenten für die Darstellung der<br />
entsprechenden Verbandsarbeit zuständig:<br />
VSM: Stephan Niederegger,<br />
E-Mail: kulturfenster@vsm.bz.it<br />
SCV: Paul Bertagnolli,<br />
E-Mail: bertagnolli.paul@rolmail.net<br />
HPV: Sylvia Rottensteiner,<br />
E-Mail: rottensteiner.sylvia@gmail.com<br />
Unverlangt eingesandte Bilder und Texte<br />
werden nicht zurückerstattet.<br />
Redaktion und Verwaltung:<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen,<br />
I-39100 Bozen, Schlernstraße 1, Waltherhaus<br />
Tel. 0471 976387 - Fax 0471 976347<br />
E-Mail: info@vsm.bz.it<br />
Einzahlungen sind zu richten an:<br />
Verband Südtiroler Musikkapellen, Bozen,<br />
Waltherhaus<br />
Raiffeisen-Landesbank, BZ<br />
IBAN: IT 60S03493 11600 0003000 11771<br />
SWIFT-BIC: RZSBIT2B<br />
Jahresbezugspreis: Euro 20<br />
Gefördert von der Kulturabteilung<br />
der Südtiroler Landesregierung.<br />
Druck: Ferrari-Auer, Bozen<br />
Das Blatt erscheint als Zweimonatszeitschrift,<br />
und zwar jeweils am 15. Februar, April, Juni,<br />
August, <strong>Oktober</strong> und Dezember.<br />
Redaktionsschluss ist der 15. des jeweiligen<br />
Vormonats.