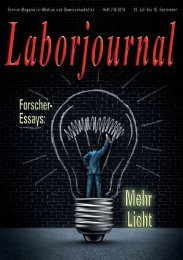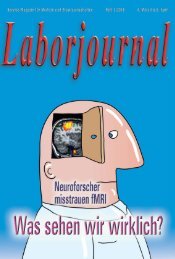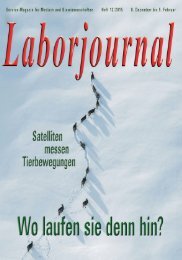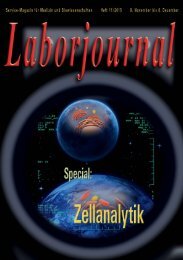NanoPhotometer NP80
LJ_16_04
LJ_16_04
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
NACHRICHTEN<br />
Förderung kompakt<br />
Frisch gefördert...<br />
12<br />
➤ Der Schweizerische Nationalfonds<br />
(SNF) vergibt drei Förderprofessuren<br />
an die Universität Basel und stellt dafür<br />
über die nächsten vier Jahre jeweils<br />
1,6 Millionen Schweizer Franken zur<br />
Verfügung. Zwei der Professuren<br />
haben biomedizinischen Bezug: Nicola<br />
Aceto untersucht die Metastasenbildung<br />
und Zell-Zell-Kontakte zwischen<br />
Krebszellen. Eline Pecho-Vrieseling<br />
nimmt falsch gefaltete Proteine im Zusammenhang<br />
mit Chorea Huntington<br />
unter die Lupe.<br />
➤ Fehlfunktionen in Mitochondrien<br />
macht man unter anderem für diverse<br />
neurodegenerative Erkrankungen<br />
verantwortlich. Vor diesem Hintergrund<br />
schaut sich Nora Vögtle am<br />
Institut für Biochemie und Molekularbiologie<br />
der Universität Freiburg<br />
Proteasen der Mitochondrien an, die<br />
Signalsequenzen importierter Proteine<br />
entfernen sollen. Jetzt ermöglicht ihr<br />
die DFG den Aufbau einer eigenen<br />
Arbeitsgruppe, indem sie sie über die<br />
kommenden fünf Jahre mit insgesamt<br />
1,25 Millionen Euro aus ihrem Emmy<br />
Noether-Programm fördert.<br />
➤ Weiterhin hat die DFG auch Hanna<br />
Taipaleenmäki vom Universitätsklinikum<br />
Hamburg-Eppendorf (UKE) in<br />
ihr Emmy Noether-Programm aufgenommen.<br />
Taipaleenmäki untersucht<br />
Knochenmetastasen, die aus Brustkrebstumoren<br />
hervorgegangen sind.<br />
Dabei interessiert sie sich insbesondere<br />
für die Rolle der Osteoblasten und<br />
sucht nach Möglichkeiten, dem mit<br />
der Metastasierung einhergehenden<br />
Knochenabbau therapeutisch entgegenzuwirken.<br />
➤ Ins Archiv statt in den Müll – das<br />
soll die Compounds Platform (Com-<br />
Plat) am Karlsruher Institut für Technologie<br />
(KIT) möglich machen. Moleküle<br />
aus wissenschaftlichen Projekten werden<br />
dort katalogisiert und dauerhaft<br />
aufbewahrt, um sie künftig anderen<br />
Forschern zur Verfügung stellen zu<br />
können. Interessenten können den<br />
ComPlat-Gerätepark kostenlos nutzen.<br />
Die DFG fördert das Molekülarchiv als<br />
DFG-Gerätezentrum bis 2019 mit etwa<br />
einer halben Millionen Euro.<br />
-MRE-<br />
EU-Kommission<br />
Photosynthese<br />
Eigentlich wünschen sich Landwirte,<br />
dass ihre Pflanzen ertragreich Kohlenhydrate<br />
aus Luft und Licht bilden. Vor allem<br />
C3-Pflanzen bekommen dabei aber mitunter<br />
Probleme. Das Rubisco-Enzym setzt<br />
nämlich nicht nur CO 2<br />
um, sondern manchmal<br />
auch Sauerstoff. Die sogenannte Photorespiration<br />
tritt dann in Konkurrenz zur<br />
Photosynthese und bremst das Wachstum.<br />
Weil dieser verschwenderische Prozess<br />
vor allem bei hohen Temperaturen und<br />
Wasserdefizit auftritt, leidet die Produktivität<br />
von Nutzpflanzen gerade in Regionen,<br />
in denen Menschen ohnehin mit Nahrungsmangel<br />
zu kämpfen haben.<br />
Ein internationales Forscherteam sucht<br />
jetzt nach Wegen, die Photorespiration zu<br />
umgehen und durch effektivere synthetische<br />
Stoffwechselwege zu ersetzen. Zunächst<br />
will man durch Computersimulationen<br />
geeignete biochemische Prozesse<br />
ermitteln, um diese erst in E. coli und einzelligen<br />
Grünalgen, später auch in höheren<br />
Pflanzen zu testen. Für das Projekt mit dem<br />
Namen „FutureAgriculture” gibt es rund<br />
fünf Millionen Euro Unterstützung von der<br />
Europäischen Kommission, die die Kooperation<br />
zwischen deutschen, englischen,<br />
israelischen und italienischen Forschern<br />
im Rahmen ihres FET-Open-Programms<br />
fördert. Arren Bar-Even vom Potsdamer<br />
Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie<br />
koordiniert das Projekt.<br />
BMBF<br />
Leukämie-Resistenz<br />
PRECiSe steht für „Pretherapeutic Epigenetic<br />
CLL Patient Stratifikation“. Sicher<br />
haben die beteiligten Forscher aus verschiedenen<br />
Heidelberger Instituten und<br />
der Uniklinik Ulm dieses Akronym nicht<br />
zufällig gewählt, denn sie möchten vor<br />
einer Therapie genau wissen, was ihren<br />
Patienten hilft. Dazu erforschen sie, wie<br />
Krebszellen bei chronischer lymphatischer<br />
Leukämie (CLL) Resistenzen gegen diverse<br />
Wirkstoffe entwickeln, und wie man den<br />
Therapieerfolg individuell voraussagen<br />
sowie die Behandlung optimieren kann.<br />
Für ihre Arbeit sucht das Team in einer<br />
Sammlung von Patienten-Gewebeproben<br />
nach epigenetischen Faktoren, die sich auf<br />
die DNA-Verpackung und das Krankheitsgeschehen<br />
auswirken. Die Daten werten<br />
sie mit speziellen Computermodellen aus.<br />
Neben CLL hoffen sie, auch andere<br />
Erkrankungen des blutbildenden Systems<br />
besser zu verstehen. Zunächst aber darf<br />
sich das PRECiSe-Team unter Leitung von<br />
Daniel Mertens von der Ulmer Uniklinik<br />
und Karsten Rippe vom DKFZ erst einmal<br />
über eine üppige Förderung freuen: Das<br />
BMBF unterstützt das Verbundprojekt über<br />
die nächsten drei Jahre mit insgesamt 2,7<br />
Millionen Euro.<br />
Reinhart Koselleck-Projekt<br />
Xenotransplantation<br />
Mit ihren Reinhart Koselleck-Projekten<br />
fördert die DFG innovative und risikobehaftete<br />
Ideen, für die man ansonsten nur<br />
schwer an Drittmittel kommen würde.<br />
Die Gruppen von Michael Ott vom TWIN-<br />
CORE-Zentrum in Hannover und von Heiner<br />
Niemann vom Friedrich-Löffler-Institut<br />
für Nutztiergenetik in Neustadt-Mariensee<br />
haben sich jetzt für die nächsten fünf<br />
Jahre eine solche 1,25 Millionen Euro-Förderung<br />
von der DFG gesichert.<br />
Illustr.: Sam Kaplan<br />
Ott und Niemann kooperieren, um Xenotransplantationen<br />
der Leber zu erforschen.<br />
Ihre Ziel: Patienten irgendwann<br />
eine neue Leber zu transplantieren, die<br />
ursprünglich vom Schwein stammt. Indem<br />
man zuvor menschliche Stammzellen<br />
in das tierische Organ einbringt, könnte<br />
sich das Gewebe nach und nach an den<br />
menschlichen Organismus angleichen und<br />
schließlich auch menschliche Proteine synthetisieren.<br />
Zunächst testen die Forscher<br />
das Regenerationsvermögen und die Reparaturmechanismen<br />
in der Schweineleber.<br />
Anschließend wollen sie dann herausfinden,<br />
ob sich auch menschliche Hepatocyten<br />
ins Schweineorgan integrieren lassen und<br />
dort wachsen.<br />
-MRE-<br />
4/2016 Laborjournal