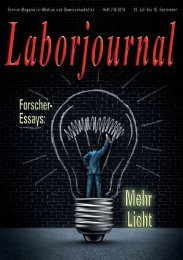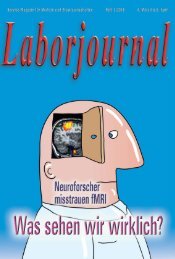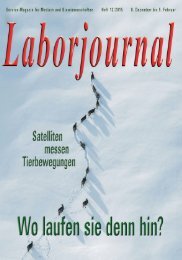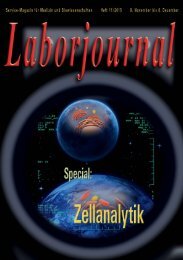NanoPhotometer NP80
LJ_16_04
LJ_16_04
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Foto: cronodon.com<br />
Journal Club<br />
Thomas Silhavy beschrieben worden war<br />
(PNaS 106: 8009-14). Zu diesem System<br />
gehört weiterhin das Lipoprotein VacJ,<br />
das an der Innenseite der äußeren Membran<br />
sitzt. Im periplasmatischen Raum<br />
zwischen äußerer und innerer Membran<br />
diffundiert YrbC und bindet, wenn es mit<br />
VacJ interagiert, Phospholipide der äußeren<br />
Membran. An der inneren Membran<br />
gibt YrbC die gebundenen Lipide dann an<br />
einen ABC-Transporter ab – einem Proteinkomplex<br />
aus weiteren Yrb-Proteinen. Ob<br />
die Lipide über den ABC-Transporter anschließend<br />
ins Cytoplasma gelangen und<br />
dort metabolisiert werden, oder ob sie in<br />
die innere Membran eingebaut werden,<br />
wisse man noch nicht, so Schild.<br />
Oberfläche zwangsgefaltet<br />
Fest steht aber, dass dieses VacJ/Yrb<br />
ABC-System durch den Abtransport verhindert,<br />
dass Phospholipide in der äußeren<br />
Membran akkumulieren. Schilds Team<br />
konnte zeigen, dass Deletionen in YrbE und<br />
VacJ auch bei E. coli und Vibrio cholerae<br />
die Produktion der Außenmembranvesikel<br />
hochschrauben. „Wenn ständig neue<br />
Phospholipide reingestopft werden, ohne<br />
dass sie woanders hinfließen können, dann<br />
muss es zwangsläufig zu einer Faltung<br />
der Oberfläche kommen. Irgendwo muss<br />
das zusätzliche Material ja hin“, skizziert<br />
Schild das Modell der Grazer. So kommt<br />
es dann zur Ausstülpungen und letztlich<br />
zur Bildung der Vesikel. Der Effekt lässt<br />
sich rückgängig machen, indem man funktionsfähige<br />
Wildtyp-Gene in die Zellen einbringt.<br />
Dann fahren die Bakterien ihre Vesikelproduktion<br />
auf Normalniveau herunter.<br />
Sequenzanalysen in rund einem Dutzend<br />
gramnegativer Bakterien zeigen, dass dieses<br />
Transportsystem, und damit wohl auch<br />
die Regulation der Außenmembranvesikel<br />
stark konserviert sind. „Wobei wir nicht<br />
ausschließen, dass es da noch weitere Mechanismen<br />
geben kann“, stellt Schild klar.<br />
Nachdem diese Ergebnisse auf dem<br />
Tisch lagen, fragte sich das Team, welche<br />
Umweltbedingungen die Vesikelbildung beeinflussen.<br />
„Mit ein bisschen Glück fanden<br />
wir, dass Eisenmangel dieses Transportsystem<br />
herunterreguliert“, erzählt Schild.<br />
Und dabei produzieren die Bakterien auch<br />
mehr Außenmembranvesikel. Ebenso bei<br />
einer Verlustmutation des ferric uptake<br />
regulators Fur. „Fur wurde ursprünglich<br />
publiziert als Repressor, der sich auf die<br />
DNA setzt und unter Eisenmangel abfällt“,<br />
erklärt Schild; Fur könne aber, wie man<br />
mittlerweile weiß, auch als Aktivator wirken<br />
– wie offenbar im Zusammenhang mit<br />
dem VacJ/Yrb-ABC-Transporter. Der Regulator<br />
fährt den Lipidtransport hoch und<br />
damit die Vesikelproduktion runter. „Ein<br />
pathogenes Bakterium verspürt aber Eisenmangel,<br />
sobald es in den Wirt gelangt“,<br />
verweist Schild auf eine Hürde, der sich<br />
beispielsweise die Cholera-Erreger stellen<br />
müssen. Der menschliche Organismus sei<br />
nämlich sehr gut darin, Eindringlingen das<br />
Spurenelement vorzuenthalten. Indem Fur<br />
nun infolge des Eisenmangels keine weitere<br />
Expression der ABC-Transportergene mehr<br />
induziert, sammeln sich Phospholipide in<br />
der äußeren Membran.<br />
Vesikel auf Nahrungssuche<br />
Da die erhöhte Vesikulierung bei Eisenmangel<br />
ebenfalls bei gramnegativen Bakterien<br />
konserviert ist, vermutet Schild, dass<br />
dies ein Hinweis auf die Evolution der Vesikelbildung<br />
sein könnte. Er sieht die Annahme<br />
bestätigt, dass die Außenmembranvesikel<br />
quasi auf Nahrungssuche gehen. Dabei<br />
könnten sie zum Beispiel Eisen aufnehmen<br />
und die Bakterien dann durch Rückfusionierung<br />
versorgen. „Bislang ist das aber<br />
noch nicht molekular gezeigt“. Und so bergen<br />
die Außenmembranvesikel noch einige<br />
Geheimnisse, die es aufzuklären gilt. Sicher<br />
scheint nur, dass gramnegative Bakterien<br />
sie zum Überleben brauchen, und dass sie<br />
den pathogenen Vertretern beim Infizieren<br />
des Wirts behilflich sind. Sollten sich<br />
die Außenmembranvesikel aber auch am<br />
Menschen als wirksamer Impfstoff bewähren,<br />
dann könnte man Cholera und Co. mit<br />
ihren eigenen Waffen schlagen.<br />
MaRIo REMBoLd<br />
Präsentieren stolz ihr Modell: Stefan Schild, Paul Kohl, Fatih Cakar,<br />
Sandro Roier, Franz G. Zingl, Sanel Durakovic und Joachim Reidl (v.l.n.r.)<br />
Foto: Stefan Schild<br />
Laborjournal<br />
4/2016<br />
23