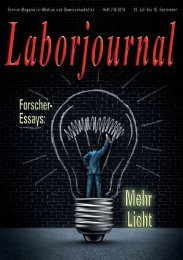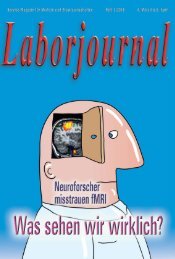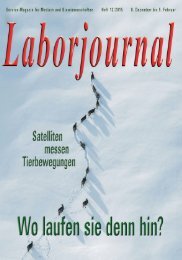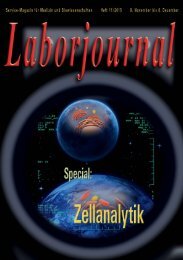NanoPhotometer NP80
LJ_16_04
LJ_16_04
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Special: Synthetische Biologie & Biotechnologie<br />
& Biotechnologie<br />
Illustr: techNyouvids<br />
men, der spezifisch in Astrozyten gehemmt<br />
wird. Dann leuchten alle Zellen außer den<br />
Astrozyten. In diesem Fall hat man eine<br />
NICHT-Bedingung implementiert: Falls<br />
der Astrozytenmarker NICHT vorhanden<br />
ist, dann produziere GFP.<br />
Bei solchen Booleschen Funktionen<br />
spricht man auch von Logikgattern, und<br />
diese kann man weiter ausbauen: Falls<br />
Signal A UND Signal B vorhanden sind,<br />
dann produziere GFP. Signal A könnte<br />
ein Transkriptions-Aktivator sein, der<br />
sich nur in Gegenwart eines Chaperons<br />
korrekt faltet und andernfalls nicht funktioniert.<br />
Das Chaperon wäre dann Signal<br />
B. Und nur wenn Aktivator und Chaperon<br />
gleichzeitig vorhanden sind, produziert<br />
die Zelle GFP.<br />
Man kann mehrere solcher Systeme<br />
hintereinanderschalten, indem<br />
zum Beispiel der generierte Output<br />
wieder als Input für das nächste molekulare<br />
Logikgatter dient. Idealerweise<br />
hat man einen modularen Baukasten,<br />
um sich beliebig komplexe Verrechnungseinheiten<br />
zu konstruieren. Upstream der<br />
Recheneinheit braucht man Sensoren, die<br />
Eingangssignale in die Sprache der Verrechnungseinheit<br />
übersetzen – Transkriptionsfaktoren<br />
oder auch regulatorische<br />
RNAs. Downstream gibt es ein oder mehrere<br />
Ausgangssignale, wie ein Fluoreszenzsignal<br />
oder ein bestimmtes Verhalten der<br />
Zelle. (Anschauliche Beispiele für solche<br />
molekularen Logikgatter bietet ein Review<br />
von Jennifer Brophy und Christopher Voigt:<br />
Nat Methods 11(5): 508-20).<br />
Ein genetischer Schaltkreis kann auch<br />
Information speichern. Timothy Gardner<br />
et al. stellten bereits 1999 einen einfachen<br />
Schalter für E. coli vor, den man mit einem<br />
kurzen Signal dauerhaft in die eine oder<br />
andere Richtung kippen kann (Nature<br />
403: 339-42). Auf einem Plasmid liegt eine<br />
Prinzip eines genetischen Kippschalters:<br />
Tetracyclin schaltet die Fluoreszenz über GFP ein,<br />
IPTG schaltet sie wieder ab.<br />
kodierende Sequenz für den Tet-Repressor<br />
(TetR). Davor ein Promotor, der vom<br />
Lac-Repressor (LacI) abgeschaltet werden<br />
kann. Kommt es zur TetR-Expression, dann<br />
blockiert TetR wiederum den Promotor, der<br />
direkt vor der LacI-Sequenz liegt. Somit<br />
wird klar: Die E. colis können nicht gleichzeitig<br />
LacI und TetR produzieren, weil beide<br />
Repressoren ihre Expression gegenseitig<br />
hemmen.<br />
Nicht ganz dicht<br />
Allerdings kann man zwischen beiden<br />
Zuständen hin und her schalten. Gibt<br />
Illustr: Mario Rembold<br />
man nämlich IPTG zu, dann blockiert<br />
man das LacI-Protein und schaltet somit<br />
auf TetR um. Und die Repressorwirkung<br />
des TetR-Proteins wiederum lässt sich mit<br />
Tetracyclin abschalten. Als Reporter nahmen<br />
die Autoren damals GFP hinter dem<br />
Promotor, der auch die LacI-Expression<br />
steuert. Dann schaltet Tetracyclin die<br />
Fluoreszenz ein, IPTG schaltet sie wieder<br />
aus. Wichtig hierbei ist, dass IPTG<br />
oder Tetracyclin nicht dauerhaft im<br />
Medium enthalten sein müssen. Es ist<br />
jeweils nur ein kurzer Puls notwendig,<br />
um den Schalter zu kippen. Dann bleibt<br />
das System stabil und merkt sich die Einstellung.<br />
Zumindest theoretisch.<br />
In der Realität sind Promotoren aber<br />
häufig „undicht“. Das stellten Tom Ellis<br />
und seine Kollegen fest, als sie 2009<br />
erwähnten TetR/LacI-Schalter in der<br />
Bäckerhefe implementierten (Nat Biotechnol<br />
27(5): 465-71). Denn bei diesem<br />
Konstrukt war LacI nicht in der Lage, die<br />
TetR-Expression vollständig zu blockieren.<br />
Daher kippt der Schalter allmählich<br />
zurück zur TetR-Einstellung. „Undichte<br />
Promotoren sind häufig problematisch in<br />
der synthetischen Biologie“, resümiert Tom<br />
Ellis, der heute am Imperial College London<br />
forscht. „Es ist ziemlich schwer, einen vollständigen<br />
Off-Promotor mit null Prozent<br />
Expression zu bekommen.“<br />
Kurzerhand haben Ellis und Kollegen<br />
aus dem Bug ein Feature gemacht: „Wir<br />
nutzen das als Timer“, erklärt er. Mit einer<br />
Tetracyclin-Gabe startet man die molekulare<br />
Zeitschaltuhr. Die Hefezellen produzieren<br />
jetzt mehrere Stunden lang viel LacI<br />
und wenig TetR. Innerhalb von ein bis zwei<br />
Laborjournal<br />
4/2016<br />
33