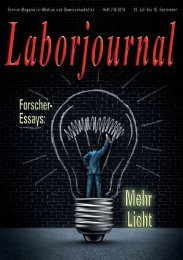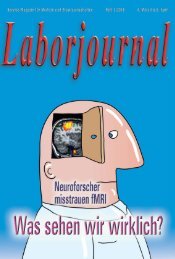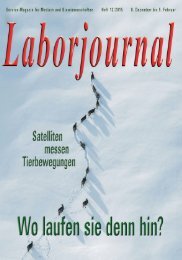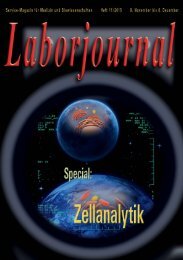NanoPhotometer NP80
LJ_16_04
LJ_16_04
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wirtschaft<br />
Gebäude zwischen 90 und 95 Prozent ausgelastet“,<br />
sagt Günnewig zufrieden. Eine<br />
Vollauslastung sei nicht gewollt, erläutert<br />
er, um jungen Unternehmen auch spontan<br />
freie Büro- und Laborflächen anbieten zu<br />
können. Günnewig beschreibt die Kernaufgaben<br />
der Technologieförderung so: Angebot<br />
von Miet- und Gewerbeflächen, stetiger<br />
Ausbau der Infrastruktur für Forschung<br />
und Entwicklung (F&E), Vernetzung von<br />
Grundlagenforschung und Industrie. Etwa<br />
70 Unternehmen tummeln sich inzwischen<br />
in mehreren Gebäuden unter den Fittichen<br />
der Technologieförderung.<br />
„Sonst wären wir ins Ruhrgebiet“<br />
Die regionalen Aktivitäten und Kooperationen<br />
kommen auch den Firmen im<br />
2002 erbauten Biotechnologiezentrum<br />
(BioZ) zugute. Eine davon ist die Cilian<br />
AG, eine Ausgründung der Uni Münster mit<br />
inzwischen 14 Mitarbeitern, die therapeutische<br />
Proteine mittels Einzellern (Ciliaten)<br />
produzieren. Geschäftsführer Marcus Hartmann<br />
ist sich zwar sicher, dass die Firma<br />
auch ohne die Technologieförderung existieren<br />
würde, aber: „Die Technologieförderung<br />
hat mit der Erstellung des BioZ die<br />
Arbeit von echten Biotech-Unternehmen in<br />
Münster überhaupt erst möglich gemacht.“<br />
Denn: „Ohne den Bau des BioZ hätte unsere<br />
Firma ins Ruhrgebiet ziehen müssen.“ Und<br />
mit ihr sicher auch so manch andere Firma.<br />
Wie zum Beispiel die Luminartis GmbH:<br />
Die Firma fand 2012 ihre neue Wirkstätte<br />
im Nano-Bioanalytik-Zentrum (NBZ). Lutz<br />
Haalck gründete das Unternehmen bereits<br />
2009 und stellt mit seinen drei Mitarbeitern<br />
Fluoreszenzmarker für bioanalytische Anwendungen<br />
her. „Was gut funktioniert, ist<br />
das gegenseitige Aushelfen bei bestimmten<br />
Geräten oder Methoden. Das klappt auf<br />
dem kleinen Dienstweg am schnellsten“,<br />
schreibt er. „Auch gemeinsame Messeauftritte<br />
gab es in der Vergangenheit, zum<br />
Beispiel mit dem Bioanalytikverein oder<br />
lokalen Mitstreitern.“ Allein sei so ein Auftritt<br />
für kleine Firmen nicht finanzierbar,<br />
ist Haalck sich sicher, und ergänzt: „Regionale<br />
Cluster sind dann sinnvoll, wenn man<br />
dort kompetente Ansprechpartner, sprich<br />
erfahrene Kollegen, findet, die einem beispielsweise<br />
Tipps für die Beantragung bestimmter<br />
Projekte geben können.“<br />
Aber Haalck berichtet zugleich von<br />
massiven Problemen bei der Suche nach<br />
regionalem Kapital. Auch ein weiterer<br />
Geschäftsführer eines Münsteraner Unternehmens,<br />
der seinen Namen an dieser<br />
Stelle lieber nicht gedruckt sehen möchte,<br />
beklagt sich: „Die deutliche Zurückhaltung<br />
regionaler institutioneller Geldgeber beim<br />
Angebot von Beteiligungskapital für Biotech-Unternehmen<br />
ist die größte Bedrohung<br />
für innovative Unternehmen aus der<br />
Region im internationalen Wettbewerb.“<br />
Da scheint es in Münster durchaus<br />
Nachholbedarf zu geben.<br />
Schwerpunktbildung: wichtig<br />
Fast so wichtig wie die regionale Vernetzung<br />
sei eine Schwerpunktbildung, ist<br />
sich Technologieförderer Günnewig sicher.<br />
Und Münsters Schwerpunkt ist winzig:<br />
Nanotechnologie.<br />
Im Jahr 2000 gründete sich der Verein<br />
„Bioanalytik-Münster“. Bei Nano2life,<br />
einem Programm zur Vernetzung europäischer<br />
Expertise in der Nanotechnologie,<br />
präsentierte Münster sich als ernstzunehmender<br />
Partner, ist sich Bioanalytik-Geschäftsführer<br />
Klaus-Michael Weltring<br />
sicher. Das nächste Projekt sei der Aufbau<br />
eines europäischen Nanocharakterisierungslabors,<br />
und dessen Ziel sei es,<br />
standardisierte präklinische Verfahren für<br />
Nanopartikel auf dem Weg zur medizinischen<br />
Anwendung zu etablieren, erklärt<br />
Weltring. „Damit sollen die Materialien<br />
schneller und sicherer in den Markt gebracht<br />
werden.“<br />
Interview: Jörg Fregien<br />
„Wir brauchen solche Strukturen“<br />
Foto: LSI<br />
Der promovierte Mediziner<br />
Jörg Fregien ist seit 2009 Geschäftsführer<br />
des Life Science<br />
Inkubators (LSI) am Bonner<br />
Forschungszentrum Caesar<br />
(„Center of advanced european<br />
studies and research“).<br />
Sie betreiben ein in Deutschland einzigartiges Gründerprogramm,<br />
den Life Sciene Inkubator in Bonn. Was macht ihn so<br />
besonders?<br />
Jörg Fregien: Wir finanzieren im Gegensatz zu anderen Programmen<br />
unsere Start-Ups über eine eigene Fondsgesellschaft,<br />
wenn auch nicht im vollem Umfang. 2009 haben wir das erste<br />
Projekt bei uns aufgenommen, die erste Ausgründung erfolgte<br />
2013. Seitdem gab es drei Ausgründungen.<br />
Das klingt erst einmal nach nicht viel.<br />
Fregien: Von etwa 100 Projekten, die wir uns im Vorfeld<br />
anschauen, übernehmen wir eines. Und die aufgenommenen<br />
Projekte wollen wir zur Hälfte ausgründen. Das haben wir<br />
bisher geschafft. Voraussetzung ist, dass die Vorhaben von<br />
Investoren als zu früh eingeschätzt werden, und sie dementsprechend<br />
keiner finanziert. Wenn wir in dieser risikoreichen<br />
Phase die biotechnologischen Projekte aufnehmen und von<br />
diesen Hochrisikoprojekten 50% nachhaltig ausgründen, dann<br />
ist das ein Erfolg.<br />
Wie hilft Ihnen dabei die Nähe zu Technologiezentren?<br />
Fregien: Es hilft uns vor allen Dingen, früh auf Projekte<br />
aufmerksam zu werden. Wir kooperieren unter anderem mit<br />
dem Life Science Center und der Universität in Düsseldorf.<br />
Wir lernen darüber wissenschaftliche und industrielle Kooperationspartner<br />
kennen. Finanzierungen sind heute schwieriger<br />
als vor 15 Jahren. Risikokapital steht nicht in diesem Maße<br />
zur Verfügung. Deshalb müssen Projekte gut vorbereitet und<br />
validiert sein, damit sie im Konkurrenzkampf um das internationale<br />
Venture-Kapital erfolgreich sind. Dafür brauchen wir solche<br />
Strukturen.<br />
Wie steht es um den Biotechnologie-Standort NRW?<br />
Fregien: Ich denke, dass sich der Biotech-Standort NRW<br />
erheblich entwickelt hat und konkurrieren kann mit den Standorten<br />
in Bayern und im Rhein-Main-Gebiet. Dazu beigetragen<br />
haben Spezialisierungen wie beispielsweise die Schwerpunktbildung<br />
des DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative<br />
Erkrankungen). Netzwerke, Inkubatoren und entsprechende<br />
Beratungsgremien haben wesentlich dazu beigetragen, dass<br />
der Standort heute in dieser vernetzten Art und Weise existiert.<br />
Interview: Sigrid März<br />
50<br />
4/2016 Laborjournal